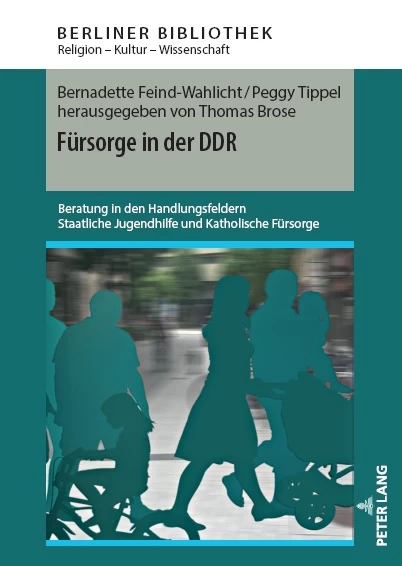Fürsorge in der DDR
Beratung in den Handlungsfeldern Staatliche Jugendhilfe und Katholische Fürsorge
Zusammenfassung
Die praktische Arbeit der staatlichen wie der katholischen Fürsorger war erheblich von inhaltlichen und weltanschaulichen Unterschieden geprägt. Wie wirkte sich das differierende Menschenbild auf das professionelle Handeln der Fürsorger aus? Haben die Machtverhältnisse in der DDR-Diktatur eine Beratungstätigkeit nach heutigem Verständnis sogar ganz verhindert?
Die qualitativen Befragungen von DDR-Fürsorgern als Experten und Zeitzeugen decken Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf, die mittels der Grounded Theorie kritisch reflektiert und eingeordnet werden - nicht zuletzt auch im Hinblick auf heutige Rahmenbedingungen und Reflexionsprozesse in der Sozialen Arbeit.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Eine wegweisende Untersuchung: Zur Bedeutung von Fürsorge in der DDR Thomas Brose
- 1 Einleitung
- 2 Beratung – eine begriffliche Einordnung
- 2.1 Professionelle Beratung
- 2.2 Macht und Beratung
- 2.3 Was ergibt sich daraus für die Fragestellung zur Beratung im Fürsorgekontext der DDR?
- 3 Die staatliche Fürsorge in der DDR
- 3.1 Das politische System der DDR
- 3.2 Fürsorge in der DDR
- 4 Die katholische Fürsorge in der DDR
- 4.1 Die Katholische Kirche in der DDR
- 4.2 Die besondere Situation der katholischen Fürsorge
- 5 Forschungsstand und Quellenlage
- 5.1 Stand der Forschung in Bezug auf den Forschungsgegenstand
- 5.2 Zeitzeugenarbeit
- 6 Darstellung und Reflexion der Forschungsgrundlage
- 6.1 Methode der Datenerhebung
- 6.2 Datenauswertung
- 7 Auswertung der Ergebnisse
- 7.1 Darstellung der Auswertungscodes
- 7.2 Thematisch fokussierte Darstellung der Interviewauswertung aus dem Handlungsfeld der staatlichen Jugendfürsorge
- 7.3 Thematisch fokussierte Darstellung der Interviewauswertung aus dem Handlungsfeld der katholischen Fürsorge
- 7.4 Vergleichende Betrachtung
- 8 Abschlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Thomas Brose
Eine wegweisende Untersuchung: Zur Bedeutung von Fürsorge in der DDR
1.
Nach dem Zweiten Weltkrieg existierte in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) eine in den folgenden 45 Jahren nie mehr erreichte Vielfalt innerhalb der Bildungslandschaft. Bis 1947 wurden auch die Kirchen von der sowjetischen Besatzungsmacht als „antifaschistische“ Organisationen mit Entgegenkommen behandelt; sie wurden als Ansprechpartner akzeptiert und konnten in der bildungshungrigen Nachkriegszeit wieder damit beginnen, Religionsunterricht zu erteilen und caritativ tätig zu werden.
„Zur religiösen und kirchlichen Lage“ – keineswegs zufällig, sondern mit geschultem Blick für politische Zusammenhänge verfasste ein Mitarbeiter des Zentralsekretariats der SED im Jahr 1946 unter diesem Titel eine Situationsanalyse der Lage in Ostdeutschland. Wegweisend heißt es darin: „Es läßt sich im allgemeinen sagen, daß der religiöse Auftrieb, der in den ersten Monaten des Jahrs 1945 zu beobachten war, im allgemeinen zum Stillstand gekommen ist. Diese Tatsache läßt sich leicht erklären. Nach dem völligen Zusammenbruch schienen ja die Kirchen das einzig Dauernde geblieben zu sein. Viele flüchteten sich in den ‚Schoß der Kirche‘ um hier Halt zu suchen. Das Anhalten der schlechten sozialen Lage hat nun bei Vielen Enttäuschung oder auch Gleichgültigkeit hervorgerufen, so daß das religiöse Interesse zumindest zum Stillstand gekommen ist. […] Das gestärkte kirchliche Selbstbewußtsein wird besonders in der Schulfrage noch zu großen Schwierigkeiten führen. Es ist nicht damit zu rechnen, daß beide Kirchen hier nachgeben werden.“1
Kurz nach dem Krieg deutet sich damit, wie dieser Text zeigt, bereits an, was in den folgenden vier Jahrzehnten als Dauerkonflikt („Schulfrage“) zwischen Staat und Kirche im Zentrum stehen wird: die Problematik, welche Spielräume Religion für sich in Anspruch nehmen konnte, um in der DDR-Gesellschaft mit alternativen Bildungsangeboten – von konfessionellen Kindergärten über Studentengemeinden bis zur Fürsorge – präsent zu sein.
Der SED erschien es für ihren Machterhalt entscheidend, die öffentliche Kommunikation auf allen Ebenen zu kontrollieren. Die Staatspartei versuchte deshalb, jeden Ansatz zur Entwicklung einer pluralistischen Gesellschaft mit weltanschaulicher und intellektueller Vielfalt zu unterbinden. Universitäten, Hoch- und Fachschulen in Ostdeutschland avancierten deshalb zu Zentren weltanschaulicher Auseinandersetzung. Als Teil einer ideologischen Gesamtstrategie – mit der zweiten Hochschulreform von 1951 wurde das gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium des Marxismus-Leninismus obligatorisch – führte dies zu dem erklärten Ziel, die christliche Glaubens-, Sprach- und Denkwelt zu diskreditieren und Religion als von der Wissenschaft längst überwundenen „Mystizismus“ und „Aberglauben“ zu diffamieren.
2.
Es verdient Beachtung, dass die katholische Kirche in der DDR der ideologischen Auseinandersetzung mit dem atheistischen Weltanschauungsstaat nicht aus dem Weg ging. Ihren Einspruch gegen wachsenden Uniformitätszwang machte die Berliner Bischofskonferenz z.B. im Jahr 1974 durch ein scharf gehaltenes Hirtenwort „Zur christlichen Erziehung“ geltend. Darin wird kritisiert: „In den Erziehungs- und Lehrplänen – vom Kindergarten bis zur Universität – ist ausschließlich die Weltanschauung des dialektischen Materialismus die Grundlage. Das gesamte Leben soll von dieser Ideologie her geprägt werden. Weltanschauliche Neutralität wird abgelehnt. Entsprechend wird einzig die sozialistische Moral als richtig hingestellt, zu der die Erziehung zum Haß gehört. Von dieser Einseitigkeit her werden Religion und Christentum oft entstellt und verzerrt dargestellt. Der christliche Glaube wird als Aberglaube oder als bürgerliche Ideologie verunglimpft, als eine verderbliche Lebensform, die mit Opiumsucht und Alkoholmißbrauch in einem Atem genannt wird.“2
Trotz ideologischer Disziplinierung, strengster Verbote und einer Strategie der Ausgrenzung existierten im durchorganisierten Weltanschauungsstaat zugleich Freiräume, in denen – wie sonst nirgendwo – eine andere Art von Wertorientierung ermöglicht wurde: in einer von beiden Kirchen aufrecht erhaltenen institutionellen Infrastruktur, zu der auch die Ausbildung christlicher Fürsorgerinnen und Fürsorger zählte. Denn anders als vielfach vermutet, war die DDR kein monolithisches Gebilde. Trotz Dominanz des „einheitlichen sozialistischen Bildungssystems“ existierte dort zugleich eine erstaunlich vielfältige kirchlich-caritative Szene3, die einen eigenständigen Bildungskosmos (z.B. in katholischen Krankenpflegeschulen) mit grenzüberschreitenden Kontakten eröffnete.
Der Aufgabe, diese Parallelwelt – so der treffsicher gewählte Titel einer Darstellung – materialreich zu dokumentieren, widmen sich Uwe Grelak und Peer Pasternack auf 700 Seiten.4 Diese die Epoche des realen Sozialismus zumeist überdauernde kirchlich-konfessionelle Bildungslandschaft reichte von der Elementarpädagogik in Kindergärten und Kinderheimen, über Vorseminare, Berufsausbildungen, Kirchliche Hochschulen bis hin zu Filmdiensten und Evangelischen Akademien.
Existierten 1949, im Gründungsjahr des ostdeutschen Staates, insgesamt 141 konfessionelle Einrichtungen, gab es an dessen Ende 205. „Dieses Kernsegment des konfessionell gebundenen Bildungswesens hatte also“, erläutern die beiden Verfasser, „über die vier DDR-Jahrzehnte hin ein Wachstum um 45 Prozent erfahren.“5
Indem U. Grelak und P. Pasternack eine möglichst vollständige Dokumentation des konfessionell gebundenen Bildungswesens in der DDR bieten, machen sie zugleich auf das gesellschaftspolitische Potential aufmerksam, das sich in dieser „Parallelwelt“ akkumulieren konnte. Vor allem stellten die konfessionell getragenen Einrichtungen „in der DDR den einzigen Bereich dar, der sich ganz überwiegend außerhalb des sozialistischen Bildungssystems befand, und die dort angesiedelten Einrichtungen waren entsprechend dem staatlichen Zugriff weniger ausgesetzt.“6
Trotz vielfältiger Formen von Christenverfolgung, Diskriminierung und ideologischer Bevormundung stellte das konfessionelle Bildungswesen damit Ressourcen zur Verfügung, die es „Untertanen“ erlaubte, zu Bürgerinnen und Bürgern heranzuwachsen. „Angebote“ der Kirchen stärkten die Zivilgesellschaft; sie eröffneten Räume, um widerständiges Handeln einzuüben und ermöglichten es Menschen z.B. im Fürsorgebereich, in einem von Feindbildern und Hassbotschaften beherrschten vormundschaftlichen Staat humanes Verhalten einzuüben und für das Heil-Sein „verwundeter Seelen“ wirksam zu werden.
3.
Die von Bernadette Feind-Wahlicht und Peggy Tippel vorgelegte Untersuchung erschließt Neuland – und eröffnet weite Horizonte. Ihr Zugang ergab sich durch ihre berufliche Nähe zum Forschungsfeld. Das Buch zeigt auf exemplarische Weise, wie man sich einem bisher kaum beachteten Gegenstand – staatlichem bzw. kirchlich-katholischem „Beratungshandeln“ in der DDR – durch eine innovative Methodik (einfühlsam und ermutigend werden auch Personen aus dem näheren Umfeld der Verfasserinnen als Zeitzeugen befragt) nährt und dadurch den Zugang zu bisher vernachlässigten Wissensbeständen Sozialer Arbeit gewinnt. Die von den Autorinnen geführten Interviews erweisen sich dabei als besonders wertvoll, sie stellen auch für weitere Untersuchungen wichtiges Material zur Verfügung, um ostdeutsche Biografien in ihrem jeweiligen Kontext zu verorten.
Der von B. Feind-Wahlicht und P. Tippel vorgelegte Band zeichnet sich insgesamt durch eine beeindruckende historisch-empirische Durchdringung des Themas aus, weiß sich grundlegenden ethischen Standards verpflichtet und erscheint als Ergebnis langwieriger Feldforschung. Die Studie geht der Frage nach, inwieweit in den Handlungsfeldern Staatliche Jungendhilfe und Katholische Fürsorge eine an westlichen Standards gemessene Professionalität erreicht wurde, die es, auch gemessen an heutigen Standards, rechtfertigt, von echter Beratung zu sprechen.
Um diese Problematik zu klären, überprüfen die Autorinnen zwei zentrale Thesen: Zum einen (1.) ist dies die Vermutung, dass es erhebliche inhaltlich-ideologische Unterschiede – nicht zuletzt aufgrund von Differenzen im christlichen bzw. sozialistischen Menschenbild – in der staatlichen sowie der katholischen Fürsorgeausbildung gegeben hat. Die unterschiedlichen Menschenbilder hatten große Auswirkung auf das jeweilige Beratungshandeln.
Details
- Seiten
- 158
- Erscheinungsjahr
- 2023
- ISBN (PDF)
- 9783631901502
- ISBN (ePUB)
- 9783631901892
- ISBN (Hardcover)
- 9783631901496
- DOI
- 10.3726/b20816
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2023 (Juli)
- Schlagworte
- Professionelle sozialarbeiterische Beratung im Fürsorgekontext der DDR DDR-Fürsorgern Sozialen Arbeit
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023. 158 S., 1 farb. Abb., 4 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG