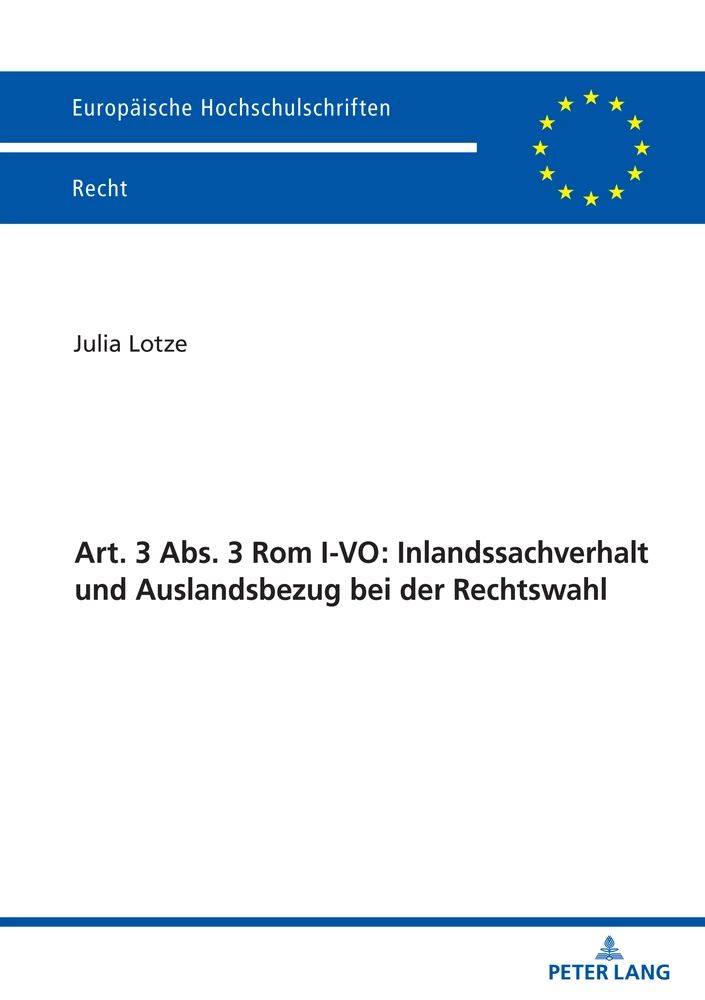Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO: Inlandssachverhalt und Auslandsbezug bei der Rechtswahl
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Englische Rechtsprechung: Santander und Dexia
- II. Stand der Literatur und Rechtsprechung
- III. Ziel und Gang der Untersuchung
- IV. Thematische Eingrenzung
- Erster Teil: Regelungsgefüge des Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- A. Kompetenzgrundlage, Art. 65 lit. b EG-Vertrag, Art. 81 AEUV
- I. Auslegung des „grenzüberschreitenden Bezugs“
- II. Verhältnis zu Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- B. Rom I-VO
- I. Räumlicher Anwendungsbereich, Art. 1 Abs. 1 Rom I-VO
- II. Weitere Schranken der Rechtswahlfreiheit
- 1. Schutz strukturell unterlegener Vertragsparteien
- a) Wirkungsbeschränkungen: Art. 6 Abs. 2 S. 2 und Art. 8 Abs. 1 S. 2 Rom I-VO
- b) Wählbarkeitsbeschränkungen: Art. 5 Abs. 2 Unter-abs. 2, Art. 7 Abs. 3 Unterabs. 1 Rom I-VO
- 2. Schutz öffentlicher Interessen
- a) Eingriffsnormen, Art. 9 Rom I-VO
- aa) aa) Begriff der Eingriffsnorm, Art. Abs. 1 Rom I-VO
- bb) bb) Durchsetzung der Eingriffsnormen, Art. Abs. 2 und 3 Rom I-VO
- b) Ordre Public, Art. 21 Rom I-VO
- III Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- 1. Maßgeblicher Zeitpunkt
- 2. Innerstaatlich zwingendes Recht
- 3.Rechtsfolge
- a) Relevanz der Debatte
- aa) Verhältnis zu Art. 6 Abs. 2 S. 2, Art. 8 Abs. S. 2 Rom I-VO
- bb) Gestaltungsfreiheit der Parteien
- cc) Verfahrensrecht
- dd) Rechtswahl in AGB
- (1) Anwendbarkeit deutschen AGB-Rechts
- (2) Einbeziehungskontrolle
- (a) Möglichkeit zur Kenntnisnahme, § Abs. 2 Nr. 2 BGB
- (b) Überraschende Klausel, § 305c Abs. 1 BGB
- (c) Ergebnis
- (3) Inhaltskontrolle
- (4) Ergebnis
- ee) Insolvenzrecht
- ff) Indirekte Rechtswahl in der Rom II-VO
- gg) Ergebnis
- b) Stellungnahme
- aa) Historie
- bb) Systematik
- cc) Telos
- (1) Verhinderung der Umgehung innerstaatlich zwingenden Rechts
- (2) Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz
- (3) Berechenbarkeit und Rechtssicherheit
- dd) Ergebnis
- Zweiter Teil: Maßstab des Auslandsbezugs
- A. Dogmatische Grundlage der Parteiautonomie
- I. Kollisionsrechtliche Begründung
- 1. Herleitung aus Savignys Prinzip der engsten Verbindung
- 2. Unvereinbarkeit mit der unverbundenen Rechtswahl
- II. Materiellrechtliche Begründung
- 1. Dogmatische Grundlage der Vertragsfreiheit
- a) Art. 16 GRCh
- b) Unionsrechtliches Auffanggrundrecht
- c) Nationale Grundrechte am Beispiel des Grundgesetzes
- d) Ergebnis
- 2. Entscheidung des EuGH in der Rs. Unamar
- 3. Stellungnahme zur Übertragung auf die Parteiautonomie
- 4. Ergebnis
- III. Grundfreiheiten
- 1. Räumlich-persönlicher Anwendungsbereich der Grundfreiheiten
- 2. Grundfreiheiten als Beschränkungsverbote im Internationalen Privatrecht
- a) Grundfreiheiten als Beschränkungsverbote
- b) These von der Kollisionsrechtsneutralität der Grundfreiheiten
- c) Reduzierung der Grundfreiheiten auf das Herkunftslandprinzip
- d) Ergebnis
- 3. Entscheidung des EuGH in der Rs. Alsthom Atlantique
- a) Sachverhalt
- b) Entscheidung
- 4. Objektive Anknüpfung als Beschränkung der Grundfreiheiten
- a) Maßstab für Beschränkung der Grundfreiheiten
- aa) Allgemein
- bb) Ökonomische Analyse
- (1) Ziele der ökonomischen Analyse im Internationalen Privatrecht
- (a) Förderung marktmäßiger Lösungen
- (aa) Herleitung aus dem Coase-Theorem
- (bb) Defizite des Coase-Theorems und Alternativen
- (cc) Parteiautonomie im Internatio-nalen Privatrecht
- (b) Reduzierung der Transaktionskosten
- (aa) Rechtsinformationskosten
- (bb) Rechtsunsicherheitskosten
- (cc) Mit der Rechtswahl verbundene Kosten
- (2) Parameter für Beschränkung der Grund-freiheiten
- b) Wirkung einer rein objektiven Anknüpfung
- aa) Rechtsunsicherheit bei objektiver Anknüpfung
- bb) Steigende Transaktionskosten durch Berücksichtigung mehrerer Rechtsordnungen
- cc) Branchenübliche Rechte und Netzeffekte
- dd) Einschränkung inhaltlicher Gestaltungsfreiheit
- ee) Diskrepanzen zwischen anwendbaren Rechten
- ff) Ergebnis
- c) Wirkung nicht zu indirekt oder ungewiss
- 5. Keine Verkaufsmodalität im Sinne der Keck-Rechtsprechung
- 6. Ergebnis
- IV. Zusammenfassung und Ausblick
- B. Auslegung des Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- I. Wortlaut
- 1. Allgemein
- a) Behandlung verschiedener Sprachfassungen
- b) Irrelevanz der Wortlautveränderungen gegenüber dem EVÜ
- 2. Analyse
- a) Fehlender Verweis auf subjektive Merkmale
- b) Erforderlichkeit einer kollisionsrechtlichen Verbindung zu einem bestimmten Staat
- aa) Parallele Formulierung zu Art. 1 Abs. 1 Rom I-VO .
- bb) Wortlautvergleich mit Art. 4 Abs. 1 EVÜ, Art. 4 Abs. 4 Rom I-VO
- cc) Zwischenergebnis
- c) Kontrast des Begriffs „Sachverhalt“ zu „Vertrag“
- d) Erforderlichkeit der Lokalisierung der Umstände in einem Land
- e) Relevanzkriterium in englischer Sprachfassung
- f) Die „anderen“ Elemente
- 3. Ergebnis
- II. Historie
- 1. Materialien zum EVÜ
- a) Entwürfe zum EVÜ
- b) Giuliano/Lagarde-Bericht
- aa) Erläuterungen zu Art. 3 Abs. 3 EVÜ
- bb) Erläuterungen zu Art. 1 Abs. 1 EVÜ
- c) Materialien zur nationalen Umsetzung bzw. zum Beitritt zum EVÜ
- 2. Materialien zur Rom I-VO
- 3. Ergebnis
- III. Systematik
- 1. Internationale Übereinkommen
- 2. Rom I-VO
- a) Anknüpfungspunkte
- aa) Prinzip der engsten Verbindung als Vermutungsgrundlage
- bb) Widerlegung der Vermutung
- cc) Fazit
- b) Ausweichklauseln und Auffangregel
- c) Beschränkte Rechtswahl
- 3. Rom II-VO
- a) Auslegungszusammenhang zwischen Rom I-VO und Rom II-VO
- b) Art. 14 Abs. 2 Rom II-VO
- 4. Brüssel Ia-VO
- a) Auslegungszusammenhang zwischen Brüssel Ia-VO und den Rom-Verordnungen
- b) Auslandsbezug in der Brüssel Ia-VO
- aa) Diskussion um den internationalen Bezug in der Brüssel Ia-VO
- bb) Rechtsprechung des EuGH zum Auslandsbe-zug in der Brüssel Ia-VO
- cc) Übe rtragbarkeit auf Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- (1) Vergleichbarkeit der Fragestellungen
- (2) Übertragbarkeit der Rechtsprechung des EuGH
- 5. Familien- und erbrechtliches Kollisionsrecht.
- IV. Telos .
- 1. Innerstaatlich zwingendes Recht
- a) Funktionen und Ziele
- aa) Schutzzwecke.
- bb) Regelungsziele
- (1) Regulierungsfunktion
- (a) Regulierungsbegriff
- (b) Beispiel: Regulierung im Kaufrecht.
- (c) Beispiel: Regulierung von Swaps durch zwingendes Vertragsrecht
- (2) Interessenausgleich
- (a) Interessenausgleich als Skala
- (b) Beispiel: Wegfall der Geschäftsgrundlage
- b) Teil der Wirtschaftsverfassung
- 2. Durchsetzung innerstaatlich zwingenden Rechts über Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- a) Ökonomische Analyse des Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- aa) Marktversagen durch externe Effekte
- bb) Ineffiziente Regulierung oder „race to the bottom“
- cc) Bewertung
- b) Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO als Sicherung staatlicher Rechtssetzungsansprüche
- aa) Spannungsfeld: Rechtswahl und staatlicher Rechtssetzungsanspruch
- (1) Traditionelle Sichtweise: Rechtswahl als Gefährdung der Souveränität
- (2) Wandel des Verständnisses der Souveränität im Internationalen Privatrecht
- (3) Verständnis und Funktion des IPR im Wandel
- bb) Funktion des Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO: Schutz des staatlichen Rechtssetzungsanspruchs
- cc) Kontinuum der Durchsetzung zwingenden Rechts in der Rom I-VO
- (1) Völkerrechtliche Vorgaben
- (2) Kontinuum der Durchsetzung zwingenden Rechts
- (3) Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO im System der Durchsetzung zwingenden Rechts
- 3. Parameter für den Inlandssachverhalt
- a) Objektive Manipulierbarkeit als negatives Kriterium
- aa) Vergleich mit allgemeiner Missbrauchskontrolle
- (1) Allgemeine Missbrauchskontrolle
- (2) Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO als typisierte Missbrauchskontrolle
- bb) Objektive Manipulierbarkeit
- b) Wirtschaftlicher Maßstab
- aa) Wirtschaftsverfassungsrechtliche Funktion
- bb) Wirtschaftlicher Maßstab
- 4. Zwischenergebnis
- V. Enge Auslegung als Ausnahme
- 1. Auslegungsgrundsatz in der Rechtsprechung des EuGH
- 2. Enge Auslegung von Art 3 Abs. 3 Rom I-VO als Folge?
- 3. Ergebnis
- VI. Ergebnis
- C. Art.
- 1. Abs. 3 Rom I-VO in der Dogmatik der Parteiautonomie Bedeutung des grenzüberschreitenden Sachverhalts im Unionsrecht
- 2. Grenzüberschreitender Sachverhalt als Anwendungsvoraussetzung der Grundfreiheiten.
- a) Rechtsprechung des EuGH.
- b) Übertragung auf Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO.
- aa) Fehlender grenzüberschreitender Sachverhalt
- bb) Wirkungsorientierter Ansatz.
- cc) Übertragung einzelner Urteile.
- c) Fazit
- 3. Beschränkungsverbot: Bezugnahme auf Gemeinschaft.
- 4. Rechtfertigungsebene
- a) Legitimes Gemeinwohlziel.
- b) Geeignetheit.
- c) Erforderlichkeit .
- d) Angemessenheit
- aa) Intensität der Beschränkungswirkung
- bb) Betroffenheit des souveränen Rechtssetzungs-anspruchs
- 5. Fazit: Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO in der Dogmatik der Grundfreiheiten
- II. Materiellrechtliche Begründung
- 1. Anwendungsbereich der Unionsgrundrechte
- 2. Abwehrrechtliches Verständnis oder Ausgestaltung eines normgeprägten Grundrechts?
- 3. Maßstab: Verhältnismäßigkeit
- a) Geeignetheit.
- b) Erforderlichkeit .
- c) Angemessenheit
- aa) Schwere der Beeinträchtigung individueller Freiheit
- bb) Geltungsanspruch nationalen Rechts
- 4. Fazit: Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO in der materiellrechtlichen Begründung
- III. Gespaltene Auslegung als Folge?
- 1. Verhältnismäßigkeitsprüfung als Schnittmenge
- 2. Objektiv-institutionelle und individuell-freiheitliche Perspektive
- 3. Grenzüberschreitendes Element bei den Grundfreiheiten
- 4. Ergebnis
- IV. Zusammenfassung
- D. Parameter zur Präzisierung des Auslandsbezugs
- Dritter Teil: Fallgruppen
- A. Bezug des Vertrags zu anderem Staat
- I. Umstände des Vertragsschlusses
- 1. Abschlussort
- a) Systematik
- aa) Relevanz für das Vertragsstatut
- (1) Art. 4 Abs. 1 lit. g Rom I-VO
- (2) Art. 4 Abs. 1 lit. h Rom I-VO
- (3) Art. 6 Abs. 1, Art. 8 Abs. 3 Rom I-VO
- (4) Art. 4 Abs. 3, 4 Rom I-VO
- (5) Fazit
- bb) Art. 11 Abs. 1, 2 Rom I-VO
- (1) Regelungszweck
- (2) Übertragbarkeit
- cc) Art. 13 Rom I-VO
- dd) Fazit
- b) Rechtsunsicherheitskosten
- c) Missbrauchspotential
- d) Wirtschaftlicher Maßstab
- e) Fazit
- 2. Vertragsverhandlungen
- a) Systematische Anhaltspunkte.
- b) Rechtsunsicherheitskosten
- c) Missbrauchspotential
- d) Wirtschaftlicher Maßstab
- e) Fazit
- 3. Vertragssprache.
- a) Systematische Anhaltspunkte.
- b) Missbrauchspotential
- c) Ergebnis
- 4. Fazit
- II. Vertragserfüllung
- 1. Erfüllungsorte.
- a) Systematik
- aa) Rom I-VO
- (1) Erfüllungsort als Anknüpfungsmerkmal: Art. 5 Abs. 1, 8 Abs. 2 Rom I-VO
- (2) Eingriffsnormen am Erfüllungsort: Art. Abs. 3 Rom I-VO
- (3) Indiz für engere bzw. engste Verbindung: Art. 4 Abs. 3, 4 Rom I-VO
- (4) Fazit
- bb) Brüssel Ia-VO.
- b) Missbrauchspotential
- aa) Abstrakte Erfüllungsortsvereinbarungen
- bb) Erfüllungsort bei Geldschulden
- cc) Zwischenergebnis
- c) Wirtschaftlicher Maßstab
- d) Ergebnis.
- 2. Zahlung in Fremdwährung
- III. Belegenheitsort des Vertragsgegenstands
- 1. Unbewegliche Sachen
- a) Systematik
- b) Missbrauchspotential und wirtschaftlicher Maßstab.
- c) Ergebnis
- 2. Bewegliche Sachen
- a) Systematik.
- aa) Vertragsstatut.
- bb) Eingriffsnormen
- cc) Ergebnis
- b) Rechtsunsicherheitskosten
- c) Missbrauchspotential
- d) Ergebnis.
- IV. Ergebnis
- B. Bezug einer Vertragspartei zu anderem Staat.
- I. Auslandsbezug einer natürlichen Person
- 1. Gewöhnlicher Aufenthalt / Hauptniederlassung
- a) Relevanz als Auslandsbezug.
- aa) Systematische Vermutungswirkung.
- bb) Rechtsunsicherheitskosten
- cc) Missbrauchspotential
- dd) Ergebnis
- b) Irrelevanz eines abweichenden privaten gewöhnlichen Aufenthalts
- c) Ergebnis.
- 2. Staatsangehörigkeit
- a) Systematische Anhaltspunkte
- aa) Internationales Privatrecht
- (1) Schuldvertragsrecht.
- (a) Art. 7 Abs. 3 lit. c Rom I-VO
- (b) Art. 13 Rom I-VO
- (c) Art. 4 Abs. 3, 4 Rom I-VO.
- (d) Fazit
- (2) Familien- und Erbrecht.
- (a) Relevanz der Staatsangehörigkeit
- (b) Übertragbarkeit auf Art. Abs. 3 Rom I-VO .
- (aa) Legitimation des Staatsangehörigkeitsprinzips
- (bb) Begründung der neuen Rolle im Europäischen Kollisionsrecht
- (cc) Übertragbarkeit ins Schuldrecht
- (dd) Zwischenergebnis
- bb) Internationales Zivilverfahrensrecht: Brüssel Ia-VO
- b) Primärrecht
- aa) Ungleichbehandlung
- (1) Fall
- (2) Fall
- (3) Vergleich
- (4) Zwischenergebnis
- bb) Rechtfertigung
- (1) Rechtsunsicherheit
- (2) Verbundenheit
- (a) Kulturelle Verbundenheit
- (b) Rechtliche Verbundenheit
- (3) Fazit
- cc) Ergebnis
- II. Auslandsbezug eines Personenzusammenschlusses
- 1. Hauptverwaltung/Niederlassung
- a) Vermutungswirkung für die Hauptverwaltung
- b) Vermutungswirkung für die Niederlassung
- c) Verhältnis von Hauptverwaltung und Niederlassung
- aa) Systematik
- bb) Missbrauchspotential
- cc) Fazit
- 2. Satzungssitz
- a) Begriffsverständnis
- b) Relevanz des Satzungssitzes in der Brüssel Ia-VO
- aa) Art. 63 Abs. 1 Brüssel Ia-VO
- bb) Übertragbarkeit
- c) Missbrauchspotential
- aa) Grenzüberschreitende Mobilität von Gesell-schaften
- bb) Anreize für die Verlegung des Satzungssitzes
- cc) Folgen für Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- dd) Fazit
- III. Nachträgliche Veränderungen
- 1. Vertragsübernahme
- a) Wortlaut
- b) Rechtsprechung: Bosman, Graf, Moser
- c) Rechtsunsicherheitskosten
- d) Missbrauchspotential
- e) Wirtschaftlicher Maßstab
- f) Fazit
- 2. Abtretungsrechte
- 3. Zwischenergebnis
- IV. Ergebnis
- C. Internationaler Bezug: Internationale Standardverträge
- I. Internationale Standardverträge
- II. ISDA-Vertragsdokumente
- 1. ISDA-Vertragsstruktur
- 2. Englische Rechtsprechung: Santander, Dexia
- a) Sachverhalte
- b) Berufung auf Art. 3 Abs. 3 EVÜ
- c) Urteile
- aa) High Court: Dexia Crediop v Comune di Prato
- bb) High Court: Banco Santander v Transport Companies
- cc) Court of Appeal: Banco Santander v Transport Companies
- dd) Court of Appeal: Dexia Crediop v Comune di Prato
- d) Reaktionen in Literatur und Praxis
- e) Zusammenfassung
- 3. Einfluss auf Transaktionskosten
- a) Effekte der standardisierten ISDA Vertragsdoku mentation
- aa) Netzeffekte
- (1) Direkte Netzeffekte
- (2) Indirekte Netzeffekte
- bb) Wechselkosten
- cc) Fazit
- b) Zusammenhang mit anwendbarem Recht
- aa) Funktionsschwierigkeiten bei objektiver Anknüpfung
- bb) Funktionszusammenhang mit Wahl des englischen und New Yorker Rechts
- cc) Fazit
- c) Ergebnis
- 4. Missbrauchspotential
- 5. Fehlender Bezug zu anderem Staat
- a) Raumbezogenheit des internationalen Privatrechts
- b) Vergleich zur Wahl nichtstaatlichen Rechts
- aa) Begrenzung der Rechtswahl auf staatliches Recht
- bb) ISDA-Verträge als nichtstaatliches Recht
- cc) Übertragung auf Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO
- c) System zwingender Normen als Spektrum staatlicher Nähebeziehungen
- d) Ergebnis
- 6. Fazit
- D. Mittelbarer Auslandsbezug: Auslandsbezug eines anderen Vertrags
- I. Allgemein
- 1. Wortlaut
- 2. Art. 4 Abs. 3 und 4 Rom I-VO
- 3. Brüssel I-VO: Maletic
- 4. Fazit
- II. Vertragsketten
- 1. Unterschiedliche Vertragsstatute als Hindernis
- a) Kaufvertragsketten
- aa) Abbruch der Regressansprüche entlang der Vertragskette
- bb) Doppelung von Regressansprüchen entlang der Vertragskette
- cc) Bewertung
- b) Back-to-back Swaps
- aa) Funktion der back-to-back Swaps
- bb) Divergenzen als Gefahr für die Absicherung
- cc) Entscheidungen in Dexia und Santander
- dd) Bewertung
- 2. Einheitlichkeit des Vertragsstatuts durch Rechtswahl entlang der Vertragskette
- a) Gleichlauf der Vertragsstatute
- b) Fortbestehen von Belastungen trotz Rechtswahl
- aa) Regresslücken als Regressschutz
- bb) Keine gänzliche Vereinheitlichung möglich
- cc) Ergebnis
- c) Ergebnis
- 3. Zeitliches Verhältnis und Erkennbarkeit
- a) Dexia und Santander
- b) Ansichten in der Literatur
- c) Bewertung
- aa) Zeitliches Verhältnis
- bb) Erkennbarkeit
- cc) Zusammenfassung
- 4. Missbrauchspotential
- 5. Ergebnis
- III. Verbindung zu finanziertem Geschäft
- 1. Caterpillar Financial Services Corporation v SNC Passion
- a) Sachverhalt
- b) Entscheidung
- 2. Praktische Auswirkungen der objektiven Anknüpfung
- a) Rechtsunsicherheit
- b) Anderweitiges praktisches Bedürfnis nach Rechtswahl
- c) Ergebnis
- 3. Ergebnis
- E. Ergebnis
- Literaturverzeichnis
- Materialien
Julia Lotze
Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO: Inlandssachverhalt und Auslandsbezug bei der Rechtswahl

Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zugl.: Hamburg, Bucerius Law School, Diss., 2023.
H 360
ISSN 0531-7312
ISBN 978-3-631-91275-1
EBOOK 978-3-631-91281-2
E-PUB 978-3-631-91282-9
DOI 10.3726/b21453
© 2024 Peter Lang Group AG, Lausanne
Verlegt durch: Peter Lang GmbH, Berlin, Deutschland
info@peterlang.com www.peterlang.com
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Autorenangaben
Julia Lotze, studierte Rechtswissenschaften an der Bucerius Law School in Hamburg sowie der University of New South Wales in Sydney. Im Anschluss an Ihre Promotion bei Prof. Dr. Karsten Thorn an der Bucerius Law School absolvierte sie ihr Referendariat am Oberlandesgericht Celle, mit Stationen bei der Verwaltung des deutschen Bundestags in Berlin sowie einer internationalen Wirtschaftskanzlei in New York.
Über das Buch
Die Rechtswahlfreiheit stellt eines der Grundprinzipien des europäischen Kollisionsrechts dar. Für sog. Inlandssachverhalte findet diese in Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO ihre Grenze. In diesen Fällen bleiben die Parteien an zwingendes inländisches Recht gebunden. Anlässlich jüngerer Rechtsprechung des Englischen Court of Appeals gilt es, sich näher mit dieser Regelung auseinanderzusetzen, die im Spannungsfeld zwischen dem staatlichem Regulierungsanspruch und der Gestaltungsfreiheit der Parteien steht. Hierbei werden Maßstäbe für die Feststellung eines Inlandssachverhalts entwickelt, die sodann auf in Praxis und Literatur diskutierte Fallbeispiele angewendet werden.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde von der Bucerius Law School – Hochschule für Rechtswissenschaften – als Dissertation angenommen. Die mündliche Promotionsprüfung erfolgte am 5. Juli 2023. Die in dieser Arbeit verwendete Literatur ist auf dem Stand von November 2021.
Ich danke Prof. Dr. Karsten Thorn als Betreuer und Erstgutachter dieser Arbeit. Ferner bedanke ich mich bei Prof. Dr. Bettina Heiderhoff für die Erstellung des Zweitgutachtens sowie die Möglichkeit, am „Programme in European Private Law for Postgraduates“ in Münster und Krakau teilzunehmen.
Die Vollendung dieser Arbeit wäre ohne vielseitige Unterstützung nicht möglich gewesen. Herzlichster Dank gilt Antonia von Treuenfeld sowie meiner Schwester Katrin Lopes für das Lektorat dieser Arbeit. Janusch Krasberg danke ich für inhaltliche Anregungen und wertvolle Diskussionen.
Größter Dank jedoch gebührt meinen Eltern, Dr. Andreas und Hildegard Lotze. Ihre Förderung und Unterstützung haben nicht nur diese Promotion, sondern meinen gesamten Werdegang erst ermöglicht. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet, was meine immense Dankbarkeit nur ansatzweise ausdrücken kann.
Berlin, April 2024
Julia Lotze
Details
- Seiten
- 398
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631912812
- ISBN (ePUB)
- 9783631912829
- ISBN (Paperback)
- 9783631912751
- DOI
- 10.3726/b21453
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (Januar)
- Schlagworte
- Internationales Privatrecht Kollisionsrecht Rechtswahl Rom I-VO
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 398 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG