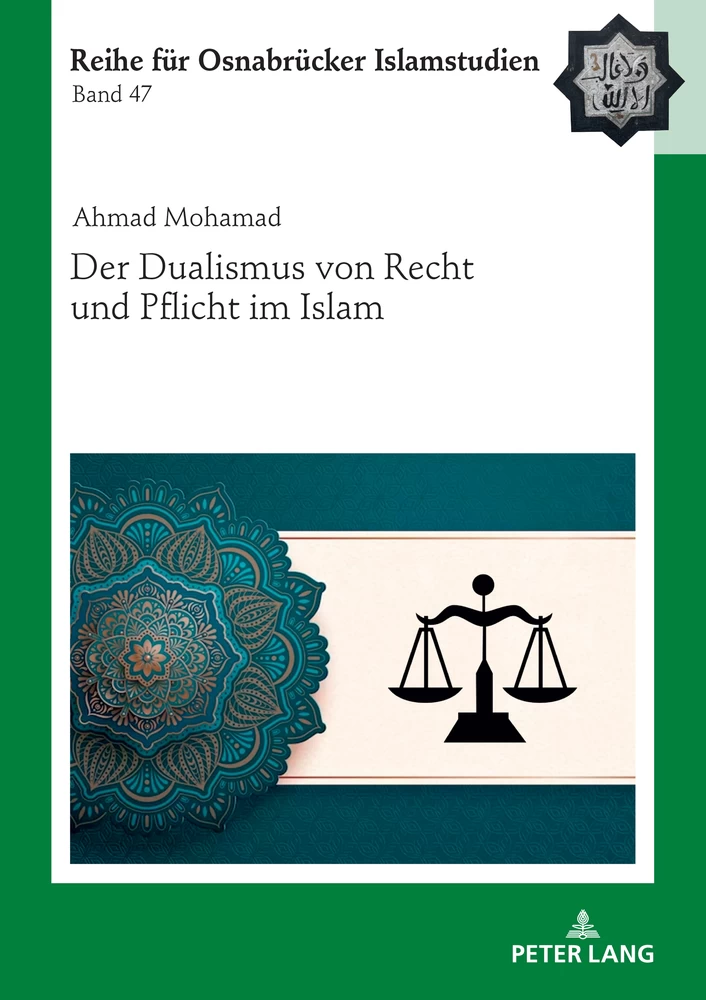Der Dualismus von Recht und Pflicht im Islam
Summary
In dieser Arbeit widmet sich der Autor der Leitfrage, warum der Begriff wāǧib sowohl im fiqh als auch in den uṣūl al-fiqh Vorrang vor dem Begriff ḥaqq hat. Damit verknüpft ist die Frage, ob die Rechte Gottes in den uṣūl al-fiqh tatsächlich gegenüber den Rechten der Menschen priorisiert werden. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt dabei auf dem Verhältnis zwischen den Rechten Gottes (ḥuqūq Allāh) und den Rechten des Dieners (ḥuqūq al-ʿabd) sowie dem Verhältnis zwischen den Rechten des Herrschers und denen des Volkes (ḥuqūq al-ḥākim wa-l-maḥkūm).
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Dedication
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Gegenstand und Ziel der Forschungsarbeit
- 2. Quellen und methodisches Vorgehen
- 3. Aufbau der Arbeit
- 4. Stand der Forschung
- 4.1 Recht und Pflicht in den klassischen uṣ ūl al-fiqh- Quellen
- 4.2 Recht und Pflicht in der modernen islamischen Literatur
- 4.3 Aspekte von Rechten und Pflichten in den kalām -Lehren
- II. Recht und Pflicht im Koran – exegetische Betrachtung
- 1. Das Konzept al-ḥ aqq im Koran: Die Konnotationen und Zusammenhänge
- 1.1 Das Konzept al-ḥ aqq in den mekkanischen Koranversen
- 1.2 Das Konzept al-ḥ aqq in den medinensischen Koranversen
- 2. Die Pflicht im Koran
- 2.1 Das Wort wāǧib im Koran
- 2.2 Das Wort farḍ im Koran
- 2.3 Das Wort kataba im Koran
- 2.4 Ausdrücke, die sich auf ‚Verpflichtung‘ beziehen
- 3. Rechte Gottes und Rechte des Menschen im Koran als Verpflichtungen und Untersagungen
- 3.1 Gleichheit vor dem Gesetz als Verpflichtung des Herrschers
- 3.2 Ungerechtigkeit ist verboten
- 4. Zwischenfazit
- III. Recht und Pflicht in den Hadith-Sammlungen
- 1. Das Konzept al-ḥ aqq in den sechs Hadith-Sammlungen
- 1.1 Das Konzept al-ḥ aqq im Kontext der Beziehung zwischen Allāh und dem Menschen
- 1.2 Das Konzept al-ḥ aqq im Kontext der Beziehung zwischen Herrscher und Volk
- 1.3 Das Konzept ḥ aqq im ethischen Kontext
- 1.4 Das Konzept ḥ aqq im Kontext ‚Familie‘
- 2. Rechte des Menschen in der Sunna als Verpflichtungen und Untersagungen
- 3. Zwischenfazit
- IV. Rechte und Pflichten unter Aspekten der kalām -Lehren bis zum Ende der Abbasidenzeit
- 1. Das Konzept al-ḥ aqq im Kontext des Streits um das Kalifat
- 2. Die Entstehung der kalām -Lehren und ihre Auswirkung auf Rechte und Pflichten
- 2.1 Die Schiiten
- 2.2 Die Ḫ āriǧiten
- 2.3 Die Ǧabriten
- 2.4 Die Qadariten
- 2.4.1 Der Aufstand von Ibn al-Ašʿaṯ
- 2.4.2 Ġaylān und der Aufstand Zayds
- 2.5 al-Murǧiʾa
- 2.6 Die Muʿtaziliten
- 2.6.1 al-Ḥ aqq und die fünf Prinzipien (al-uṣ ūl al-ḫ amsa)
- 2.6.1.1 Die Gerechtigkeit (al-ʿadl)
- 2.6.1.2 Die Stufe zwischen den beiden Stufen (al-manzila bayna l-manzilatayn)
- 2.6.1.3 Gottes Verheißung und Gottes Drohung (al-waʿd wa-l-waʿīd)
- 2.6.1.4 Das Gute gebieten und das Schlechte verwehren (al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿan al-munkar)
- 2.6.1.5 Die Einheit Gottes (at-tawḥ īd)
- 2.6.2 Die Haltung der Muʿtaziliten zu den ‚Rechten‘ in der Umayyadenzeit
- 2.6.2.1 ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz (gest. 101/720)
- 2.6.2.2 Yazīd
- 2.6.2.2 Die Zeit nach ʿUmar
- 2.6.3 Die Haltung der Muʿtaziliten zum Themenbereich ‚Recht‘ in der Abbasidenzeit
- 2.7 Ahl al-ḥ adīṯ und Ašʿariten
- 2.7.1 Die Haltung der ahl al-ḥ adīṯ und der Ašʿariten zu den Rechten und Pflichten während der Zeit der Abbasiden
- 2.7.1.1 Die Revolution von az-Zinǧ (reg. 255–270/869–883)
- 2.7.1.2 Die Qarmaṭ en (278/891–470/1077)
- 3. Zwischenfazit
- V. Recht und Pflicht in den uṣ ūl al-fiqh
- 1. Der Begriff al-ḥ aqq in den uṣ ūl al-fiqh
- 1.1 Die ersten Erwähnungen des Begriffs al-ḥ aqq
- 1.2 Die Rechte nach der Tradition der fuqahāʾ (ṭ arīqat al-fuqahāʾ )
- 1.3 Die Rechte nach der Tradition der Theologen (ṭ arīqat al-mutakallimīn /al-uṣ ūlīyīn )
- 1.4 Die Tradition des aš-Šāṭ ibī hinsichtlich der Rechte
- 1.5 Definition des Begriffs al-ḥ aqq in den neuzeitlichen uṣ ūl -Werken
- 2. Der Begriff ‚Pflicht‘ in den uṣ ūl al-fiqh
- 2.1 Die Bedeutung des Begriffs ‚Pflicht‘
- 2.2 Der Unterschied zwischen al-wāǧib und al-farḍ
- 3. Das Verhältnis zwischen dem Begriff ḥ aqq und verwandten Begrifflichkeiten
- 3.1 Das Verhältnis zwischen al-ḥ aqq und al-wāǧib
- 3.2 al-Ḥ aqq und al-mubāḥ
- 3.3 al-Ḥ aqq und ar-ruḫ ṣ a
- 3.4 al-Ḥ aqq und al-ḥ urrīya
- 3.5 al-Ḥ aqq und al-maṣ laḥ a
- 3.6 al-Ḥ aqq und al-ʿadl/al-qisṭ
- 3.7 al-Ḥ aqq und al-ḥ aqīqa
- 4. Fokussierung auf die Pflichten in den uṣ ūl al-fiqh
- 4.1 Die erste Hypothese
- 4.2 Die zweite Hypothese
- 4.3 Die dritte Hypothese
- 5. Wird den Rechten Gottes ein höherer Stellenwert beigemessen als den Rechten der Menschen?
- VI. Schlussbetrachtung
- 1. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
- 1.1 Die Ǧabriten
- 1.2 Die Qadariten
- 1.3 Die al-Murǧiʾa
- 1.4 Die Muʿtaziliten
- 1.5 Die Ahl al-Hadith und die Ašʿariten
- 1.6 Die Entwicklung des Konzepts des Rechts in den uṣ ūl al-fiqh und sein Verhältnis zu anderen verwandten Konzepten
- 2. Ausblick
- VII. Anhänge
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- VIII. Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
I. Einleitung
1. Gegenstand und Ziel der Forschungsarbeit
Das Konzept al-ḥaqq ist von großer Bedeutung, sowohl im Koran als auch in den Hadith-Sammlungen, was sich in der Betrachtung und Deutung facettenreich zeigt. Speziell am Beispiel des Diskurses der uṣūl-Gelehrten lässt sich dies nachvollziehen, insbesondere bei den ḥanafitischen Gelehrten, die das Konzept von al-ḥaqq unter dem Gesichtspunkt der ‚Rechtsnorm‘ (al-ḥukm) und der ‚Handlungen der islamrechtlich verantwortlichen Personen‘ (al-maḥkūm fīh) diskutieren. Unklar und facettenreich bleibt in dieser Diskussion jedoch, wie sich das Verhältnis zwischen al-ḥaqq und al-ḥukm genau definiert. Vielgestaltig ist daher auch die Überlegung, inwieweit sich in den Primärquellen die eigentliche Bedeutung des Konzeptes ‚Recht‘ widerspiegelt oder sich ggf. auf andere Konnotationen des Wortfeldes rund um al-ḥaqq bezogen wird. Im Laufe der Geschichte wurde vor allem dem Konzept ‚Pflicht‘ (wāǧib, farḍ) – als eine der fünf Rechtsnormen (al-aḥkām al-ḫamsa) – sowohl in al-fiqh als auch in den uṣūl al-fiqh ein größerer Stellenwert beigemessen als dem Konzept ‚Recht‘, welches sich in den klassischen fiqh- und uṣūl-Quellen kaum widerspiegelt. Dies hat einige Gelehrte zu der Äußerung bewogen, dass der Islam im Allgemeinen und das islamische Recht im Besonderen keine Rechte gewähre, sondern eine Religion der Verpflichtungen sei. Schacht schrieb in seinem Buch An Introduction to Islamic Law: „Islam in general, and Islamic law in particular, is a system of duties.“1 Kartal schrieb dazu: „Das islamische Konzept weist allerdings fast nur Pflichten auf, während das westliche sowohl Pflichten als auch Rechte enthält“.2 Siegman indes schrieb: „Actually, no such abstraction as ‚individual rights‘ could have existed in Islam.“3
Im Islam werden dabei oft die Rechte und Pflichten aus Sicht zweier entgegengesetzter Parteien definiert und bewertet: Gott und Menschen, Herrscher und Volk. Hieraus ergibt sich ein Machtgefälle, aus welchem sich die Vermutung ableiten ließ, dass den Rechten Gottes oder eines amtierenden Herrschers im islamischen Recht ein höherer Stellenwert beigemessen werden könnte als den Rechten der Menschen (etwa bei der Einhaltung von Menschenrechten). Daraus folgt die Überlegung, welche Rechte während eines Konfliktes, z. B. zur Manifestierung einer Machtposition (al-ḥākim), Vorrang haben werden.
Der Schwerpunkt der Auslegung des Rechts im Kontext der islamischen Geschichte ist bis heute auf ‚die Rechte des Herrschers (ḥuqūq al-imām/ḥuqūq al-ḥākim)‘ ausgerichtet. Diese gelten bis heute als unantastbare Rechte, denn damit direkt verbunden ist, dass der Herrscher als al-ḥākim – im Gegensatz zum Einzelnen – ein ‚legitimiertes‘ Gewaltmonopol innehat, damit er seine Rechte wahren kann. Beruht dies auf theologischen Grundlagen, oder spielen (macht-)politische Faktoren in diesem Zusammenhang die wichtigste Rolle? Hier setzt der Forschende mit seinen Forschungsfragen und seinen Betrachtungen um den theologischen und historischen Ursprung der Konzepte von Recht und Pflicht, ihren semantischen Entwicklungen, den sich bis in die heutige Zeit herleitenden Positionen der Herrscher und Völker und der damit eng verbundenen Einhaltung der Rechte der Menschen (des Volkes) an.
Diese Arbeit legt ihren Forschungsfokus dabei nicht auf einen direkten Vergleich des westlichen Verständnisses der Einhaltung von Menschenrechten4 im Gegensatz zum islamischen Verständnis der Rechte des Menschen. Der Forschungsschwerpunkt liegt vielmehr auf einer Untersuchung der Konzepte ḥaqq und wāǧib und den ihnen zu Grunde liegenden Konzepten und Auslegungen in den islamischen Quellen sowie deren direkten Auswirkungen und Einhaltungen der Rechte des Menschen in der klassischen Epoche.
Erkenntnisziele ergeben sich zunächst zur ursprünglichen Entstehung und Entwicklung der Konzepte al-ḥaqq und al-wāǧib, mit besonderer Fokussierung auf den Koran, die Hadith-Sammlungen sowie die klassische Epoche in der umayyadischen und abbasidischen Zeit5 und den uṣūl al-fiqh.
Es lässt sich konstatieren, dass dem Begriff ‚Pflicht‘ (wāǧib, farḍ) in den uṣūl al-fiqh ein größerer Stellenwert beigemessen wird, während das Konzept al-ḥaqq in diesen Quellen kaum zu finden ist. Wenn sich doch aber die Konzepte ḥaqq und wāǧib in einer wechselseitigen Beziehung befinden, wie es Thomas Perry, Dennis Lloyd, Samuel Stoljar und andere in ihren Ausführungen darlegen, sich sozusagen bedingen und somit zwei Seiten einer Medaille darstellen,6 warum verwendeten die uṣūl-Gelehrten dann nicht den Begriff ‚Recht‘ statt ‚Pflicht‘? Verbirgt sich hinter dieser Gewichtung eine gezielte und wirkmächtige Wortwahl, die den Anspruch auf ein (Menschen-)Recht konterkarieren könnte? Ein Erkenntnisgewinn ergibt sich auch zu den Auslegungen und Auswirkungen der Konzepte von ‚Recht‘ und ‚Pflicht‘ in der islamischen Geschichte im theologischen Kontext, gegebenenfalls verbunden mit einer Stärkung der Autorität des Herrschers und zu Lasten des Volkes.
Das Forschungsproblem kann demnach in den folgenden Fragen zusammengefasst werden:
- – Das Konzept al-ḥaqq ist von großer Bedeutung sowohl im Koran als auch in den Hadith-Sammlungen. Es stellt sich die Frage, ob es in den beiden Primärquellen grundlegend auf den Begriff ‚Recht‘ hinweist. Spiegelt sich in den Quellen die eigentliche Bedeutung des Begriffs ‚Recht‘ wider, oder bezieht es sich auf andere Konnotationen?
- – Warum wird dem Begriff ‚Pflicht‘ – als eine der fünf Rechtsnormen (al-aḥkām al-ḫamsa) – sowohl in al-fiqh als auch in uṣūl al-fiqh ein größerer Stellenwert beigemessen als dem Begriff ‚Recht‘?
- – Wird den Rechten Gottes in den uṣūl al-fiqh ein größerer Stellenwert beigemessen als den Rechten der Menschen?
- – Welche Vorstellung hatten die kalām-Gelehrten zu den Konzepten ‚Recht‘ und ‚Pflicht‘, und welche Rolle hatten ihre Vorstellungen und Haltungen auf die Einhaltung der Rechte des Volkes?
2. Quellen und methodisches Vorgehen
Grundsätzlich unterscheiden sich die Forschungsmethoden in der Koranexegese von den Forschungsmethoden etwa in den uṣūl al-fiqh oder der Glaubenslehre. Zunächst gehe ich auf die Forschungsmethoden im Kapitel Recht und Pflicht im Koran – exegetische Betrachtung ein. In diesem Kapitel verfolge ich einen komplexen Forschungsansatz, der aus der thematisch vergleichenden Koranexegese besteht.7 Die Methodik unterliegt folgender Vorgehensweise: Der erste Schritt besteht in der theoretischen Sammlung der Koranverse, in denen die Konzepte al-ḥaqq und al-wāǧib benannt werden. Daraufhin werden die Verse in mekkanische Koranverse und medinensische Koranverse aufgeteilt und in ihren jeweiligen Zusammenhängen erörtert. Hier legt der Forschende Wert auf eine vergleichende Analyse von drei klassischen Koranexegesen: den Tafsīr von aṭ-Ṭabarī (gest. 310/922) mit dem Titel Ǧāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān, den Tafsīr von az-Zamaḫšarī (gest. 538/1144) namens al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl und den Tafsīr von an-Naysābūrī (gest. 850/1446), der als Ġarāʾib al-Qurʾān wa-raġāʾib al-Furqān bekannt ist. Die Koranexegese im Tafsīr von aṭ-Ṭabarī gilt als eine der ältesten vollständig erhaltenen Exegesen. Alle späteren exegetischen Quellen haben sich auf aṭ-Ṭabarīs Tafsīr berufen. Darüber hinaus ist dieses Werk die wichtigste Quelle in der exegetischen Disziplin des at-tafsīr bi-l-maʾṯūr (‚die Erklärung auf Basis der Überlieferung‘).8 Die zweite Koranexegese, auf die sich gestützt wird, ist der Tafsīr von az-Zamaḫšarī. Diese Exegese ist eine der wichtigsten Quellen des at-tafsīr bi-r-raʾy (‚die Erklärung durch eigene Meinung bzw. eigene Interpretation‘).9 Sie ist zudem die wichtigste Exegese hinsichtlich der arabischen Sprachwissenschaften in Bezug auf Rhetorik und Flexion; ein Grund, weshalb sich alle späteren exegetischen Quellen auf sie berufen. Die arabischen Sprachwissenschaften spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Begriffe ḥaqq und wāǧib. Darüber hinaus konzentriert sich diese Exegese auf die theologische Lehre (ʿilm al-kalām), insbesondere auf die Lehre der Muʿtaziliten, zu denen sich az-Zamaḫšarī bekannte.10 Der Tafsīr von an-Naysābūrī stellt den Aspekt der asbāb an-nuzūl (‚Anlässe des Herabkommens‘, ‚Offenbarungsanlässe‘) in den Mittelpunkt, die zum Verständnis der Zusammenhänge der Begriffe ḥaqq und wāǧib beitragen könnten. Er kombiniert zudem zwei verschiedene Ansätze der Auslegung der koranischen Verse: at-tafsīr bi-l-maʾṯūr und at-tafsīr bi-r-raʾy.
Die Betrachtung der Hadith-Sammlungen erfolgt auf Grundlage derselben Forschungsmethode wie für den Koran. Es wird sich mit den sechs kanonischen Hadith-Sammlungen auseinandergesetzt, und zwar vor allem mit den zwei authentischen Werken Ṣaḥīḥ al-Buḫārī (256/870) und Ṣaḥīḥ Muslim (261/875), weil diese hinsichtlich ihrer Authentizität alle anderen Hadith-Sammlungen übertreffen.11 Darüber hinaus stütze ich mich an geeigneter Stelle auch auf die übrigen vier kanonischen Sammlungen (Kutub as-Sunan al-arbaʿa), und zwar auf Sunan Abū Dāwūd (275/889), Sunan at-Tirmiḏī (279/892), Sunan an-Nasāʾī (303/915) und Sunan Ibn Māǧa (273/886). Zudem dienen in dieser Forschung die Kutub as-Sunan al-arbaʿa als eine weitere Grundlage, denn sie sind nach den beiden Sammlungen von al-Buḫārī und Muslim diejenigen Sammlungen, die sich – trotz der in ihnen enthaltenen schwachen (ḍaʿīf) Hadithe – bewährt haben. Daher stehen sie – aus sunnitischer Sicht – an zweiter Stelle nach Ṣaḥīḥ al-Buḫārī und Ṣaḥīḥ Muslim.12
Im Kapitel Rechte und Pflichten unter Aspekten der kalām-Lehren bis zum Ende der Abbasidenzeit wird das Konzept al-ḥaqq erforscht. Der Forschungsrahmen umfasst hier die kalām-Lehren. Zum einem erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Konzept al-ḥaqq und seinem Einfluss auf die Entstehung der kalām-Lehren, zum anderem wird erforscht, wie die kalām-Gelehrten das Konzept al-ḥaqq hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Herrscher und dem Volk verstanden haben und welche Rolle dieses Verständnis hinsichtlich der Menschenrechtslage in den frühen Zeiten des Islam – also der Ära der Umayyaden und Abbasiden – eingenommen hat. Die Betrachtung stützt sich auf zwei Arten von Forschungsquellen: Die theologischen Quellen bzw. die Quellen von ʿilm al-kalām (maṣādir ʿilm al-kalām) und die historischen Quellen. Die Forschung basiert hierbei auf einer vergleichenden analytischen Methode, die beinhaltet, dass die unterschiedlichen Texte fundiert und auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen analysiert werden in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse.13 Hier werden die Ansichten unterschiedlicher kalām-Gelehrter aus den Rechtsschulen (Schiiten, Ḫāriǧiten, Muʿtaziliten, Ǧabriten, Qadariten, Ašʿariten usw.) zum Konzept ‚Recht‘ und ‚Pflicht‘ erforscht. Darüber hinaus wird sich auf die Auffassungen der jeweiligen Lehren aus ihren eigenen Quellen heraus bezogen. Als zweite Forschungsquelle in diesem Kapitel werden die historischen Quellen (al-maṣādir at-tārīḫīya) hinzugezogen und dabei die Einstellungen politischer und ideologischer Lehren zum Status der Menschenrechte in der Umayyaden- und Abbasidenzeit herausgearbeitet, ausgehend von den dort vorherrschenden Auffassungen der Konzepte ‚Recht‘ und ‚Pflicht‘ im Allgemeinen und im Kontext des Verhältnisses zwischen Herrscher und Volk im Besonderen. Da historische Erzählungen oft widersprüchlich sind, wird versucht, die Untersuchung – so weit wie möglich – auf historische Schnittpunkte (at-taqāṭuʿāt at-tārīḫīya) zu stützen. Zudem dienen die Ansichten der jeweiligen Lehre aus ihren eigenen historischen Quellen heraus als weitere Forschungsgrundlage (wie bei den Muʿtaziliten und Ašʿariten), soweit vorhanden.
Im Kapitel Recht und Pflicht in den uṣūl al-fiqh wird die Entwicklung des Konzeptes des Rechts sowohl nach der Tradition der fuqahāʾ bzw. der Ḥanafiten (ṭarīqat al-fuqahāʾ)14 als auch nach der Tradition der uṣūlīyūn – Mālikiten, Šāfiʿiten, Ḥanbaliten und Muʿtaziliten (ṭarīqat al-mutakallimīn)15 – erörtert. Zugleich wird zwischen den Rechten Gottes und den Rechten des Menschen verglichen und so verdeutlicht, wie die Rechtstheorie (naẓarīyat al-ḥaqq) in den uṣūl al-fiqh entstand und sich weiter geformt hat. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt auf die Definitionen des Konzeptes ḥaqq gelegt. Des Weiteren werden die Texte, in denen das Konzept des Rechts erwähnt wird, analysiert und die verschiedenen Ansichten der uṣūl-Gelehrten miteinander verglichen. Dabei werden die verschiedenen Begriffe in ihren Zusammenhängen erforscht, um so die vielfältigen Verwendungsweisen der Begriffe erklären und die historische und semantische Entwicklung der Konzeptionen verdeutlichen zu können.
3. Aufbau der Arbeit
Im Anschluss an dieses Einleitungskapitel folgen fünf aufeinander aufbauende Kapitel, in die nun kurz eingeführt wird:
Kapitel Ⅱ erörtert die Frage, ob das Konzept ḥaqq im Koran unter exegetischen Gesichtspunkten Hinweise auf das Konzept ‚Recht‘ enthält. Spiegelt sich die eigentliche Bedeutung des Konzeptes ‚Recht‘ hier wider oder bezieht sie sich auf andere Konnotationen? Dieses Kapitel gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil befasst sich mit dem Konzept al-ḥaqq und seinen Zusammenhängen in den mekkanischen und medinensischen Koranversen. Durch diese zwei Kategorien kann man erkennen, wie sich die Verwendung des Konzeptes al-ḥaqq im Laufe der Zeit entwickelt hat und inwieweit dieses Konzept mit der Konzeption von ‚Recht‘ bzw. ‚Menschenrechten‘ zusammenhängt. Der zweite Teil dieses Kapitels setzt sich mit dem Konzept wāǧib und den verwandten Konzepten wie farḍ und kataba im Koran auseinander. Der dritte Teil widmet sich den Rechten in den Koranversen hinsichtlich Verpflichtungen und Untersagungen. Hier wird die Herangehensweise des Korans an die Rechte Gottes und die Rechte des Menschen erläutert. So wird gezeigt, ob die Rechte im Allgemeinen als ḥuqūq im Koran benannt werden oder als Verpflichtungen und Untersagungen – wāǧibāt wa-muḥarramāt bzw. Rechtsnormen (aḥkām šarʿīya). Außerdem geht dieser Abschnitt der Frage nach, warum Rechte im Koran unter die al-aḥkām aš-šarʿīya subsumiert werden.
In Kapitel Ⅲ werden die Zusammenhänge des Konzepts al-ḥaqq in den Hadith-Sammlungen erörtert, um herauszufinden, ob es sich auch um eine Frage der Glaubenslehre – wie im Koran – handelt, oder es im Zusammenhang mit der Bedeutung von Rechten (Rechte Gottes und Rechte des Menschen) benutzt wird. Aus dieser Betrachtung lässt sich ableiten, ob den Rechten Gottes oder den Rechten eines Herrschers ein größerer Stellenwert beigemessen wird als den Rechten des Menschen bzw. den Rechten des Volks – oder ggf. auch umgekehrt. Im Anschluss daran werden einige Beispiele angeführt, in denen die Rechte des Menschen in der Sunna als Verpflichtungen und Untersagungen bezeichnet werden.
Kapitel Ⅳ trägt die Überschrift Rechte und Pflichten im Lichte der kalām-Lehren bis zum Ende der Abbasidenzeit. Nach dem Tod des Gesandten Allāhs erhielt das Konzept ḥaqq eine hohe Bedeutsamkeit, vor allem im Kontext der politischen und religiösen Debatte und insbesondere unter der Fragestellung, wer zu diesem Zeitpunkt al-ḥaqq (das Recht) auf das Kalifat innehatte. In diesem Kapitel wird erörtert, wie diese Debatte zur Entstehung der kalām-Lehren (die Schiiten, Ḫawāriǧ, Muʿtaziliten und Ašʿariten betreffend) beigetragen hat. Darüber hinaus setzt es sich mit der Thematik des Dualismus von Recht und Pflicht zwischen Herrscher und Volk in den kalām-Lehren auseinander und damit, wie sich die Rechte der Herrscher gegenüber dem Volk etablierten und als unantastbare Rechte aus theologischer Sicht betrachtet wurden.
Kapitel Ⅴ befasst sich mit dem Thema Recht und Pflicht in den uṣūl al-fiqh. Dieses Kapitel setzt sich mit den Entwicklungsphasen des Konzeptes von ḥaqq in den uṣūl al-fiqh, seinen Kontexten und dem Konzept ‚Pflicht‘ auseinander. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der Frage der Fokussierung auf die Pflichten in den uṣūl al-fiqh. Letztendlich wird erörtert, ob den Rechten Gottes ein größerer Stellenwert beigemessen wird als den Rechten der Menschen in den uṣūl al-fiqh.
4. Stand der Forschung
4.1 Recht und Pflicht in den klassischen uṣūl al-fiqh-Quellen
In den klassischen Quellen des fiqh und uṣūl al-fiqh wurde das Konzept al-ḥaqq oft in drei Gattungen eingeteilt: Der erste Bereich beschreibt das Recht Gottes (ḥaqq Allāh), z. B. die gottesdienstlichen Handlungen (ʿibādāt) und die vorgeschriebenen Strafen (ḥudūd). Diese Rechte sind unantastbar. Der zweite Bereich umfasst die Rechte des Menschen (ḥaqq al-ʿabd) wie z. B. das Recht auf Scheidung und das Sorgerecht (ḥaqq al-ḥaḍāna). Der dritte Bereich, in dem die gemeinsam gültigen Anteile der Rechte Gottes und des Menschen in ‚einem gemeinsamen Recht‘ (ḥaqq Allāh und ḥaqq al-ʿabd) zusammengefasst werden, enthält das Recht auf Vergeltung (al-qiṣāṣ) und die Strafe der falschen Bezichtigung der Unzucht (ḥadd al-qaḏf).16 Das Konzept ‚Pflicht‘ (al-wāǧib/al-farḍ) wurde hingegen sowohl in den fiqh-Werken, als auch in den uṣūl-Werken in den Vordergrund gestellt. Die uns heute bekannten Konzeptionen der gültigen Menschenrechte, wie z. B. das Recht auf Leben (ḥaqq al-ḥayāt) und auf Meinungsfreiheit, wurden in der klassischen Zeit von fiqh und uṣūl al-fiqh nicht deutlich benannt. Das Konzept ‚Pflicht‘ wurde hingegen in den uṣūl al-fiqh als eine der fünf grundlegenden Rechtsnormen (al-aḥkām al-ḫamsa) bestehend aus wāǧib, ḥarām, mustaḥabb, makrūh und mubāḥ erörtert. Hier ließe sich ein ausführliches Beispiel aus den Werken zum uṣūl von al-Bazdawī und as-Saraḫsī aufzeigen, in dem deutlich wird, wie die fuqahāʾ und uṣūl-Gelehrte sich mit dem Konzept al-ḥaqq in ihren klassischen Quellen auseinandergesetzt haben. Al-Bazdawī und as-Saraḫsī teilen das Konzept des Rechts in die Kategorie islamrechtlicher Normen (al-aḥkām aš-šarʿīya) ein, wobei die islamrechtlichen Normen sich in weitere vier Kategorien untergliedern:17 Die Rechte Gottes (ḥuqūq Allāh), die sich wiederum in verschiedene Subkategorien gliedern, wie z. B. die reinen Gottesdienste (ʿibādāt maḥḍa), hier unter anderem der Glaube, das Gebet, das Fasten usw., die reinen Strafen (ʿuqūbāt maḥḍa) wie z. B. die ḥadd-strafen (ḥadd az-zinā, ḥadd as-sariqa usw.). Die zweite Kategorie der Rechte bilden die Rechte des Menschen (ḥuqūq al-ʿabd), darunter z. B. die Schadensersatzleistung (ḥaqq taʿwīḍ aḍ-ḍarar). Die dritte Kategorie umfasst das gemeinsame Recht Gottes und des Menschen; das Recht Gottes nimmt dabei allerdings eine vorrangige Stellung ein, wie z. B. ḥadd al-qaḏf. Und die letzte Kategorie bildet ebenfalls das gemeinsame Recht Gottes und des Menschen, der Mensch nimmt hier allerdings eine vorrangige Stellung ein, wie z. B. im Bereich der Vergeltung (al-qiṣāṣ). Den klassischen Quellen ging es allerdings dabei nicht um die Definition und Regelung ethisch basierter Rechte des Menschen (nach heutigem Verständnis der Menschenrechte), sondern sie bezogen sich auf die damals wie heute gültigen Rechtsnormen bzgl. gottesdienstlichen Handlungen (ʿibādāt) sowie das Straf- und Zivilrecht (muʿāmalāt).
4.2 Recht und Pflicht in der modernen islamischen Literatur
Es gibt eine Fülle an aktuellen Werken, die das Thema Recht im Rahmen einer vollständigen Theorie diskutieren (naẓarīyat al-ḥaqq). Die meisten dieser Werke sind in arabischer Sprache verfasst und behandeln – wie das von Saʿd – Konzeption, Arten und Quellen des Rechts.18 Andere Arbeiten erörtern das Konzept der Verpflichtungen (al-iltizāmāt), seine Quellen und seine Grenzen, so z. B. Bik und Ibrāhīm.19 Al-Ḫūlī hingegen erörtert die Grundlagen von Recht und Pflicht als zwei gegensätzliche Konzepte.20 Allerdings wird im Laufe der Literaturrecherche deutlich, dass die modernen islamischen Beiträge die Inhalte der klassischen fiqh-Werke übernehmen.21 Darüber hinaus lässt sich konstatieren, dass in den neueren Werken die Entstehungsgeschichte, Entwicklung und das Verhältnis beider Konzepte vernachlässigt werden. Auch eine Auseinandersetzung mit den Gründen, die zur Fokussierung auf eines der Konzepte geführt haben, bleibt dabei aus. Zudem wird nicht dargestellt, warum in den drei o. g. Bereichen des Konzeptes al-ḥaqq die Menschenrechte (dem heutigen Verständnis nach) nicht dargestellt und subsumiert werden. Des Weiteren werden die Faktoren, die zur Konzentration auf ‚die Pflichten des Volkes gegenüber seinem Herrscher‘ geführt haben, vernachlässigt. Auch lässt sich ein Forschungsdesiderat feststellen in Bezug auf die Frage, warum den Rechten Gottes ein größerer Stellenwert beigemessen wird als den Rechten des Menschen. Ist der Islam demnach eine Religion der Pflichten, und erkennt er die Rechte des Menschen nicht an?
4.3 Aspekte von Rechten und Pflichten in den kalām-Lehren
Die Frage nach den Aspekten der Rechte und Pflichten in den kalām-Lehren zielt auf die Vorstellung der kalām-Gelehrten zum Konzept von ‚Recht und Pflicht‘ und darauf, welche Rolle ihre Vorstellungen und Haltungen bei der Einhaltung der Rechte des Volkes spielten. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand konnten sich bislang keine gesonderten und systematischen Studien zu dieser Thematik ermitteln lassen. Es wurde lediglich die Thematik der ‚Rechte und Pflichten des Volkes und der Herrscher‘ in verschiedenen Kontexten wie nachfolgend dargestellt behandelt. Hierzu beziehe ich mich auf drei relevante klassische Werke zu dieser Thematik, und zwar auf Ġiyāṯ al-umam fī l-tiyāṯ aẓ-ẓulam von al-Ǧuwaynī (gest. 478/1085),22 al-Aḥkām as-sulṭānīya wa-l-wilāyāt ad-dīnīya von al-Māwardī (gest. 450/1058)23 und al-Aḥkām as-sulṭānīya von Abū Yaʿlā l-Farrāʾ (gest. 458/1066).24 Hieraus ergibt sich mein zu Anfang benanntes Forschungsanliegen zur Klärung der Frage, warum die Rechte der Herrscher in der damaligen Zeit als unantastbare Rechte galten. Der Schwerpunkt der Auslegung ‚des Rechts‘ im Kontext der islamischen Geschichte wird bis heute auf ‚die Rechte des Herrschers (ḥuqūq al-imām/ḥuqūq al-ḥākim)‘ gelegt. Diese gelten unverändert als unantastbare Rechte, obwohl damit direkt verbunden ist, dass al-ḥākim – im Gegensatz zum Einzelnen – ein ‚legitimiertes‘ Gewaltmonopol innehat, um seine Rechte wahren zu können. Beruht dies auf Grundlagen des kalām, oder spielen (macht-)politische Faktoren in diesem Zusammenhang die wichtigere Rolle?
Details
- Pages
- 236
- Publication Year
- 2023
- ISBN (PDF)
- 9783631905968
- ISBN (ePUB)
- 9783631905975
- ISBN (Hardcover)
- 9783631905951
- DOI
- 10.3726/b21140
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (January)
- Keywords
- Recht Pflicht Menschenrechte Fiqh uṣūl al-fiqh Glaubenslehre Koranexegese Hadith-Sammlungen Rechte Gottes Rechte des Herrschers Ziele der Šarīʿa
- Published
- Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford, 2023. 236 S., 4 farb. Abb., 6 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG