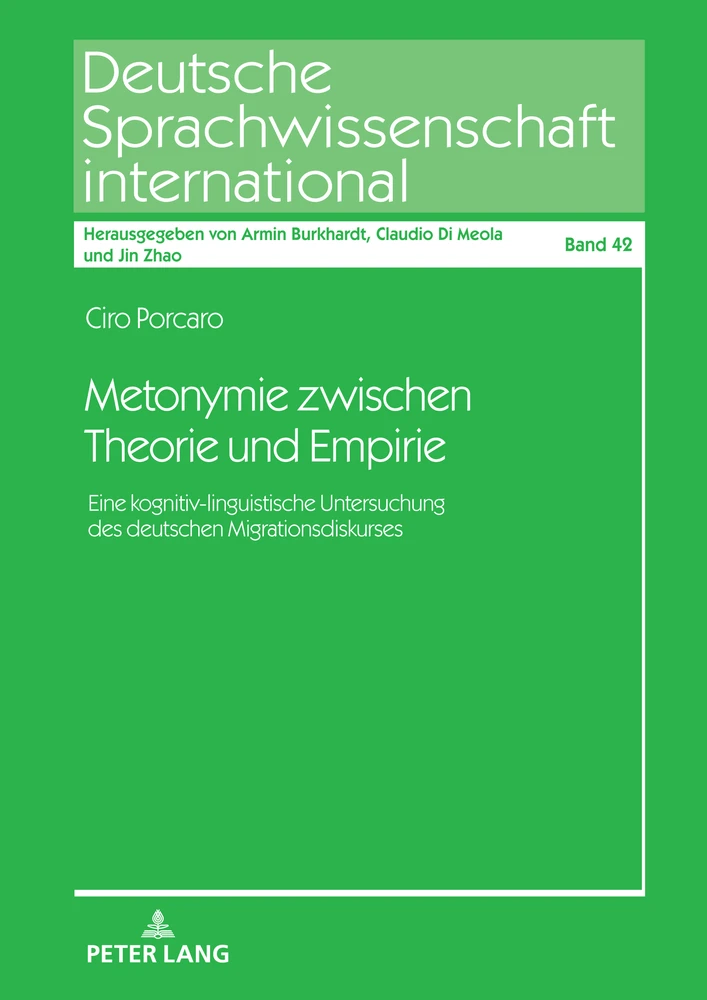Metonymie zwischen Theorie und Empirie
Eine kognitiv-linguistische Untersuchung des deutschen Migrationsdiskurses
Zusammenfassung
Die Arbeit verfolgt zwei Ziele. Zum einen sollen die sprachspezifischen Realisierungsarten der Metonymie im Deutschen dargelegt werden, dies mit Schwerpunkt auf Konversionsvorgängen und Komposita. Zum anderen soll untersucht werden, wie metonymische Phänomene wesentlich dazu beitragen, stereotype und antimigrantische Vorstellungen zu vermitteln.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- 1. Theorien der Metonymie
- 1.1 Vor-kognitivistische Auffassungen von Metonymie
- 1.2 Die Konzeption der Metonymie bei Lakoff und Johnson
- 1.2.1 Leben in Metaphern
- 1.2.2 Leben in Metonymien
- 1.2.3 Metonymische idealisierte kognitive Modelle nach Lakoff
- 1.3 Die Theorie der Metonymie von Radden und Kövecses
- 1.4 Sprechaktmetonymien nach Panther und Thornburg
- 1.5 Kontroverse Diskussionen um Metonymie
- 2. Metonymie und (deutsche) Wortbildung
- 2.1 Metonymie und englische Wortbildung in der Diskussion
- 2.2 Die Rolle der Metonymie bei deutschen Konversionsvorgängen
- 2.3 Die Rolle der Metonymie bei deutschen Komposita
- 3. Metonymie in der Sprachpraxis des Migrationsdiskurses
- 3.1 Von der Theorie zur Sprachpraxis
- 3.2 Metonymische Perspektivierung in ideologischen Diskursfragmenten
- 3.2.1 Stereotype
- 3.2.2 Stereotype Modelle der konzeptuellen Kategorie MIGRANTINNEN
- 3.2.3 KONZEPT-(A)-FÜR-KONZEPT-(B)- vs. FORM-KONZEPT-(A)-FÜR-KONZEPT-(B)-Metonymien
- 3.2.4 Vom Stereotyp zum Konzept: progressive kognitive Verfestigung
- 3.3 Metonymien und Metaphern des Migrationsdiskurses
- 3.3.1 Der Migrationsdiskurs
- 3.3.2 Konzeptuelle Metapher als Analysekategorie der Migrationsdiskurssemantik
- 3.3.3 Konzeptuelle Metonymie als Analysekategorie der Migrationsdiskurssemantik
- 4. Metonymien und Metaphern des deutschen Migrationsdiskurses: ein Vergleich zwischen Bild.de und Spiegel Online
- 4.1 Ausgangshypothesen, Methodik und Korpusauswahl
- 4.1.1 Presse und Migrationsdiskurs
- 4.1.2 Ausgangshypothesen und Analysemethoden
- 4.1.3 Korpusauswahl
- 4.2 Referentielle Metonymien von MigrantInnen im Bild-Korpus
- 4.2.1 Metonymische Ausdrücke im Überblick: Frames, Wortbildung, Belegzahlen
- 4.2.2 Migranten, Immigranten, Wirtschaftsmigranten, Armutsmigranten, Arbeitsmigranten und Klima-Migranten
- 4.2.3 Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, Klimaflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, Elendsflüchtlinge und Bootsflüchtlinge
- 4.2.4 Kolonisierte, Geschleuste, Schutzsuchende, Geflüchtete, Flüchtende, Einreisende, Eingereiste, Ankommende, Vertriebene und Illegale
- 4.2.5 Weitere referentielle Metonymien
- 4.3 Referentielle Metonymien von MigrantInnen im Spiegel-Korpus
- 4.3.1 Metonymische Ausdrücke im Überblick: Frames, Wortbildung, Belegzahlen
- 4.3.2 Migranten, Arbeitsmigranten, Erwerbsmigranten, Wirtschaftsmigranten, Bootsmigranten und Super-Migranten
- 4.3.3 Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge, Bootsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge und Bürgerkriegsflüchtlinge
- 4.3.4 Geflüchtete, Geflohene, Ausgebombte, Gefolterte, Erniedrigte, Schwächste und Unschuldige
- 4.4 Metonymische Modelle im Bild-Korpus und Spiegel-Korpus
- 4.4.1 GESCHLECHTERREFERENZ
- 4.4.2 MIGRATIONSREISE
- 4.5 Metaphern der Migration im Bild-Korpus und Spiegel-Korpus
- 4.5.1 Überblick und Belegzahlen
- 4.5.2 MIGRANTINNEN SIND GEGENSTÄNDE/WAREN
- 4.5.3 MIGRANTINNEN SIND WASSERMENGEN
- 4.5.4 MIGRANTINNEN SIND FEINDE/INVASOREN
- 4.5.5 MIGRANTINNEN SIND UNWILLKOMMENE GÄSTE
- 4.5.6 MIGRANTINNEN SIND TIERE
- 4.5.7 MIGRANTINNEN SIND DRUCKAUSÜBENDE ENTITÄTEN
- 5. Schlussbemerkung
- Literatur
- Anhang
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung einer Dissertation im Fach Deutsche Sprachwissenschaft, die im Rahmen des Internationalen Doktorats in Germanic and Slavic Studies der Universität Rom La Sapienza und der Charles University Prague entstanden ist.
Mein Dank gilt in erster Linie meinen beiden Betreuern Prof. Claudio Di Meola von der Universität Rom La Sapienza und Dr. Martin Šemelík von der Charles University Prague. Ihr uneingeschränkter Einsatz hat meine Arbeit in allen Phasen entscheidend weitergebracht.
Ferner habe ich den beiden externen GutachterInnen Prof. Marina Foschi und Prof. Joachim Gerdes für ihre wertvollen Hinweise zu danken.
In einem mündlichen und schriftlichen Austausch haben mir zudem Prof. Francisco Ibáñez Ruiz de Mendoza, Prof. Jeannette Littlemore, Prof. Laurie Bauer, Prof. Eva Berlage, Prof. Thomas Berg, Prof. Elena Semino und Prof. Rita Brdar-Szabó weitergeholfen.
Für eine aufmerksame und kritische Durchsicht des Manuskripts bin ich Prof. Daniela Puato dankbar.
Mein besonderer Dank geht an Prof. Günter Radden, der mir während meines Forschungssemesters an der Universität Hamburg unentwegt zur Seite gestanden hat.
Rom, im September 2024 Ciro Porcaro
Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle der Metonymie im Migrationsdiskurs, wobei vertiefend auf Wortbildungen wie Komposita und Konvertate eingegangen wird. Der theoretische Rahmen ist durch die sich an Lakoff und Johnson orientierende Kognitive Linguistik gegeben. Ein zentraler Teil der Arbeit ist eine qualitative und quantitative Korpusanalyse gegenwärtiger deutschsprachiger Pressetexte.
Die Metonymie steht seit jeher im Schatten der Metapher, die als prototypische Vertreterin bildhafter Sprache gilt. In den letzten Jahrzehnten allerdings hat das Interesse an der konzeptuellen Metonymie in der kognitionslinguistischen Forschung zugenommen. In ihrer wegbereitenden Arbeit von 1980 widmen Lakoff und Johnson der Metonymie noch wenig Raum und messen ihr eine zweitrangige Bedeutung bei: Metonymie wird summarisch beschrieben als Verwendung einer (konzeptuellen) Entität, um auf eine andere zu referieren, die mit ihr in Beziehung steht (Lakoff/Johnson 1980: 36).
Anschließend trägt Lakoff (1987) der Komplexität und Relevanz metonymischer Phänomene für die Verarbeitung sprachlicher Ausdrücke sowie für mentale Kategorisierungsprozesse stärker Rechnung, indem er den metonymischen Mappings eine grundlegende kognitive Strukturierungsfunktion zuschreibt. Metonymie wird hier zum ersten Mal als Basisprinzip erkannt, das zur Bildung kognitiver Modelle seitens der SprecherInnen fungiert.
Der erste Versuch, eine Theorie der konzeptuellen Metonymie zu formulieren – der zugleich den bisher umfassendsten und wichtigsten Beitrag zum Thema darstellt – geht auf Radden und Kövecses (Kövecses/Radden 1998, Radden/Kövecses 1999) zurück. Die beiden Autoren verstehen Metonymie als einen kognitiven Prozess, bei dem eine konzeptuelle Entität, das Vehikel (vehicle), zu einer anderen konzeptuellen Entität, dem Ziel (target), innerhalb desselben idealisierten kognitiven Modells mentalen Zugang bietet. Die Autoren erarbeiten darüber hinaus eine ausführliche Taxonomie der möglichen metonymischen Beziehungen, die potentiell Entitäten aus drei „ontologischen Bereichen“ (world of concepts, world of forms, world of things and events) umfasst.
Seit dem Erscheinen des theoretischen Vorschlags von Radden und Kövecses haben die Beiträge zum Thema „konzeptuelle Metonymie“ zugenommen. Die letzten zwanzig Jahre waren geprägt von Versuchen, das sprachlich-konzeptuelle Verständnis von metonymischen Phänomenen zu vertiefen (insbesondere Panther und Thornburg zu den sogenannten Sprechaktmetonymien) sowie zu einer einheitlichen Auffassung des Metonymiebegriffs zu gelangen (vgl. z.B. Benczes/Barcelona/Ruiz de Mendoza 2011). In den meisten dieser Beiträge kommt ein interpretativ-introspektives Analyseverfahren zur Anwendung. Diese Studien greifen nämlich fast immer auf bereits in der Literatur behandelte oder auf neue, selbstformulierte Beispiele zurück, um analytische bzw. theoretische Ergänzungen vorzunehmen oder Gegenargumente zu bereits vorhandenen Analysen zu liefern (so u.a. Barcelona 2002, Ruiz de Mendoza/Otal Campo 2002, Paradis 2004, Brdar 2007, Barcelona 2011, Ruiz de Mendoza 2014, Littlemore 2015, Denroche 2015, Wachowski 2019, Littlemore 2022). Weitere Arbeiten haben sich mit der Beziehung zwischen metonymischen Operationen und Wortbildung befasst (vgl. z.B. Brdar/Brdar-Szabó 2013a, Bauer 2016, 2017, Brdar 2017), wobei die Frage im Mittelpunkt stand, ob bestimmte Wortbildungsvorgänge (etwa die Konversion) das Operieren der Metonymie blockieren oder nicht.
Hervorzuheben ist, dass sich beinahe alle erschienenen theoretischen Beiträge zur konzeptuellen Metonymie darauf beschränken, metonymische Realisierungen innerhalb des englischen Sprachsystems zu untersuchen. Einschlägige Studien in diesem Themenbereich mit Fokus auf die Gegenstandssprache Deutsch sind sehr selten (Drößiger 2004, Spieß 2015, Hagemann 2017). In sprachvergleichenden Untersuchungen finden sich ebenfalls nur vereinzelte Beobachtungen zum Deutschen (Panther/Thornburg 2015, Brdar 2019, Brdar-Szabó 2021).
Neben rein kognitionstheoretischen Ansätzen zur Untersuchung bildhafter Sprache sind in den letzten Jahren vermehrt diskursanalytische Studien zu verzeichnen, die durch qualitative bzw. quantitative korpuslinguistische Zugänge gekennzeichnet sind und zunehmend auf kognitivistische Konstrukte und Analysemethoden zurückgreifen (vgl. Ziem 2013). Allerdings befassen sich diese Arbeiten in der Regel mit Metaphern, während Metonymien eine völlig untergeordnete Rolle spielen (vgl. z.B. Santa Ana 1999, 2002, Charteris-Black 2004, Musolff 2004, Hart 2010, 2011, Polajnar 2022).
Die beiden erwähnten Forschungsbereiche – der rein kognitionstheoretische und der diskursanalytische – können jedoch nicht als getrennt betrachtet werden. So widmet sich beispielsweise Littlemore (2015) sowohl der kritischen Diskussion allgemeiner theoretischer Modelle der Metonymie als auch der Analyse realer linguistischer Daten und ist somit in der Lage, die Rolle der Metonymie bei der Darstellung gesellschaftlicher Realitäten zu erhellen.
Das diskursive Feld, das am häufigsten in den einschlägigen Analysen betrachtet wurde, ist zweifelsohne der Migrationsdiskurs. Als integraler Bestandteil des politischen Diskurses war der Migrationsdiskurs bereits Gegenstand zahlreicher Studien im Bereich der Kritischen Diskursanalyse (KDA) (vgl. van Dijk 2017). Die KDA befasst sich im Wesentlichen mit sozialen Problemen und sieht sich als eine Form des politischen Engagements, die in der Aufdeckung von diskursiven Strategien besteht, die zur Schaffung und Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheiten bzw. zum Machtmissbrauch führen (vgl. Fairclough 1996, Wodak 1996, Richardson 2007 und van Dijk 2015). Derzeit erweist sich die KDA als ein breites, disziplinübergreifendes Feld, dessen theoretische Konstrukte und methodologische Instrumente aus unterschiedlichen Bereichen stammen (vor allem Soziolinguistik, Literatur, Semiotik, kognitive Psychologie, Recht, Geschichte). In den letzten Jahrzehnten hat das Forschungsparadigma der Kognitiven Linguistik zunehmend zur Bereicherung des kritisch-methodischen Apparats der KDA beigetragen (u.a. Hart/Lukeš 2007, Hart 2010, Ziem 2013). Bisher hat sich allerdings die Anwendung der Kognitiven Linguistik in der kritischen Diskursanalyse hauptsächlich auf die Theorie der konzeptuellen Metapher beschränkt (vgl. Santa Ana 2002, Charteris-Black 2006 und Musolff 2004, 2018, 2023). Beispiele für eine kognitiv ausgerichtete Diskursanalyse sind auch in der jüngeren deutschsprachigen Literatur zu finden, wobei das Augenmerk verstärkt auf den in den Migrationsdiskursfragmenten identifizierten metaphorischen Mappings liegt (Schwarz-Friesel 2015, Spieß 2017, Kalasznik 2018, Plötner 2018, Spieß 2018, Csatár/Majoros/Tóth 2019, Spieß 2019, Polajnar 2022 u.a.). Metonymische Phänomene werden auch in diesen Studien nur marginal behandelt oder gänzlich ausgeblendet.
Im Lichte dieser Forschungslücke wird in der vorliegenden Arbeit die Rolle metonymischer Phänomene in den im deutschen Migrationsdiskurs evozierten Konzeptualisierungen untersucht. Insbesondere soll der Schwerpunkt darauf liegen, wie metonymische Phänomene wesentlich dazu beitragen, stereotype bzw. antimigrantische Vorstellungen im Migrationsdiskurs zu vermitteln, die eine wesentliche Rolle bei Meinungsbildung und Propagandaaktionen spielen.
Im Einzelnen wird ein zweifaches Ziel verfolgt. Zum einen soll das Augenmerk auf einige sprachspezifische Realisierungsarten der Metonymie im Deutschen gelegt werden, wobei vorwiegend auf ihre Rolle bei Konversionsvorgängen und bei Komposita eingegangen wird. Zum anderen soll die Rolle der konzeptuellen Metonymie bei der Gestaltung der Narrative des deutschen Migrationsdiskurses untersucht werden. Im Mittelpunkt steht die Art und Weise, wie Metonymie zur Bildung von stereotypen bzw. diskriminierungsorientierten Vorstellungen der Kategorie MIGRANTINNEN beiträgt. Die vorliegende Arbeit stellt daher einen Schnittpunkt zwischen kognitionstheoretischer und angewandter bzw. diskursanalytischer Linguistik dar und ist somit interdisziplinär ausgerichtet.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. Im ersten Teil (Kapitel 1 und 2) liegt der Schwerpunkt auf den theoretischen Modellen der konzeptuellen Metonymie unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachsystems. Der zweite Teil (Kapitel 3 und 4) widmet sich dem deutschen Migrationsdiskurs und befasst sich mit den relevantesten ideologischen und sprachpragmatischen – in der Literatur bisher vernachlässigten – Implikationen der Phänomene metonymischer Natur, wobei die Korpusuntersuchung von Migrationsdiskursausschnitten aus Bild.de und Spiegel Online von zentraler Relevanz ist.
Das erste Kapitel dient der Einführung in die Grundannahmen und Basiskonstrukte der maßgeblichen theoretischen Vorschläge zur konzeptuellen Metonymie, die allesamt für das Englische erarbeitet wurden. Nach einer kurzen Übersicht über die vor-kognitivistischen Auffassungen von Metonymie (1.1) werden die verschiedenen theoretischen Modelle zur konzeptuellen Metonymie unter Einbeziehung des Deutschen kritisch beleuchtet: Lakoff und Johnson (1.2), Radden und Kövecses (1.3), Panther und Thornburg (1.4). Ein Überblick über kontrovers diskutierte Punkte rundet das Bild ab (1.5).
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Metonymie und Wortbildung in der deutschen Sprache, insbesondere Konversionsvorgänge und Komposita. Nach einer Einleitung zur englisch orientierten Literatur (2.1) werden zunächst die sprachspezifischen Wechselwirkungen zwischen Wortbildungsvorgängen und Metonymie bei deutschen konvertierten Verben herausgestellt und als Interpretationsmodell ein Kontinuum von mehr oder weniger prototypischen Instanzen postuliert (2.2). Sodann werden die wichtigsten Interaktionen zwischen Metapher und Metonymie bei deutschen Komposita herausgearbeitet, wobei eine neue konzeptuell-semantische Klassifikation vorgeschlagen wird (2.3).
Das dritte Kapitel zielt in erster Linie darauf ab, die ideologischen und sprachpragmatischen Implikationen der Metonymie im Migrationsdiskurs kritisch zu beleuchten. Zunächst wird der aktuelle Forschungsstand der kognitiv ausgerichteten Diskursanalyse kritisch reflektiert (3.1). Anschließend wird eine theoretische Formalisierung erarbeitet, die darauf abzielt, zu einem besseren Verständnis der Rolle der Metonymie bei der Gestaltung stereotyper Modelle beizutragen, wobei besonderes Augenmerk auf die Beziehung zwischen Quell- und Zielbereich bei bestimmten Metonymien gelegt wird (3.2). Danach werden konzeptuelle Metapher und konzeptuelle Metonymie als Analysekategorien vertieft (3.3).
Im vierten Kapitel wird schließlich eine kognitiv orientierte Diskursanalyse zweier Migrationsdiskursausschnitte durchgeführt. Diese stammen jeweils aus den Online-Versionen der Tageszeitung Bild und des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Die Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf die in den Artikeln aufgerufenen Konzeptualisierungen der Kategorie MIGRANTINNEN. Nach einigen einleitenden Betrachtungen zur Methodik und Korpusauswahl (4.1) widmet sich die Korpusuntersuchung den identifizierten referentiellen Metonymien, die zu stereotypen Konzeptualisierungen der Kategorie MIGRANTINNEN beitragen (4.2 für Bild, 4.3 für Spiegel). Es handelt sich in erster Linie um Bezeichnungen wie Migranten und Flüchtlinge (mit den jeweiligen Komposita), aber auch um deverbale Benennungen wie beispielsweise Geflüchtete und Geschleuste bzw. Flüchtende und Ankommende. Danach werden die wichtigsten metonymischen Modelle näher unter die Lupe genommen (4.4): INDIVIDUEN EINES GESCHLECHTES FÜR INDIVIDUEN BEIDER GESCHLECHTER (das aktiv zur Unterrepräsentation der Untergruppe FRAUEN MIT MIGRATIONSGESCHICHTE beiträgt) sowie PHASE DER MIGRATIONSREISE FÜR DIE GESAMTE MIGRATIONSREISE (das eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Proximierungsstrategien spielt, d.h. bei der Konzeptualisierung von MIGRANTINNEN als sich bedrohlich nähernde Entitäten). Im letzten Teil des Kapitels werden schließlich die Interaktionen zwischen metonymischen und metaphorischen Mappings untersucht, die das Entstehen stereotyper Vorstellungen fördern (4.5): MIGRANTINNEN werden als GEGEGNSTÄNDE/WAREN, WASSERMENGEN, FEINDE/INVASOREN, UNWILLKOMMENE GÄSTE, TIERE und DRUCKAUSÜBENDE ENTITÄTEN konzeptualisiert.
Details
- Seiten
- 296
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631919835
- ISBN (ePUB)
- 9783631919842
- ISBN (Hardcover)
- 9783631919828
- DOI
- 10.3726/b21892
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Oktober)
- Schlagworte
- Stereotype Korpuslinguistik Pressesprache Komposition Konversion Wortbildung Migrationsdiskurs Metapher Metonymie Diskursanalyse Kognitive Linguistik
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 296 S., 12 s/w Abb., 8 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG