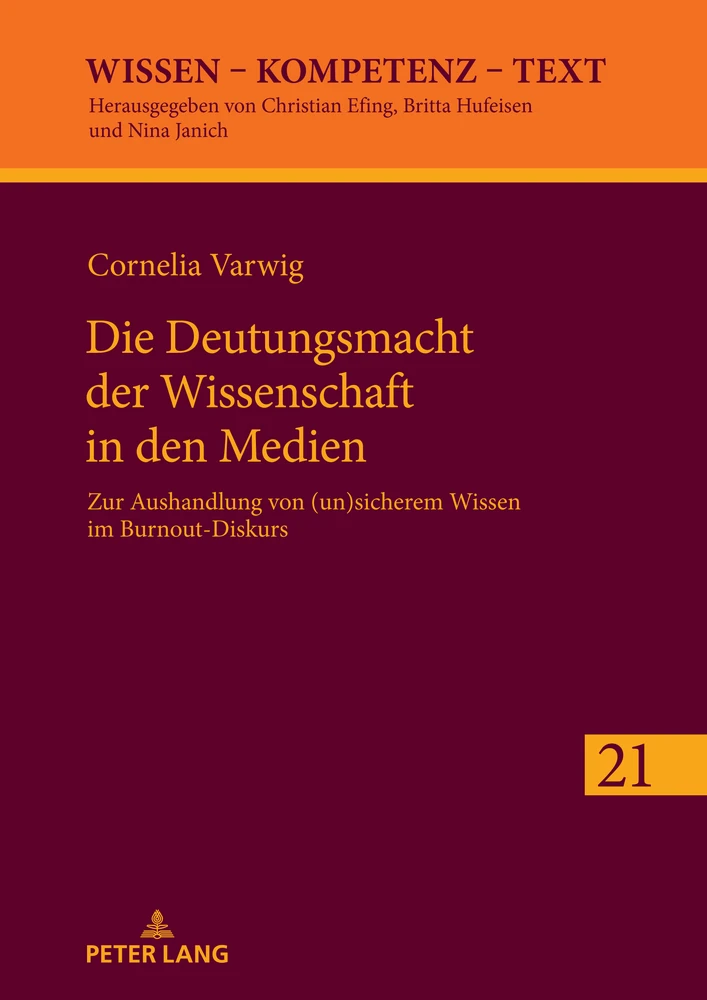Die Deutungsmacht der Wissenschaft in den Medien
Zur Aushandlung von (un)sicherem Wissen im Burnout‐Diskurs
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 1.1 Die (vermeintliche) Akzeptanzkrise der Wissenschaft
- 1.2 Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen
- 1.3 Burnout als Untersuchungsgegenstand
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2 Relevante Aspekte der Diskurs- und Journalismusforschung
- 2.1 Diskurs – linguistisch und wissenssoziologisch
- 2.2 Mediendiskurse
- 2.2.1 Die Medienvergessenheit der Diskursanalyse
- 2.2.2 Medien in der linguistischen und wissenssoziologischen Diskursanalyse
- 2.2.3 Diskursanalyse als Bereicherung der Medien- und Kommunikationswissenschaft
- 2.2.4 Kommunikationswissenschaftliche Konzepte für die Mediendiskursanalyse
- 2.3 Wissen und epistemische Unsicherheit in (Medien-)Diskursen
- 2.3.1 Merkmale von Wissen
- 2.3.2 Die Unsicherheit von Wissen
- 2.4 Akteur:innen in Mediendiskursen
- 2.4.1 Akteur:innen in der linguistischen Diskursanalyse
- 2.4.2 Akteur:innen in der wissenssoziologischen Diskursanalyse
- 2.4.3 Deutungsmacht und Rollen journalistischer und extramedialer Akteur:innen
- 3 Medizinisches Wissen und Burnout im Fachdiskurs
- 3.1 Krankheitsbegriffe und die Unsicherheit medizinischen Wissens in Forschung und Praxis
- 3.2 Burnout in der psychologischen und medizinischen Forschung
- 3.2.1 Begriffsbestimmung und Definitionen
- 3.2.2 Krankheitsstatus, Klassifikation und Kritik
- 4 Methode und Korpus
- 4.1 Methodisches Vorgehen
- 4.1.1 Qualitativ und quantitativ
- 4.1.2 Hauptsächlich induktiv, kaum deduktiv
- 4.1.3 Erst intratextuell, dann transtextuell
- 4.1.4 Textbasiert und aussagenbasiert
- 4.1.5 Mehr deskriptiv als kritisch
- 4.2 Kategorien für Diskurskontext und -struktur
- 4.2.1 Ressortverteilung
- 4.2.2 Journalistische Darstellungsformen
- 4.2.3 Anlässe der Berichterstattung
- 4.2.4 Stellenwert des Themas
- 4.3 Kategorien der Wissensanalyse
- 4.3.1 Wortorientierte Analyseebene
- 4.3.2 Text- und diskursorientierte Analyse
- 4.4 Kategorien der Akteursanalyse
- 4.4.1 Quantitätsorientierte Analyse
- 4.4.2 Qualitätsorientierte Analyse
- 4.5 Das Korpus
- 4.6 Gütekriterien
- 5 Empirische Ergebnisse
- 5.1 Diskurskontext und Charakteristika der Berichterstattung
- 5.1.1 Ressortverteilung
- 5.1.2 Journalistische Darstellungsformen
- 5.1.3 Anlässe der Berichterstattung
- 5.1.4 Stellenwert des Themas Burnout
- 5.2 Ergebnisse der Wissensanalyse
- 5.2.1 Diskurspositionen
- 5.2.2 Wissenskonstituierung im Pro-Burnout-Diskursstrang
- 5.2.3 Wissenskonstituierung im Kontra-Burnout-Diskursstrang
- 5.2.4 Zusammenfassung
- 5.2.5 Epistemische Unsicherheit im Burnout-Diskurs
- 5.3 Ergebnisse der Akteursanalyse
- 5.3.1 Akteursgruppen und Akteursordnung
- 5.3.2 Wissenschaftliche Akteur:innen
- 5.3.3 Ärzt:innen und Therapeut:innen
- 5.3.4 Burnout-Betroffene
- 5.3.5 Andere Akteur:innen: Politik, Krankenkassen, Wirtschaft, Medien
- 5.3.6 Journalist:innen als Diskursteilnehmer:innen
- 5.3.7 Zusammenfassung
- 5.4 Zusammenführung ausgewählter Ergebnisse
- 5.4.1 Wissenschaft und epistemische Unsicherheit
- 5.4.2 Journalist:innen und epistemische Unsicherheit
- 5.4.3 Zusammenfassung
- 6 Schlussbetrachtung
- 6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.2 Methodenreflexion
- 6.3 Betrachtung des Diskurses unter Gesichtspunkten der journalistischen Qualität
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Übersicht Korpustexte
Vorwort
Es gibt unbestritten Vor- und Nachteile, wenn man aus einem Berufsfeld heraus in dessen Erforschung eintritt. Ich habe meine Erfahrung als Journalistin und Redakteurin überwiegend als bereichernd für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Thema empfunden, weil theoretische Konzepte durch Kenntnisse aus der Praxis ergänzt und bestimmte journalistische Praktiken besser eingeordnet werden konnten. Die Erkenntnis, dass es eine vollends perspektivfreie, objektive Analyse ohnehin nicht geben kann, und das daraus erwachsene Mandat der Diskursforschung, die eigene Position zu reflektieren und transparent zu machen, wirken der Gefahr einer mangelnden kritischen Distanz ein stückweit entgegen. Vielmehr hat mir ein anfänglicher Abstand zum Forschungsfeld ermöglicht, unbefangen und unbeeindruckt von teils ideologisch aufgeladenen Disziplingrenzen auf jene Theorien und Methoden zuzugreifen, die für die Untersuchung am besten geeignet schienen.
Nun gilt es, den wichtigsten Wegbegleiter:innen für ihre Unterstützung zu danken: Allen voran meinem Erstbetreuer Prof. Dr. Carsten Könneker, der mich überhaupt zur Promotion angeregt hat, mir fortwährend beratend zur Seite stand und mir vor allem den Freiraum zur Entwicklung meines eigenen Themas gegeben hat, das mich nach wie vor beschäftigt und begeistert. Ein ebenso großer Dank gebührt meiner Zweitbetreuerin Prof. Dr. Nina Janich, die auf so kluge und behutsame Weise geholfen hat, in den entscheidenden Momenten die Weichen richtig zu stellen, und damit erheblich zum Gelingen der Arbeit beigetragen hat. Unsere Dreiertreffen werden mir in sehr guter Erinnerung bleiben.
Ein großer Dank geht zudem an meine beiden (Diss-)Freundinnen Paulina Dobroć und Alexandra Núñez für den bereichernden Austausch – fachlich und persönlich –, die emotionale Stütze und die gegenseitige Motivation. Auch meinen ehemaligen Kolleg:innen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) danke ich sehr für fruchtbare Diskussionen und hilfreiche Anregungen. Ein besonderer Dank geht darüber hinaus an Karl Marx für seine Grafikarbeiten.
Schließlich möchte ich meiner Familie und meinen Freund:innen von Herzen Danke sagen. Sie haben zum einen viel Nachsicht walten lassen und zum anderen – ganz im Sinne einer guten Burnout-Prävention – für eine gesunde Work-Life-Balance gesorgt.
1 Einleitung
1.1 Die (vermeintliche) Akzeptanzkrise der Wissenschaft
Der tatsächliche Wert der Wissenschaft für die Gesellschaft, die Abwertung ihrer Expertise und die Feststellung ihrer Abwertung sind drei unterschiedliche Sachverhalte. Zwar lässt sich der Wert oder auch Nutzen der Wissenschaft für die Gesellschaft pauschal nicht messen, und es kommt auch immer auf die jeweilige wissenschaftliche Disziplin, den Ort und die Zeit an, die man betrachtet, doch lässt sich mit einigen Beispielen leicht belegen, dass die Wissenschaft den Menschen zu erheblichen Fortschritten verholfen hat1, seien es nun technologische oder medizinische, wie etwa Mäder/Schnurr (2020: VIII f.) sie in aller Kürze herausstellen:
„Dank der modernen Medizin sank die Kindersterblichkeit enorm, Antibiotika haben unzählige Menschenleben gerettet, verheerende Seuchen wurden eingedämmt oder – wie im Falle der Pocken – gänzlich ausgerottet.“
Als Merkmale der Wissensgesellschaft werden sogar die „Durchdringung aller Lebens- und Handlungsbereiche mit wissenschaftlichem Wissen (Verwissenschaftlichung)“ und die „Verdrängung anderer Wissensformen durch wissenschaftliches Wissen“ genannt (vgl. Weingart 2001: 12). Zudem gehören Wissenschaftler:innen laut der Analyse von Nölleke (2013: 347) immer noch zu den am häufigsten eingesetzten Expert:innen in den Medien. Und auch in der Politikberatung werden für viele Themen mit Wissenschaftler:innen besetzte Enquete-Kommissionen und Expertenräte eingesetzt.
Die Fragen nach der tatsächlichen und der wahrgenommenen Abwertung von wissenschaftlicher Expertise sind schwerer zu beantworten. Spätestens seit den 1980er-Jahren, seit Beck die „Risikogesellschaft“ (1986) beschrieben hat, wird wiederkehrend mit unterschiedlichen Worten eine „Havarie der Expertenkultur“ (Nölleke 2013: 23) konstatiert oder beklagt (zur gesellschaftlichen Bewertung von Wissenschaft siehe Kapitel 2.4.3.2). Barlösius/Ruffing (2021: 113) beschreiben das als Phasen, „in denen solche Infragestellungen weniger zu beobachten sind“ und andere, „in denen der Streit über die Bedeutsamkeit und Verlässlichkeit von wissenschaftlichem Wissen und wissenschaftlicher Expertise hochkocht“. Dann stellen auch sie die Diagnose, dass sich „viele Gegenwartsgesellschaften, speziell solche, die sich als ‚Wissensgesellschaften‘ bezeichnen lassen, […] seit einigen Jahren in einer solchen heißen Ära [befinden]“ (Barlösius/Ruffing 2021: 113). Und tatsächlich ist während der Coronapandemie bei vielen nicht nur der Eindruck entstanden, dass wissenschaftliche Erkenntnisse marginalisiert, angezweifelt oder bestritten wird, es gab nachweislich persönliche Anfeindungen und Bedrohungen von Wissenschaftler:innen, die weit über eine (mitunter durchaus berechtigte) Wissenschaftskritik hinausgehen und unter anderem zur Einrichtung der Kommunikations- und Rechtsberatung „Scicomm Support“2 geführt haben, bei dem Forscher:innen bei Angriffen Unterstützung erhalten können.
Zur gleichen Zeit zeigte allerdings das Wissenschaftsbarometer3, eine repräsentative Befragung, die die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Wissenschaft und Forschung erhebt, in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ein gleichbleibend hohes Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft. Als Grund für das Vertrauen wurde am häufigsten (2022: 67 Prozent) die wahrgenommene Expertise der Forschenden genannt. Sind also die anti-wissen- schaftlichen Stimmen in den sozialen Medien einfach nur besonders laut? Oder verliert die Wissenschaft tatsächlich – sogar bei speziellen Themengebieten wie der Epidemiologie und Virologie – ihre Wissensautorität, ihr „Monopol auf relevantes, ,richtiges‘ Wissen“ (Nölleke 2013: 28) – insbesondere, und das ist hier die entscheidende Frage, „im Zuge enttäuschter Gewissheitserwartungen“ (ebd.)?4 Angesichts vieler offener Fragen und widersprüchlicher Aussagen gepaart mit einem deutlich wahrnehmbaren Wissenschaftsskeptizismus und einer Konjunktur „alternativer Fakten“ (vgl. Quattrociocchi 2018) ist die Problemlage im Zusammenhang mit der Coronapandemie besonders sichtbar geworden. Doch auch schon früher und bei anderen Themen hat sich die Frage gestellt, ob die Unsicherheit von wissenschaftlichem Wissen – sei es in Form von Vorläufigkeit, Widersprüchlichkeit, Lückenhaftigkeit oder dergleichen –, zu einer Schwächung wissenschaftlicher Positionen führt. In einige Studien wurde insbesondere das Vertrauen in die Wissenschaft und ihre Glaubwürdigkeit untersucht – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Eine Arbeit von Retzbach/Maier (2015) hat ergeben, dass die Thematisierung von Unsicherheit keine nachteilige Wirkung auf das Vertrauen in Wissenschaftler:innen hat. Einige neuere Studien zeigen sogar, dass das Vertrauen in die Wissenschaft wächst und diese glaubwürdiger wirkt, wenn Unsicherheit kommuniziert wird (Altenmüller et al. 2021; Janssen/Jucks 2023; Ratcliff/Wicke 2023). Auf der anderen Seite ergab eine Studie von Hendriks/Jucks (2020) wenige Hinweise darauf, dass die Einführung von Unsicherheit in Medienbeiträgen das Vertrauen verringert. Maier et al. (2018) haben gezeigt, dass sich manche Rezipient:innen eine explizite Darstellung von wissenschaftlicher Ungesicherheit wünschen, da sie diese als wesentliche Information über den Forschungsprozess interpretieren. Andere wiederum empfinden solche Informationen als unwissenschaftlich und denken, dass sie die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftler:innen und Journalist:innen reduzieren (vgl. Maier et al. 2016). Gustafson/Rice (2020) haben herausgearbeitet, dass die Art der Unsicherheit eine Rolle spielt: So hatten Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte eher einen negativen Effekt, führten also etwa zu einer verringerten Glaubwürdigkeit, während quantifizierte Fehlerwahrscheinlichkeiten keine negativen Auswirkungen hatten. Vor diesem Hintergrund ergibt sich das im folgenden Abschnitt dargestellte konkrete Erkenntnisinteresse dieser Arbeit mit den sich daraus ergebenden Forschungsfragen.
1.2 Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen
Zwar lässt sich am Beispiel der Coronapandemie die Problemstellung besonders deutlich erkennen und ihre Relevanz und Aktualität herausstellen, die Frage nach der (tatsächlich oder vermeintlich) schwindenden Wissensautorität ist aber, wie angesprochen, schon älter und betrifft die Wissenschaft ganz allgemein bzw. viele andere Wissenschaftsgebiete gleichermaßen (man denke beispielsweise auch an Klimaskeptiker:innen, die hier aber ebenfalls nicht das Thema sind). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Medizin- bzw. Gesundheitsthema, dem Phänomen Burnout, von dem es innerhalb der Wissenschaft kein einheitliches Verständnis gibt und das zugleich über viele Jahre eine hohe Präsenz in den journalistischen Medien hatte (vgl. Kap. 1.3 und 3.2). Anders als in den genannten Studien geht es in dieser Untersuchung nicht um Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsmessungen (rezeptionsbezogen), sondern um die Verarbeitung wissenschaftlicher Unsicherheit im journalistischen Diskurs (produktbezogen) und die Frage, ob damit eine Schwächung der wissenschaftlichen Deutungsmacht einhergeht. Um diesen Themenkomplex zu bearbeiten, wird er in mehrere Teilthemen heruntergebrochen (Wissen, Akteur:innen, Medien), die der Arbeit im Wesentlichen auch ihre Struktur geben (Kap. 1.4).
Im Wissenskomplex geht es darum herauszuarbeiten, wie Journalist:innen angesichts der diffusen wissenschaftlichen Sachlage Burnout darstellen und sich damit auch an der Wissenskonstituierung des Phänomens beteiligen. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Erkenntnis, dass epistemische Unsicherheit in journalistischen Texten häufig unterrepräsentiert ist (vgl. Kap. 2.3.2), wird zudem die Hypothese aufgestellt, dass ihre Thematisierung mit bestimmten diskursiven Funktionen verbunden ist. Konkret ergeben sich daraus folgende Forschungsfragen:
- 1. Wie und mit welchen sprachlichen Mitteln wird Wissen über Burnout im journalistischen Diskurs konstituiert?
- 2. In welchem Umfang wird auf die epistemische Unsicherheit des Burnout-Begriffs und -Konzepts Bezug genommen?
- 3. Wie wird epistemische Unsicherheit (in der vorliegenden Arbeit ist fast immer wissenschaftliche Unsicherheit gemeint) konstituiert?
- 4. Erfüllt die Thematisierung von epistemischer Unsicherheit diskursiv-kom- munikative Funktionen und wenn ja, welche?
Üblicherweise gelten wissenschaftliche Akteur:innen als Wissensautoritäten und zählen zu häufig genannten und zitierten Expert:innen in den Medien (vgl. Nölleke 2013). Im Akteurskomplex geht es darum herauszuarbeiten, ob ihnen diese privilegierte Stellung auch im journalistischen Burnout-Diskurs zugeschrieben wird oder ob die häufig geäußerte Hypothese bzw. Behauptung oder auch Befürchtung zutrifft, dass Wissenschaftler:innen im öffentlichen Diskurs an Deutungsmacht verlieren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich Journalist:innen nicht nur auf wissenschaftliche, sondern auch auf nicht- wissenschaftliche Quellen berufen, wodurch es zu einer direkten Konfrontation diverser und teils inkompatibler Wissensvorräte kommen kann (vgl. Busch 2015: 374–377). Konkret wird beantwortet:
- Inwieweit wird im journalistischen Burnout-Diskurs Bezug auf wissenschaftliche Akteur:innen genommen (individuell, kollektiv, institutionell)?
- 2. Wie werden wissenschaftliche Akteur:innen konstituiert und welche Rollen werden ihnen zugeschrieben?
- 3. Gibt es negative Darstellungen, die auf eine Schwächung der Deutungsmacht hinweisen?
- 4. Wie stehen wissenschaftliche Akteur:innen im Deutungsmachtverhältnis zu nicht-wissenschaftlichen Akteur:innen?
Um die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit zu beantworten, werden Wissens- und Akteurskomplex gemeinsam betrachtet und ausgewählte Ergebnisse in einer Kreuzanalyse ausgewertet. Die Forschungsfragen lauten:
- 1. Welche Akteursgruppen beschäftigen sich im Diskursausschnitt mit der Unsicherheit des Burnout-Wissens?
- 2. Wie gehen am Diskurs teilnehmende Wissenschaftler:innen mit der wissenschaftlichen Unsicherheit um?
- 3. Trägt die Unsicherheit des Burnout-Wissens zu einer Schwächung der wissenschaftlichen Deutungsmacht bei?
Zusätzlich wird in dieser Arbeit ein besonderes Augenmerk auf den journalistischen Diskurskontext gerichtet, denn dieser – so wird in der vorliegenden Arbeit argumentiert (Kap. 2.2) – hat einen erheblichen Einfluss auf den Diskursverlauf. So haben Journalist:innen etwa die Wahl zwischen wissenschaftlichen Expert:innen, die Burnout für eine eigenständige Krankheitsentität halten, und solchen, die Burnout für etwas anderes halten. Durch die journalistische Entscheidung kann gesteuert werden, in welche Richtung die Themenentfaltung stattfindet. Zudem weist unter anderem Busch (2015: 372) darauf hin, dass „auf dem Weg aus der fachlichen in die massenmediale Sphäre“ eine „laienorientierte Verschiebung“ stattfindet, das heißt, Journalist:innen wählen auch aus, welche Aspekte eines wissenschaftlich-medizinischen Konzepts (Selektion) sie wie (Darstellung) in ihren Beiträgen transportieren. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen:
- 1. Welche Anzeichen lassen sich innerhalb der untersuchten Beiträge für journalistische Praktiken wie Selektion und Darstellung finden?
- 2. Inwiefern sind Journalist:innen als Diskursteilnehmer:innen involviert und welche Rollen nehmen sie in den Beiträgen ein?
- 3. Inwieweit lassen sich Ergebnisse aus dem Wissens- und Akteurskomplex auf den journalistischen Diskurskontext beziehen und dadurch erklären?
1.3 Burnout als Untersuchungsgegenstand
Medizin und Gesundheit gehören zu den wichtigsten Themenfeldern der (wissenschafts-)journalistischen Berichterstattung, denn medizinische Informationen haben oft eine unmittelbare Bedeutung für Rezipient:innen (vgl. Ruhrmann et al. 2016b: 25). Als gesundheitsbezogenes Phänomen hat Burnout als Thema also grundsätzlich eine gewisse Relevanz und es eignet sich aus mehreren Gründen besonders gut als Untersuchungsgegenstand für das Forschungsvorhaben. Es handelt sich um konfligierendes, teils widersprüchliches und damit unsicheres medizinisch-wissenschaftliches Wissen; seit Jahrzehnten gibt es keinen Konsens in der Fachcommunity bzw. den Fachcommunities, ob Burnout die Kriterien für eine offizielle Krankheitsdiagnose erfüllt oder nicht – auch aktuell noch, wie Hillert et al. (2020: 1) darlegen:
„Since the first description of burnout in 1974 until today, more than 140 definitions have been suggested. Burnout–symptomatology's main characteristic, the experience of exhaustion, is unspecific. Different development–models of burnout were proposed, assumed to depict a quasi-natural process. These could not be confirmed empirically. An expert consensus on the diagnostic criteria and the conceptual location, whether as an independent disorder or as a risk, could not be agreed on. Nevertheless, the phenomenon of burnout in the ICD-11 is considered to be categorized as a work- related disorder. Psychiatric research on the burnout–phenomenon ignores problems of definition resulting from different perspectives: It may meet societal expectations, but does not fulfill scientific criteria, and therefore is not suitable to establish an objective diagnosis and treatment.“
Es ist demnach grundsätzlich mit einer Thematisierung von epistemischer Unsicherheit sowie mit einer Beteiligung wissenschaftlicher Akteur:innen zu rechnen. Während Aushandlungsprozesse und diagnostische Nachjustierungen aufgrund von Wissenszuwachs oder des Wandels von Denkstilen innerhalb der Medizin üblich sind (vgl. Kap. 3), deren Ergebnisse sich in den Neuauflagen der offiziellen Diagnosemanuale niederschlagen, besteht bei Burnout die Besonderheit, dass das Phänomen zusätzlich sowohl auf der terminologischen als auch der ontologischen Ebene in der Öffentlichkeit ausgiebig diskutiert wird (vgl. Lövelt 2013). Busch sieht hier sogar einen direkten Zusammenhang: Ihm zufolge sind solche Diskussionen in der Publikumspresse „publizistische Reflexe auf die Tatsache, dass medizinisches Wissen ‚voller Übergangs- und Grenzzustände‘ (Fleck 1983: 37) ist“ (Busch 2006a: 47 f.). Und Heinemann/Heinemann (2013: 131) schreiben speziell zu Burnout, dass es „gerade diese Ambivalenz von echter und vermeintlicher Krankheit [ist], die die Attraktivität des Syndroms […] ausmacht“. Es bedarf dann lediglich einer „kritische[n] Masse von Gegnern und Befürwortern“ (Busch 2006b: 406), die die Debatte in Gang hält.
Gedamke (2013) hat in einer Inhaltsanalyse schweizerischer Medien herausgearbeitet, dass das Thema Burnout stark mit den Nachrichtenfaktoren Identifikation und Sensationalismus verbunden ist, und somit eine große Attraktivität für Medien besteht, darüber zu berichten. Ein weiterer Faktor für die Popularität des Themas mag zudem sein, dass die „powerful metaphor“ (Schaufeli/Enzmann 1998: 186) Burnout von jedem intuitiv verstanden wird (vgl. Hillert/Mauritz 2006: 281). Es ist also davon auszugehen, dass zur innerwissenschaftlichen Diskrepanz der Überzeugungen auch noch eine zwischen den wissenschaftlichen und den lebensweltlichen hinzukommt, da die Metapher zu vielfältigen laienmedizinischen Interpretationen einlädt.
Details
- Pages
- 396
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631921722
- ISBN (ePUB)
- 9783631921739
- ISBN (Hardcover)
- 9783631921715
- DOI
- 10.3726/b22445
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Wissenschaftskommunikation Deutungsmacht Wissen und Akteure Unsicherheit und Nichtwissen Mediendiskurse Interdisziplinäre Diskursforschung
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 396 S., 20 S/W Abb., 7 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG