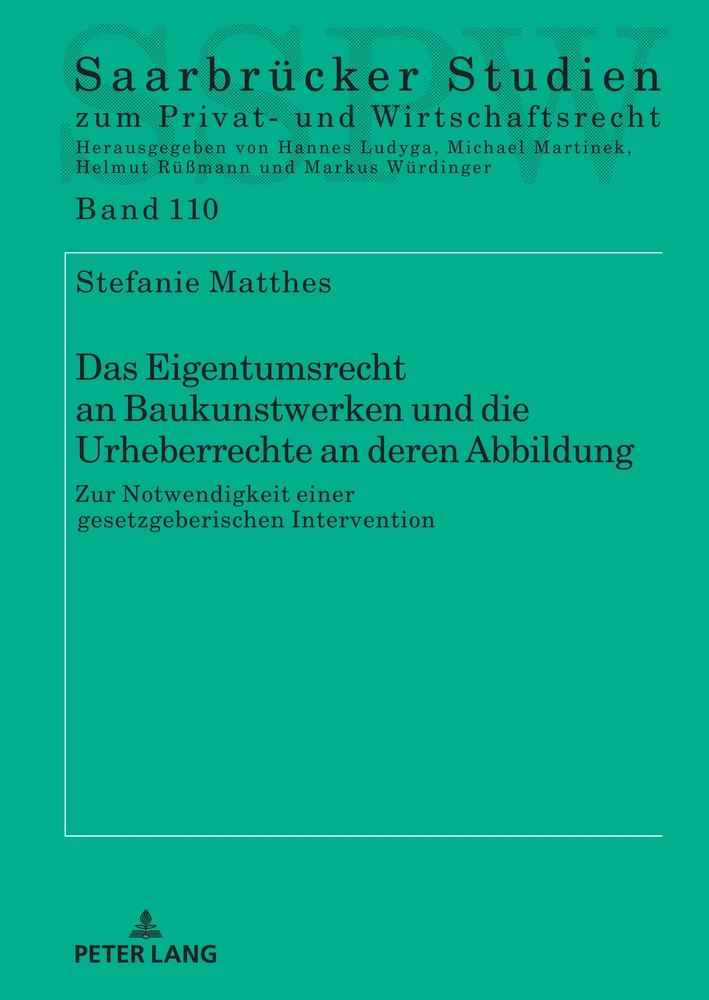Das Eigentumsrecht an Baukunstwerken und die Urheberrechte an deren Abbildung
zur Notwendigkeit einer gesetzgeberischen Intervention
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Grundbegriffe
- § 1 Kunstwerke in der Architektur der Baukunst
- I. Definition Kunst
- 1. Kunst im Verfassungsrecht
- 2. Kunst in einfachgesetzlichen Regelungen
- 3. Kunst im sachenrechtlichen Eigentumsrecht des § 903 S. 1 BGB
- II. Baukunstwerke
- 1. Persönliche Schöpfung und Wahrnehmbarkeit
- 2. Individualität
- 3. Gestaltungshöhe
- A. Hohe Schutzuntergrenze
- B. Niedrige Schutzuntergrenze
- C. Stellungnahme
- 4. Zwischenergebnis
- III. Baukunstwerke eines Museums
- § 2 Museen in öffentlich-rechtlicher und nicht-öffentlicher Trägerschaft
- I. Öffentlich-rechtliche Trägerschaft: Öffentlich-rechtliche Museen
- 1. Staatliche Museen
- A. Unmittelbare Staatsverwaltung: Staat als Eigentümer
- B. Mittelbare Staatsverwaltung: Juristische Person als Eigentümer
- 2. Nichtstaatliche Museen
- A. Unmittelbare Kommunalverwaltung: Kommune als Eigentümer
- B. Mittelbare Kommunalverwaltung: Juristische Person als Eigentümer
- II. Nicht-öffentliche Trägerschaft: Nicht-öffentliche Museen
- § 3 Kommerzielle und nicht-kommerzielle Verwertung
- § 4 Ergebnis
- Kapitel 2: Rechtlicher Schutz des Abbildungskünstlers hinsichtlich der Abbildung und Verwertung von Abbildungen
- § 1 Verfassungsrechtlicher Schutz
- I. Kunstfreiheit – Art. 5 Abs. 3 GG
- 1. Werkbereich: Anfertigung künstlerischer Abbildungen
- 2. Wirkbereich
- A. Öffentliche Verbreitung, Darbietung und Vermittlung künstlerischer Abbildungen
- B. Kommerzielle Verwertung künstlerischer Abbildungen
- II. Eigentumsfreiheit – Art. 14 GG
- III. Berufsfreiheit – Art. 12 GG
- § 2 Urheberrechtlicher Schutz
- I. Anfertigung künstlerischer Abbildungen
- 1. Fotografieaufnahmen
- 2. Reproduktionsaufnahmen
- A. Fotografische Reproduktion dreidimensionaler Vorlagen
- B. Technische Reproduktion dreidimensionaler Vorlagen: 3D-Scan
- a. Airborne Laserscanning
- b. Terrestrisches Laserscanning
- C. Reproduktionen gemeinfreier Werke
- D. Zusammenfassung
- 3. Filmaufnahmen
- 4. Weitere Abbildungen
- II. Verwertung künstlerischer Abbildungen
- § 3 Ergebnis
- Kapitel 3: Eigentumsrechte des Baukunstwerkeigentümers hinsichtlich der Anfertigung und Verwertung von Abbildungen
- § 1 Gesetzlicher Eigentumserwerb eines Museums an beweglichen Kunstwerken
- § 2 Darstellung der Rechtsprechung
- I. Anfertigung von Abbildungen: Friesenhaus
- II. Kommerzielle Verwertung von Abbildungen
- 1. Bauwerke in nicht-öffentlichem Eigentum: Schloss-Tegel
- 2. Bauwerke in öffentlich-rechtlichem Eigentum: Preußische Gärten und Parkanlagen
- A. Preußische Gärten und Parkanlagen I
- B. Preußische Gärten und Parkanlagen I: Wiedervorlage
- C. Preußische Gärten und Parkanlagen II
- D. Preußische Gärten und Parkanlagen III
- III. Kritische Betrachtung der Rechtsprechung
- 1. Fehlende Differenzierung zwischen Anfertigung und Verwertung von Abbildungen
- 2. Beeinträchtigung des Grundstückseigentums anstatt des Baukunstwerkeigentums
- 3. Eigentumsbeeinträchtigende Handlung: Betreten des Grundstücks
- A. Fehlende Präzisierung der beeinträchtigenden Handlung
- B. Grundstückseigentum als Anknüpfungspunkt
- C. Keine sachgerechten Ergebnisse
- D. Eigentum am Baukunstwerk als geeigneter Anknüpfungspunkt
- 4. Anfertigung und Verwertung von Abbildungen als Früchteziehungsrecht
- 5. Innere Verwertungsabsicht bei der Anfertigung und Verwertung von Abbildungen
- IV. Sonderfall: Google-Streetview-Entscheidungen
- V. Zwischenergebnis
- § 3 Konkurrenzverhältnis zwischen Eigentumsrecht und Urheberrecht
- I. Eigentumsrecht am äußeren Erscheinungsbild des Baukunstwerkes
- 1. Argumente gegen ein Recht am Bild der eigenen Sache
- 2. Argumente für ein Recht am Bild der eigenen Sache
- II. Schutz der Gemeinfreiheit
- 1. Gefahr einer Monopolstellung des Eigentümers
- 2. Schutz der Gemeinfreiheit durch Beschränkungsmöglichkeiten
- III. Zwischenergebnis
- § 4 Konkretisierung des Eigentumsinhalts des § 903 S. 1 BGB
- I. Einheitliche und differenzierte Betrachtung
- 1. Differenzierte Betrachtung des Eigentumsinhaltes: Zuweisungsgehalt ohne Ausschlussrecht
- 2. Differenzierte Betrachtung des Eigentumsinhaltes: Ausschlussrecht ohne Zuweisungsgehalt
- 3. Einheitliche Betrachtung des Eigentumsinhaltes
- II. Positive und negative Befugnisse als eigentumsprägende Merkmale
- § 5 Positive Befugnisse des Eigentümers
- I. Eigentumsprägende Merkmale der positiven Befugnisse
- II. Eigentumseinwirkung innerhalb der positiven Befugnisse
- 1. Pro Eigentumseinwirkung
- 2. Contra Eigentumseinwirkung
- A. Wortlaut des § 903 S. 1 BGB
- B. Unterschiedliche Wirkungsreichweite
- C. Funktionsunterschiede
- 3. Zwischenergebnis
- III. Anfertigung und Verwertung von Abbildungen als positive Befugnisse
- 1. Anfertigung von Abbildungen als Benutzung des Kunstwerkes
- 2. Verwertung der Abbildungen als Nutzung i.S.d. § 100 BGB
- IV. Zwischenergebnis
- § 6 Negative Befugnisse des Eigentümers: Ausschließungsrechte
- I. Konkretisierung des Begriffs der Einwirkung
- 1. Einwirkung im allgemeinen Sprachgebrauch
- 2. Einwirkung im Sinne einer eigenen Rechtswidrigkeit
- 3. Einwirkung im Zivilrecht: Konkretisierung anhand bekannter Begrenzungselemente
- A. Positive und negative Einwirkungen
- B. Ideelle Einwirkungen
- C. Auslegungsergebnis
- 4. Einwirkung im Sinne einer Körperlichkeit
- A. Körperlichkeit im Sinne einer Fühlungnahme
- B. Konkretisierung des Begriffs „Fühlungnahme“
- a. Funktionales Eigentumsverständnis
- b. Voraussetzungen einer mittelbaren Fühlungnahme
- C. Begrenzung der Körperlichkeit auf wesentliche Einwirkungen
- a. Öffentlicher Bereich
- b. Erheblicher Zeitraum
- c. Rivalitätsgedanke
- d. Kein zusätzlich schützenswertes Interesse
- e. Zwischenergebnis
- 5. Auslegungsergebnis
- A. Weiter Einwirkungsbegriff
- B. Mittelbare Fühlungnahme als geeignetes Begrenzungsmerkmal
- C. Begründung der Mittelbarkeit
- 6. Zwischenergebnis
- II. Anfertigung von Abbildungen als Eigentumseinwirkung
- 1. Abbildung mit (substanzverletzenden) Hilfsmitteln
- 2. Abbildung ohne substanzverletzende Hilfsmittel
- A. Einwirkung im Sinne einer mittelbaren Fühlungnahme
- B. Wesentlichkeit der Einwirkung
- a. Abbildung zu öffentlichen Zwecken
- b. Rivalitätsgedanke
- c. Zeitliche Komponente
- C. Zwischenergebnis
- 3. Übertragung auf bekannte Sachverhalte
- A. Hundertwasserhaus-Entscheidung
- B. Google Streetview-Entscheidungen
- C. Preußische Gärten und Parkanlagen-Entscheidungen
- III. Verwertung von Abbildungen als Eigentumseinwirkung
- 1. Kommerzielle Verwertung
- A. Einwirkung im Sinne einer mittelbaren Fühlungnahme
- B. Wesentlichkeit der Einwirkung
- a. Verwertung zu öffentlichen Zwecken
- b. Rivalitätsgedanke
- c. Zeitliche Komponente
- C. Zwischenergebnis
- 2. Mittelbar-kommerzielle Verwertung
- 3. Nicht-kommerzielle Verwertung
- A. Einwirkung im Sinne einer mittelbaren Fühlungnahme
- B. Wesentlichkeit der Einwirkung
- a. Verwertung zu öffentlichen Zwecken
- b. Rivalitätsgedanke
- c. Zeitliche Komponente
- C. Zwischenergebnis
- 4. Übertragung auf bekannte Sachverhalte
- A. Hundertwasserhaus-Entscheidung
- B. Google Streetview-Entscheidungen
- C. Preußische Gärten und Parkanlagen- Entscheidungen
- IV. Anfertigung und Verwertung von Abbildungen mittels einer Flugdrohne
- 1. Darstellung der Rechtsprechung
- 2. Vorliegen einer Eigentumseinwirkung
- A. Anfertigung der Abbildung
- B. Verwertung der Abbildung
- 3. Zwischenergebnis
- V. Persönlichkeitsrechte des Eigentümers als Anknüpfungspunkt der Einwirkung
- VI. Eigentumsgefährdung als Eigentumseinwirkung
- VII. Zwischenergebnis
- A. Keine wesentliche Eigentumseinwirkung durch die Anfertigung einer Abbildung
- B. Wesentliche Eigentumseinwirkung durch die Verwertung einer Abbildung
- a. Kommerzielle Verwertung
- b. Mittelbar-kommerzielle Verwertung
- c. Nicht-kommerzielle Verwertung
- C. Kein Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- D. Keine Eigentumseinwirkung durch Eigentumsgefährdung
- § 7 Ergebnis
- Kapitel 4: Beschränkungen der Eigentumsrechte de lege lata
- § 1 Gesetzliche Beschränkungen der Eigentumsrechte
- I. Urheberrechtliche Schrankenregelungen
- 1. Anwendbarkeit
- A. Analogiefähigkeit
- a. Voraussetzungen des allgemeinen Gesetzesvorbehaltes gem. Art. 20 Abs. 3 GG
- b. Voraussetzungen des speziellen Gesetzesvorbehaltes gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG
- c. Keine Vergleichbarkeit mit Gewohnheitsrechten
- d. Restriktive Anwendung urheberrechtlicher Schrankenregelungen
- B. Übertragung urheberrechtlicher Wertungen
- a. Prävention der Einschränkung urheberrechtlicher Schrankenregelungen
- b. Vergleichbare soziale Funktion des Eigentums im Allgemeinen
- c. Vergleichbare soziale Funktion des Eigentums eines Museums im Besonderen
- d. Keine Vereinbarkeit mit speziellem Gesetzesvorbehalt gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG
- C. Panoramafreiheit als allgemeiner Rechtsgrundsatz
- 2. Zwischenergebnis
- II. Denkmalschutzgesetze
- 1. Beschränkungen durch Nutzungspflichten
- 2. Beschränkungen durch Nebenpflichten
- 3. Zusammenfassung
- III. Ethische Richtlinien für Museen von ICOM
- IV. UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt
- V. Weitere gesetzliche Beschränkungen der Eigentumsrechte
- VI. Zwischenergebnis
- § 2 Beschränkungen durch Widmung zum Gemeingebrauch
- I. Öffentliche Widmung
- 1. Öffentliche Zugänglichmachung als Stiftungszweck
- 2. BGH: Keine Widmung zum Gemeingebrauch
- 3. Kritik: Öffentliche Zugänglichmachung als Widmung zum Gemeingebrauch
- 4. Stellungnahme
- II. Inhalt des Stiftungszwecks
- 1. Enge Auslegung
- 2. Weite Auslegung
- 3. Vermittelnde Ansicht
- 4. Übertragung der Wertungen zu „Google Street View“
- A. Gemeingebrauch gemäß subjektiven Kriterien
- B. Gemeingebrauch gemäß objektiven Kriterien
- C. Übertragung der objektiven Kriterien: Gemeingebrauchsverträgliche Nutzung
- 5. Stellungnahme
- A. Ablehnung einer engen Auslegung
- B. Ablehnung einer weiten Auslegung
- C. Anwendung der vermittelnden Ansicht: Gemeingebrauchsverträglichkeit
- a. Keine Beeinträchtigung Dritter aufgrund der Verwertung von Abbildungen
- b. Keine Beeinträchtigung Dritter aufgrund der Anfertigung von Abbildungen
- D. Schlussfolgerungen
- III. Zwischenergebnis
- § 3 Beschränkungen durch entgegenstehende Rechte Dritter
- I. Urheberrechte des Baukunstwerkurhebers
- 1. Beschränkung der positiven Befugnisse
- 2. Beschränkung der negativen Befugnisse
- A. Interessenabwägung Eigentumsrecht und Urheberrecht
- a. Bestimmungsgemäße Verwendung
- b. Einschlägige Grundrechte
- c. Verblassen des Urheberrechts
- d. Art und Ausmaß des Eingriffs
- e. Maß der Gestaltungshöhe
- f. Allgemein-öffentliche Interessen
- g. Ergebnis der Interessenabwägung
- B. Keine Eigentumsverletzung durch den Urheber aufgrund Lizenzvergabe
- C. Zwischenergebnis
- II. Urheberrechte des Abbildungskünstlers
- III. Grundrechte des Abbildungskünstlers
- 1. Grundrechtsbindung eines Museums
- 2. Einschlägige Grundrechte und ihre Bindung
- A. Informationsfreiheit – Art. 5 Abs. 1 S. 1, 2. Hs. GG
- B. Kunstfreiheit – Art. 5 Abs. 3 GG
- C. Pressefreiheit – Art. 5 Abs. 1 S. 2, Var. 1 GG
- D. Berufsfreiheit – Art. 12 Abs. 1 GG
- E. Sozialpflichtigkeit – Art. 14 Abs. 2 S. 2 GG
- 3. Zwischenergebnis
- § 4 Ergebnis
- Kapitel 5: Begründung einer legislativen Intervention de lege ferenda
- § 1 Schützenswerte Rechte und Interessen
- I. Grundrechtsschutz des Baukunstwerkeigentümers
- 1. Grundrechtsfähigkeit
- 2. Grundrechtsschutz
- A. Eigentumsfreiheit – Art. 14 Abs. 1 GG
- B. Allgemeiner Gleichheitssatz – Art. 3 GG
- C. Berufsfreiheit – Art. 12 Abs. 1 GG
- D. Allgemeines Persönlichkeitsrecht – Art. 2 Abs. 1 GG
- E. Zwischenergebnis
- II. Grundrechtsschutz des Abbildungskünstlers und der Allgemeinheit
- III. Interessenabwägung
- 1. Legitimer Zweck
- 2. Geeignetheit
- 3. Erforderlichkeit
- 4. Angemessenheit – Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn
- IV. Zwischenergebnis
- § 2 Entwurf einer gesetzlichen Regelung
- I. Angemessener Entscheidungsspielraum der Rechtsprechung
- II. Einschränkung des Regelungsumfangs
- 1. Trägerschaft des Museums und Abbildungsort
- 2. Objektive Erkennbarkeit und erhebliches Überwiegen der Interessen Dritter
- III. Anwendungsfälle
- IV. Rechtsfolgen
- V. Regelungsvorschlag einer legislativen Intervention
- VI. Zwischenergebnis
- § 3 Rechtsfolgen der gesetzlichen Eigentumsbeschränkung
- I. Auswirkungen auf den Eigentumsinhalt
- II. Auswirkungen auf die Beweislastverteilung
- III. Konkrete Ausgestaltung der Beweislastverteilung
- § 4 Ergebnis
- Resumé und Ausblick
- Thesen
- Literaturverzeichnis
Vorwort
Die vorliegende Doktorarbeit entstand an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes und wurde im Sommersemester 2023 zur Dissertation angenommen. Sie enthält die aktuelle Rechtsprechung und Literatur bis zum Monat April 2023.
Die Ausgangsidee für das Thema der Doktorarbeit entsprang vornehmlich meiner persönlichen Vorliebe für insbesondere fotografische Kunst, die ich im Rahmen von Ausstellungen mit viel Freude konsumiere und gleichermaßen gerne selbst praktiziere. Die sich daraus ergebenden rechtlichen Fragestellungen und Herausforderungen leiteten mich nahezu organisch zu meinem Dissertationsthema.
Der größte Dank gilt zuvörderst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Martinek, der mich durch die vielen Jahre der Dissertation beharrlich bis zum Ziel und darüber hinaus begleitete, mir stets mit motivierenden Worten aufmunternd zur Seite stand und schließlich das Erstgutachten erstellte.
Herrn Prof. Dr. Dimitrios Linardatos danke ich für seine wertvolle Unterstützung sowie für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens.
Zudem gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Peter Mankowski, der mich während meines Studiums an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Hamburg in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit gefördert hatte und mir den wesentlichen Impuls zur Anfertigung einer Doktorarbeit gab.Ganz herzlich danke ich auch der Dr. Friedrich Feldbausch-Stiftung für die besondere Auszeichnung und Überreichung des Förderpreises.
Zu tiefer Dankbarkeit bin ich zudem allen meinen Freundinnen und Freunden insbesondere in Hamburg, Berlin und in Frankfurt a.M. verpflichtet, die mir von Beginn der Doktorarbeit an bis zu ihrer Finalisierung stets ermutigend, tröstend und bestärkend zur Seite standen und einen ganz erheblichen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geleistet haben. Namentlich erwähnen möchte ich an dieser Stelle meine lieben Menschen Fredi, Dana und Ines, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte.
Abschließend und von tiefstem Herzen danke ich meiner Familie und in erster Linie meinen Eltern: für ihre umfassende Unterstützung, ihre unerschütterliche Zuversicht, ihre Geduld und ihre Liebe.
Einleitung
A. Einführung in die Problemstellung
Gegenstand dieser Arbeit ist das Konkurrenzverhältnis zwischen dem sachenrechtlichen Eigentumsrecht gem. § 903 S. 1 BGB an Baukunstwerken und den immaterialgüterrechtlichen Urheberrechten des Abbildungskünstlers an Abbildungen der Baukunstwerke. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Konkurrenzverhältnisse können grundsätzlich vielfältig sein. Sofern das Baukunstwerk weiterhin urheberrechtlichen Schutz genießt, stehen sich neben dem Eigentumsrecht an dem Baukunstwerk und den Urheberrechten des Abbildungskünstlers ferner die Urheberrechte des Baukunstwerkurhebers gegenüber. Diese Konkurrenzverhältnisse realisieren sich, sobald der Baukunstwerkeigentümer, der Abbildungskünstler als auch der Baukunstwerkurheber jeweils personenverschieden sind. Da eine freie Nutzbarkeit im Sinne des Urheberrechtsgesetzes durch den Abbildungskünstler nur bei einem gemeinfrei gewordenen Baukunstwerk denkbar wird und der urheberrechtliche Schutz an einem Baukunstwerk häufig bereits abgelaufen ist, konzentriert sich diese Arbeit auf das Konkurrenzverhältnis zwischen den Urheberrechten des Abbildungskünstlers an der Abbildung eines gemeinfreien Baukunstwerkes und den Eigentumsrechten an dem abgebildeten Baukunstwerk. Dieses Konkurrenzverhältnis wirft die Frage auf, ob der Abbildungskünstler ohne die Zustimmung des Baukunstwerkeigentümers Abbildungen des Baukunstwerkes wie bspw. durch Fotografie, Film, Malerei oder skulpturale Nachbildung abbilden und anschließend verwerten darf. Seit den BGH-Entscheidungen Preußische Gärten und Parkanlagen I bis III1 hat dieser Interessenkonflikt an Popularität gewonnen und bedarf einer näheren Betrachtung. Von dem Forschungsgegenstand ausgenommen werden das Konkurrenzverhältnis zu dem Baukunstwerkurheber sowie das Verhältnis zu reinen Abbildenden ohne einen urheberrechtlichen Schutz als sog. „Kopierer“ eines Werkes. Weiterhin konzentriert sich diese Arbeit auf Abbildungen von Baukunstwerken und schließt zugleich eine nähere Betrachtung beweglicher Kunstwerke etwa innerhalb eines Baukunstwerkes aus. Anhand einer einführenden Darstellung der Entscheidung Preußische Gärten und Parkanlagen I2 soll die Problemstellung im Folgenden veranschaulicht werden.
Die öffentlich-rechtliche Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist Eigentümerin diverser Kulturgüter, u.a. historischer Schlösser sowie der dazugehörigen Parkanlagen und Skulpturen auf dem Gelände. Aufnahmen dieser Kulturgüter vertreibt die Stiftung u.a. in Form von Postkarten. Urheberrechte bestehen an den Kulturgütern nicht mehr. Ein Fotograf fertigte im Auftrag einer Fotoagentur ohne das Vorliegen einer Genehmigung seitens der Eigentümerin beim Betreten der Parkanlage Aufnahmen der Kulturgüter an.3 Diese Aufnahmen bot die Agentur schließlich in einem von ihr betriebenen Internetportal zum Verkauf an. Die Eigentümerin verklagte die Agentur daraufhin auf Unterlassung der Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe der Aufnahmen durch die Agentur, soweit diese nicht von öffentlichen Plätzen, sondern vom Grundstück der Eigentümerin aus angefertigt wurden. Zudem begehrte sie Auskunft über die getätigten Verwertungen sowie Schadensersatzfeststellung.
Der BGH sah grundsätzlich eine Beeinträchtigung des Eigentums an dem Grundstück i.S.d. § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB durch die Anfertigung und Verwertung der Aufnahmen als gegeben an, sofern das Grundstück für die Anfertigung der Aufnahmen betreten wurde und die Aufnahmen nicht von einer allgemein zugänglichen Stelle aus angefertigt wurden.4 Der BGH setzte sich dabei mit dem Eigentum an dem Grundstück auseinander, ohne eine Eigentumsbeeinträchtigung der einzelnen Kulturgüter zu prüfen. Eine Duldungspflicht gem. § 1004 Abs. 2 BGB sah der BGH auch trotz der Stellung der Eigentümerin als juristische Person des öffentlichen Rechts nicht gegeben.5 Allgemeine Interessen am Kennenlernen künstlerischer oder sonstiger bedeutsamer Bauten seien durch den eigenen Postkartenvertrieb der Eigentümerin hinreichend bedient.6 Eine Handlungsstörereigenschaft gem. § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB bestätigte der BGH dabei ohne eine nähere Konkretisierung der störenden Handlung.7 Zudem bejahte er eine indizierte Wiederholungsgefahr aufgrund des bereits einmal stattgefundenen Ereignisses, wobei er hierfür auf das Fotografieren und das Einstellen in das Online-Portal zum Verkauf der Aufnahmen abstellte, hingegen nicht auf das Betreten des Grundstücks.8
Diese Entscheidung, die hinsichtlich ihrer Argumentation mit den parallel ergangenen BGH-Entscheidungen zu Preußische Gärten und Parkanlagen II und III überwiegend identisch ist, lässt eine Vielzahl an Fragen unbeantwortet und bringt weitere Unklarheiten und Unsicherheiten mit sich.
So lässt der BGH offen, welche konkrete Handlung zu einer Eigentumsbeeinträchtigung an dem Grundstückseigentum führt. Laut der BGH-Entscheidung Preußische Gärten und Parkanlagen I beeinträchtige die Anfertigung der Aufnahme sowie deren Verwertung das Grundstückseigentum, sofern das Grundstück für die Anfertigung der Aufnahme betreten wird. Demnach kommen als Verletzungshandlung sowohl die Anfertigung der Aufnahme, deren Verwertung, aber auch das bloße Betreten des Grundstücks in Betracht. Gänzlich unbeantwortet lässt der BGH die Frage, ob infolge der oben benannten drei Handlungen eine Eigentumsbeeinträchtigung an den Kulturgütern unabhängig von einer Beeinträchtigung am Grundstückseigentum vorliegt bzw. vorliegen kann. Die fehlende Präzisierung der eigentumsbeeinträchtigenden Handlung führt dazu, dass sie im Rahmen der Störereigenschaft nicht konkret benannt wird und demnach ebenfalls sowohl das Betreten, das Anfertigen der Aufnahme als auch die Verwertung der Aufnahme in Betracht gezogen werden können. Weiterhin überrascht, dass der BGH innerhalb der Wiederholungsgefahr nicht auf das Betreten des Grundstücks, sondern auf das Anfertigen sowie das Einstellen der Aufnahmen in das Online-Portal zum Verkauf abstellt. Die Entscheidung dürfte sowohl Abbildungskünstler als auch Eigentümer eines Kunstwerkes verunsichern, da das Recht zur Anfertigung und Verwertung von Aufnahmen von dem Ort der Aufnahme abhängig gemacht wird und die Begründung für diese differenzierte Betrachtung nicht nachvollziehbar erscheint. Folglich können aus dieser Entscheidung keine Schlussfolgerungen zum rechtlichen Umgang mit Aufnahmen gezogen werden, die mithilfe einer Drohne und somit ohne Betreten des Grundstücks, aber schwebend über dem betroffenen Grundstück angefertigt wurden. Ferner bleibt die Bewertung von Aufnahmen beweglicher Kunstwerke offen, die sich bspw. innerhalb der Räumlichkeiten eines Baukunstwerkes befinden können. Schließlich knüpft der BGH in seiner Entscheidung nicht an das Baukunstwerk an, sondern an das Grundstück, auf dem sich das Werk befindet. Unsicherheiten bleiben zuletzt auch für den Fall bestehen, in dem der Aufnehmende zwar das Grundstück betritt, aber ein Baukunstwerk im Eigentum eines Dritten außerhalb des betretenen Grundstücks aufnimmt. Dies wirft die Frage auf, welche Rechte zukünftig an Abbildungen von Baukunstwerken und deren Verwertung bestehen und welcher Umgang zulässig ist.
Diese Entscheidung verdeutlicht die beiden Schwerpunkte, die im Rahmen dieser Arbeit behandelt werden sollen: Einerseits stehen sich zwei sich widersprechende Interessen gegenüber, die in einen gerechten Ausgleich miteinander zu bringen sind. So befindet sich auf der einen Seite der Baukunstwerkeigentümer, der einen hinreichenden Schutz seines Eigentums fordert. Auf der anderen Seite stehen die Interessen des Abbildungskünstlers, der infolge der Anfertigung einer Abbildung des Baukunstwerkes ggf. ebenfalls ein eigenes Kunstwerk erschaffen hat und durch die Verbreitung zugleich der Allgemeinheit den Zugang zur Kunst ermöglichen möchte. Dies betrifft sowohl den Zugang zu seinem eigenen geschaffenen Werk als auch zu dem Baukunstwerk des Baukunstwerkeigentümers. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Untersuchung des Eigentumsrechts i.S.d. § 903 S. 1 BGB dahingehend, ob die Anfertigung und Verwertung von Abbildungen eines Baukunstwerkes von den Eigentumsrechten als sachenrechtliches Recht mit umfasst werden können, obwohl die Anfertigung und Verwertung von Abbildungen grundsätzlich als immaterialgüterrechtliche Rechte dem Urheberrecht zugeordnet werden. Dies umfasst die weitergehende Fragestellung, ob das Eigentumsrecht ausschließlich die Sachherrschaft über körperliche Sachen oder auch das äußere Erscheinungsbild einer Sache zu schützen vermag.
Daher soll in dieser Arbeit herausgearbeitet werden, ob das Eigentum an einem Baukunstwerk durch die Anfertigung und Verwertung einer Abbildung dieses Baukunstwerkes beeinträchtigt werden kann. Im Unterschied zu der zuvor dargestellten BGH-Entscheidung wird dabei nicht das Eigentum an dem betretenen Grundstück als Anknüpfungspunkt für eine Eigentumsbeeinträchtigung herangezogen. Stattdessen soll das Eigentum an dem Baukunstwerk unabhängig vom Grundstückseigentum untersucht werden, um den zuvor beschriebenen Unklarheiten und daraus resultierenden Unsicherheiten entgegenzuwirken.
Sodann ist zu hinterfragen, wie die entgegenstehenden Interessen des Baukunstwerkeigentümers mit den Interessen des Abbildungskünstlers hinsichtlich der Anfertigung und Verwertung von Abbildungen des Werkes miteinander in einen Einklang gebracht werden können.
Primär sollen Baukunstwerke eines Museums betrachtet werden, die grundsätzlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Aus der Stellung eines Museums als juristische Person des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts können sich Besonderheiten bspw. innerhalb der Duldungspflichten des Eigentümers ergeben. Die öffentliche Präsenz eines Museums und ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu Museen und ihrer Kunst können zudem Rechteeinschränkungen erfordern. Museen bzw. das Museumsgelände mit den dazugehörigen Parkanlagen und Grünflächen erhalten teilweise aufgrund ihrer besonderen Ästhetik oder aufwendigen Gestaltung eine architektonisch besondere Bedeutung und sind daher aufgrund ihrer Optik als Kunstwerke für die Öffentlichkeit von gesteigertem Interesse. Aus dieser besonderen Stellung eines Museums könnten sich Pflichten zur Zugänglichmachung und zur Gestattung der Anfertigung von Abbildungen und deren Verbreitung herleiten lassen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen den verschiedenen Trägerformen eines Museums und ob es sich um ein staatliches oder nicht-staatliches, bzw. ein öffentlich-rechtliches oder ein nicht-öffentliches Museum handelt. Aus den unterschiedlichen Formen können sich abweichende Verpflichtungen des Museumseigentümers ableiten lassen.
Weiterhin sollen Abbildungen untersucht werden, die ebenfalls ein eigenes Kunstwerk verkörpern und daraus resultierend ggf. besonders schutzwürdig sind, sodass deren Anfertigung und Verwertung privilegiert zu behandeln wäre. Hierdurch entsteht ein Spannungsverhältnis, bei dem das Eigentumsrecht an einem Baukunstwerk mit den Rechten des Abbildungskünstlers an der künstlerisch gestalteten, urheberrechtlichen Abbildung, aber auch den Interessen der Allgemeinheit am Zugang zur Kunst in eine Interessenkollision gerät. Diese Interessen sind in einen Ausgleich miteinander zu bringen, um dem verfassungsrechtlich gesicherten Grundsatz der Sozialpflichtigkeit des Eigentums gerecht werden zu können. Da es dahingehend bislang an einer gesetzlichen Regelung mangelt und das Eigentum aufgrund des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG ausschließlich durch ein Gesetz beschränkt werden kann, ist eine legislative Intervention eingehend zu prüfen.
B. Forschungsgegenstand
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, ob de lege lata bereits ein hinreichender Interessenausgleich zwischen den Interessen des Baukunstwerkeigentümers und den Interessen eines von dem Eigentümer personenverschiedenen Abbildungskünstlers aufgrund bestehender gesetzlicher Beschränkungsmöglichkeiten geschaffen wurde, oder ob dieser Ausgleich de lege ferenda in Form gesetzlicher Regelungen zukünftig zu schaffen ist. In diesem Konflikt begehrt der Baukunstwerkeigentümer den Schutz vor Einwirkungen i.S.d. § 903 S. 1 BGB auf seine Baukunstwerke, wohingegen der Abbildungskünstler die Abbildungen dieser Werke entgegen der Zustimmung und den Interessen des Baukunstwerkeigentümers verbreiten und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte.
Gegenstand dieser Arbeit sind schwerpunktmäßig Baukunstwerke, deren urheberrechtlicher Schutz bereits abgelaufen ist und die mithin gemeinfrei geworden sind. Der zugrunde liegende Begriff des Baukunstwerkes umfasst neben dem Bauwerk als Gebäude bspw. u.a. auch dazugehörige künstlerisch gestaltete Denkmäler, Plätze sowie Park- und Gartenanlagen. Die Bezeichnung „Baukunstwerk“ ist dahingehend einzugrenzen, dass sie sich in dieser Arbeit ausschließlich auf architektonische Werke der Baukunst als eigene Kunstgattung der Architektur bezieht. Dementsprechend wird der Begriff nicht im Sinne einer abstrakten, künstlerischen oder wissenschaftlichen „Auseinandersetzung mit dem vom Menschen geschaffenen Raum und insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Mensch, Raum und Zeit“9 aufgefasst, die ebenfalls als eigene Kunstgattung der Architektur verstanden werden könnte.
Zur Begründung des benannten Konkurrenzverhältnisses soll zunächst herausgearbeitet werden, unter welchen Voraussetzungen die angefertigte Abbildung sowie deren Verwertung aufgrund ihrer Eigenschaft als Kunstwerk bereits rechtlichen, bspw. urheberrechtlichen Schutz erfahren, um anschließend den dahingehend bestehenden rechtlichen Schutz des Baukunstwerkeigentümers an dem Baukunstwerk zu prüfen und gegenüberzustellen. Die hiesige Forschung wird u.a. anhand einer Untersuchung der bisher ergangenen Rechtsprechung durchgeführt, die sich mit dem Eigentumsschutz bei einer nicht genehmigten Anfertigung und Verwertung von Abbildungen durch von dem Baukunstwerkeigentümer personenverschiedene Dritte befasst hat. Anhand einer kritischen Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung soll aufgezeigt werden, dass die Eigentumsrechte in Bezug auf die Anfertigung und Verwertung von Abbildungen eines Baukunstwerkes bislang weder durch die Rechtsprechung noch durch gesetzliche Regelungen vollständig geklärt bzw. geregelt wurden.
Anschließend wird anhand der bestehenden legislativen Regelungen der Inhalt des Eigentums aus § 903 S. 1 BGB in Bezug auf sein grundsätzlich umfassendes Herrschaftsrecht dahingehend dogmatisch untersucht, ob eine Subsumtion der Anfertigung und Verwertung von Abbildungen eines Baukunstwerkes unter § 903 S. 1 BGB möglich ist.
Eine genaue dogmatische Betrachtung soll dabei dem Begriff der Einwirkung aus § 903 S. 1 BGB gewidmet werden, der ausschließlich innerhalb der negativen Befugnisse des Eigentümers heranzuziehen ist und daher insbesondere in den Konstellationen bedeutsam wird, in denen der Eigentümer sich u.a. gegen die Anfertigung von Abbildungen seines Baukunstwerkes und deren Verwertung zu wehren beabsichtigt. Auf der Basis bereits bestehender Einwirkungsarten wie der positiven, negativen und ideellen Einwirkung, verschiedener Ansichten in der Literatur zur Einwirkung bzw. zur Eigentumsbeeinträchtigung sowie anhand bestehender, allgemeiner Rechtsgrundsätze werden die Voraussetzungen für eine Definition der Einwirkung entwickelt. Gleichzeitig werden die bestehenden Ansichten in der Literatur eingehend beleuchtet und diskutiert.
Mithilfe der herausgearbeiteten Voraussetzungen einer Eigentumseinwirkung sollen im Anschluss die Begriffe der Anfertigung bzw. Verwertung von Abbildungen des Baukunstwerkes unter den Begriff der Eigentumseinwirkung subsumiert werden. Zugleich wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die entwickelte Definition einer Einwirkung für die bereits ergangenen und vergleichbaren Entscheidungen hätte, namentlich für die oben zitierten Entscheidungen Preußische Gärten und Parkanlagen I bis III,10 die Hundertwasser-Entscheidung11 sowie die Google-Streetview-Entscheidungen.12
Aufgrund eines tendenziell weiten Verständnisses des Eigentumsrechts i.S.d. § 903 S. 1 BGB sind im weiteren Verlauf deren Beschränkungsmöglichkeiten durch Gesetze und Rechte Dritter zu untersuchen. Der Fokus liegt darauf, die gesetzlichen Beschränkungen aufgrund der besonderen Stellung eines Museums herauszuarbeiten und hervorzuheben. In der Eigenschaft als Museum ist dieses der Öffentlichkeit frei zugänglich und soll Kunstinteressen der Allgemeinheit fördern und befriedigen. Dies kann besondere Pflichten des Eigentümers im Hinblick auf die Interessen der Allgemeinheit zur Konsequenz haben. Zugleich sind im Rahmen der Beschränkungen eingehend die Rechte des Abbildungskünstlers zu untersuchen.
Diese Arbeit verdeutlicht die bestehenden Lücken in der Rechtsprechung sowie in den legislativen Regelungen in Bezug auf die Rechte und Pflichten des Baukunstwerkeigentümers und des Abbildungskünstlers. Eine legislative Intervention ist daher begründet und dringend angezeigt. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, den Interesenskonflikt, insbesondere angesichts der grundrechtlich sichergestellten Sozialpflichtigkeit des Eigentums, rechtssicher zu lösen.
Ausgenommen von dem Forschungsgegenstand sind Abbildungen beweglicher Kunstwerke wie Gemälde, Fotografien oder Skulpturen, die in der Regel innerhalb der Räumlichkeiten eines Museumsgebäudes ausgestellt werden. Ebenfalls ausgenommen sind Abbildungen von im Privateigentum befindlichen Baukunstwerken wie bspw. Gebäude, die ausschließlich Wohnzwecken dienen. Die oben beschriebenen Besonderheiten öffentlicher Baukunstwerke von Museen stellen sich bei diesen Werken nicht. Da der Fokus auf der de lege lata bestehenden bzw. einer de lege ferenda noch zu schaffenden gesetzlichen Regelungen liegt, soll auf die denkbaren Möglichkeiten des Baukunstwerkeigentümers zur Schaffung und Gestaltung vertraglicher Regelungen wie Zugangsbeschränkungen zum Baukunstwerk oder das Aufstellen von Verhaltensgeboten bzw. -verboten bspw. in Form von Fotografieverboten nicht näher eingegangen werden. Diese Arbeit widmet sich zudem ausschließlich der deutschen Rechtslage, obwohl sich beim Vertrieb inländischer Abbildungen im Ausland oder ausländischer Abbildungen im Inland ebenfalls zu klärende grenzüberschreitende Konstellationen ergeben können.
C. Gang der Untersuchung
- Grundbegriffe: Das erste Kapitel dieser Arbeit führt die relevanten Grundbegriffe der gegenständlichen Forschung detailliert auf und findet geeignete Definitionen. Dies soll die Darstellung der Untersuchung nachvollziehbarer gestalten und sie gleichzeitig eingrenzen. Zu Beginn wird eine bislang fehlende Definition der Kunst im sachenrechtlichen Eigentumsrecht herausgearbeitet, um schließlich die Bezeichnung „Baukunstwerke“ einzugrenzen und die Besonderheiten von Baukunstwerken eines Museums aufzuzeigen (dazu unten 1. Kapitel § 1). Aufgrund der erheblichen Auswirkungen u.a. auf die Eigentumsfähigkeit eines Museums sowie die Beschränkungsmöglichkeiten der Eigentumsrechte ist eine differenzierte und erläuternde Darstellung von Museen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft und solchen in nicht-öffentlicher Trägerschaft für das Forschungsvorhaben unerlässlich (dazu unten 1. Kapitel § 2). Abschließend wird der Begriff der Verwertung definiert und zwischen der kommerziellen sowie der nicht-kommerziellen Verwertung differenziert (dazu unten 1. Kapitel § 3).
- Rechtlicher Schutz des Abbildungskünstlers: Nachdem im vorherigen Kapitel u.a. der Begriff der Kunst im sachenrechtlichen Eigentumsrecht herausgearbeitet wurde, werden in dem zweiten Kapitel die Rechte des Abbildungskünstlers an einer von ihm gefertigten Abbildung untersucht. Beleuchtet wird dabei, inwiefern dem Abbildungskünstler im Hinblick auf die Anfertigung sowie der Verwertung einer von ihm gefertigten Abbildung sowohl verfassungsrechtlicher (dazu unten 2. Kapitel § 1) als auch einfachgesetzlicher Schutz (dazu unten 2. Kapitel § 2) aufgrund ihm zustehender Rechte gebührt, wenn er durch die Abbildung ein eigenes Kunstwerk geschaffen hat. Diese Untersuchung ist erforderlich, um ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem Abbildungskünstler und dem von ihm personenverschiedenen Baukunstwerkeigentümer zunächst dem Grunde nach aufzeigen zu können. Dabei wird zwischen den verschiedenen Formen einer Abbildung differenziert und detailliert auf fotografische und technische Reproduktionen eingegangen, um u.a. die rechtliche Schutzfähigkeit von Scan-Aufnahmen genauer zu überprüfen.
- Rechtlicher Schutz des Baukunstwerkeigentümers: Dieses Kapitel widmet sich der Untersuchung, ob die positiven und negativen Befugnisse des Baukunstwerkeigentümers i.S.d. § 903 S. 1 BGB auch die Anfertigung und Verwertung von Abbildungen eines Baukunstwerkes umfassen. Aufgrund der hervorzuhebenden Sonderstellung eines Museums soll zu Beginn der Eigentumserwerb an Baukunstwerken eines Museums aufgezeigt werden (dazu unten 3. Kapitel § 1). Um zu verdeutlichen, dass der Inhalt des Eigentums i.S.d. § 903 S. 1 BGB einer dogmatisch ausführlichen Betrachtung bedarf, ist vorab die bereits ergangene Rechtsprechung kritisch zu untersuchen (dazu unten 3. Kapitel § 2). Auch das Verhältnis zwischen dem Eigentumsrecht des Baukunstwerkeigentümers und den Urheberrechten des Baukunstwerkurhebers an einem identischen Baukunstwerk gilt zuvor geklärt zu werden. Eine tiefergehende dogmatische Prüfung des Eigentumsinhaltes wäre entbehrlich, sofern das Konkurrenzverhältnis im Hinblick auf urheberrechtliche Nutzungshandlungen durch den Abbildungskünstler – z.B. die Anfertigung und Verwertung von Abbildungen des Baukunstwerkes – bereits durch das Urheberrecht abschließend geregelt würde, auch wenn das Urheberrecht des Baukunstwerkurhebers an dem Werk zwischenzeitlich erloschen ist (dazu unten 3. Kapitel § 3). Anschließend wird der Eigentumsinhalt anhand der positiven und negativen Befugnisse des Eigentümers konkretisiert (dazu unten 3. Kapitel §§ 4, 5, 6), um schließlich den Versuch zu unternehmen, die Anfertigung einer Abbildung sowie deren Verwertung unter die im Rahmen dieser Arbeit herausgearbeiteten Voraussetzungen einer Eigentumseinwirkung als Hauptmerkmal der negativen Befugnisse des Baukunstwerkeigentümers zu subsumieren (dazu unten 3. Kapitel § 6 II., III.).
- Beschränkungen der Eigentumsrechte de lege lata: Das vorhergehende Kapitel zeigt auf, dass die (mittelbar) kommerzielle und im Einzelfall auch die nicht-kommerzielle Verwertung von Abbildungen eines Baukunstwerkes unter die Voraussetzungen der negativen Eigentümerbefugnisse subsumiert werden können (dazu unten 3. Kapitel § 7). Dadurch tritt der Konflikt zwischen dem Abbildungskünstler und dem Baukunstwerkeigentümer zum Vorschein: Der Abbildungskünstler begehrt die Verwertung der von ihm angefertigten Abbildungen des Baukunstwerkes, wohingegen der Baukunstwerkeigentümer ob seiner negativen Eigentümerbefugnisse entsprechende Ansprüche des Abbildungskünstlers abwehren kann. Das vierte Kapitel soll daher aufzeigen, ob die Befugnisse des Baukunstwerkeigentümers aufgrund bestehender Gesetze (dazu unten 4. Kapitel § 1) oder Rechte Dritter i.S.d. § 903 S. 1 BGB (dazu unten 4. Kapitel § 3) zu beschränken sind. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Stellung des Baukunstwerkeigentümers eines Museums, aus der sich das besondere Bedürfnis und weitergehende Möglichkeiten zur Beschränkung der Eigentumsrechte ableiten lassen. Besondere Bedeutung erlangen gleichfalls die schützenswerten Interessen des Abbildungskünstlers hinsichtlich der Verwertung von Abbildungen des Baukunstwerkes als auch die schützenswerten Interessen der Allgemeinheit am Zugang zur Kunst (dazu insbesondere unten 4. Kapitel § 2). Dieses Kapitel soll die unklare Rechtslage und die damit einhergehenden Unsicherheiten aufzeigen, die sich aus den verschiedenen Fallkonstellationen und den daraus resultierenden unterschiedlichen Beschränkungsmöglichkeiten ergeben (dazu unten 4. Kapitel § 4). Dieser Überblick über eigene Rechte und Pflichten verdeutlicht das Erfordernis einer gesetzgeberischen Intervention.
- Begründung einer legislativen Intervention de lege ferenda: Das fünfte Kapitel soll schließlich die Notwendigkeit einer legislativen Intervention begründen. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG verdeutlicht, dass für Beschränkungen des Eigentums eine gesetzliche Grundlage erforderlich ist (dazu unten 4. Kapitel § 1 I.). In diesem Kapitel werden daher zunächst eingehend die grundrechtlich geschützten Interessen des Baukunstwerkeigentümers (dazu unten 5. Kapitel § 1 I.) und die Interessen des Abbildungskünstlers (dazu unten 5. Kapitel § 1 II.) hinsichtlich einer das Eigentum beschränkenden Reglung dargestellt und anschließend in einer Interessenabwägung miteinander abgewogen (dazu unten 5. Kapitel § 1 III.). Verdeutlicht werden soll, dass gerade bei dem für die Allgemeinheit bedeutsamen Eigentum, wie einem Museum oder besonderem Kulturgut, der Zugang zur Kunst zu fördern ist und Eigentumsbeschränkungen in Form gesetzlicher Regelungen angezeigt sein können. Anschließend wird ein gesetzlicher Regelungsentwurf ausgearbeitet, der auf den erforderlichen Regelungsumfang reduziert werden soll, sodass die Rechtsprechung schützenswerte Interessen innerhalb der Eigentumsbeschränkungen auf zukünftig verfassungskonforme Weise berücksichtigen kann (dazu unten 5. Kapitel § 2). Das Kapitel schließt mit einer Ausführung zu den Rechtsfolgen der gesetzlichen Eigentumsbeschränkung (dazu unten 5. Kapitel § 3).
- Resumé und Ausblick: Die Arbeit findet ihren Abschluss in einer Zusammenfassung der herausgearbeiteten Ergebnisse und einem Ausblick darauf, welche Vorteile sich aus einer legislativen Intervention zukünftig ergeben.
1 BGH, Urt. v. 17.12.2010, V ZR 45/10, GRUR 2011, 323 (323 ff.); BGH, Urt. v. 17.12.2010, V ZR 44/10, ZUM 2011, 333 (333 ff.); BGH, Urt. v. 01.03.2013, V ZR 14/12, GRUR 2013, 623 (623 ff.).
2 BGH, Urt. v. 17.12.2010, V ZR 45/10.
3 BGH, Urt. v. 17.12.2010, V ZR 45/10, GRUR 2011, 323 (323).
Details
- Pages
- 412
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631924150
- ISBN (ePUB)
- 9783631924167
- ISBN (Hardcover)
- 9783631924129
- DOI
- 10.3726/b22171
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- Körperlichkeit Fühlungnahme Spannungsverhältnis Gemeinfreiheit Eigentumseinwirkung Gesetzgeberische Intervention Skulptur Malerei Film Fotografie Künstler Museum Architektur Baukunstwerk Kunstrecht Sachenrecht Eigentumsrecht Urheberrecht Zivilrecht
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 412 S. s/w Abb., 0 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG