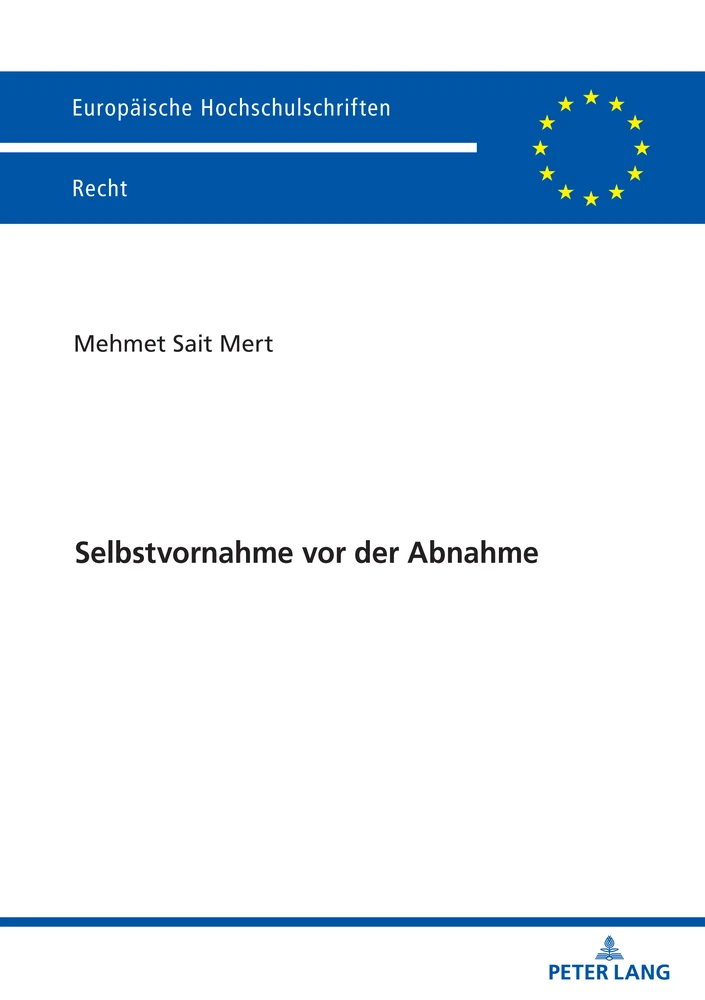Selbstvornahme vor der Abnahme
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Erster Abschnitt: Einleitung und Problemdarstellung
- A. Allgemeines
- B. Anlass der Untersuchung
- C. Die Dogmatik der Selbstvornahme
- I. Der Begriff Selbstvornahme
- II. Die Auswirkung der Selbstvornahme auf die Forderung
- III. Die Auswirkung der Selbstvornahme auf die Gegenleistung
- D. Der zeitliche Anwendungsbereich der allgemeinen Leistungsstörungsrechte
- I. Die Ansprüche des Bestellers aus dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht
- II. Die Entstehungszeit der Ansprüche aus dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht
- 1. Der Grundsatz: ab Fälligkeit des Erfüllungsanspruchs aus § 631 I BGB
- 2. Die Geltendmachung der Ansprüche vor Fälligkeit des Erfüllungsanspruchs durch § 323 IV BGB
- III. Zwischenergebnis und kritische Würdigung
- E. Der zeitliche Anwendungsbereich der Mängelrechte im BGB-Werkvertragsrecht
- I. Unterschiedliche Auffassungen über den zeitlichen Anwendungsbereich der werkvertraglichen Mängelrechte
- 1. Die Abnahme
- a. Die Lehrmeinungen
- b. Die Rechtsprechung
- i. OLG-Entscheidungen
- ii. BGH Urteile
- 2. Die Vollendung bzw. abnahmereife Herstellung
- 3. Der Fertigstellungstermin oder die Fälligkeit
- a. Die Lehrmeinungen
- b. Die Rechtsprechung
- 4. Der Herstellungsbeginn
- II. Die Auslegungsmethoden
- 1. Grammatische Auslegung
- 2. Historische Auslegung
- a. Das BGB von 1900
- b. Die Schuldrechtsmodernisierung 2002
- i. Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts
- ii. Die Schuldrechtskommission
- iii. Der Diskussionsentwurf
- iv. Der Gesetzesentwurf
- c. Modernisierung des Bauvertrags- bzw. Werkvertragsrechts durch das Reformgesetz 2018
- d. Zwischenergebnis
- 3. Systematische Auslegung
- a. Abschlagszahlungen nach § 632a BGB
- b. Die Kündigung nach § 648 BGB
- 4. Teleologische Auslegung
- a. Der Nacherfüllungsanspruch (§ 635)
- b. Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz (§ 636)
- c. Die Selbstvornahme (§ 637)
- d. Die Minderung (§ 638)
- e. Die Verjährung (§ 634a)
- f. Interessen der Vertragsparteien
- i. Die Belange des Unternehmers
- ii. Die Belange des Bestellers
- g. Zwischenergebnis der teleologischen Auslegung
- F. Die Erkenntnisse und kritische Würdigung de lege lata
- Zweiter Abschnitt: Die werkvertragliche Selbstvornahme vor der Abnahme
- A. Kostenfrage
- I. Die Auswirkungen der Mangelbeseitigung des Bestellers auf seine weiteren Mängelrechte
- 1. Die berechtigte Selbstvornahme
- 2. Die unberechtigte Selbstvornahme
- II. Die Frage nach dem abschließenden Charakter der Mängelrechte
- III. Ersatz der Kosten eigenmächtiger Selbstvornahme
- 1. Geschäftsführung ohne Auftrag
- a. Die Tatbestandsvoraussetzungen
- i. Fremdes Geschäft
- ii. Fremdgeschäftsführungswille
- iii. Geschäftsführung ohne Auftrag oder Befugnis
- b. Die Rechtsfolgen der echten Geschäftsführung
- 2. Ansprüche nach Bereicherungsrecht
- a. Die einschlägige Kondiktionsart
- i. Die Leistungskondiktion
- ii. Die Nichtleistungskondiktion
- b. Umfang des Bereicherungsanspruchs
- IV. Exkurs: Die eigenmächtige Selbstvornahme in anderen Rechtsbereichen
- 1. Mietvertrag
- 2. Selbsterfüllung bei außervertraglichen Verpflichtungen
- B. Ein strukturelles Problem des BGB-Werkvertragskonzepts
- I. Allgemeines
- II. Der Erfolgsbezug im Werkvertragsrecht
- 1. Die Entwicklung des Werkvertragsrechts
- 2. Der einmalige, punktuelle Leistungsaustausch
- 3. Die Bedeutung der Abnahme
- 4. Der funktionale Mangelbegriff
- III. Die Kehrseite des Erfolgsbezugs: die fehlende Rücksicht auf den Herstellungsprozess
- 1. Einzelne Regelungen zur Herstellungsphase
- a. Herstellungsprozess nach allgemeinen werkvertraglichen Vorschriften, § 631–650 BGB
- i. Sicherung des Vergütungsanspruchs
- ii. Einfluss auf den Herstellungsprozess
- iii. Werkvertragsspezifische Kündigungsrechte
- b. Herstellungsprozess nach baurechtlichen Vorschriften, § 650a- § 650h BGB
- i. Das Anordnungsrecht des Bestellers
- ii. Rechte des Unternehmers wegen seiner Vorleistungspflicht
- iii. Erleichterung der Rechtsdurchsetzung
- 2. Gegenüberstellung der VOB/B-Regelungen in Bezug auf die Herstellungsphase
- a. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
- b. Kontrollmechanismen während der Ausführung
- c. Die Änderungsanordnungen mit vergütungsrechtlichen Folgen
- d. Die Selbsthilferechte
- i. Selbsthilferechte bei der Kündigung
- ii. Selbsthilferecht vor der Ausführung
- iii. Selbsthilferecht wegen nicht-geschuldeter Leistungen
- e. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
- f. Gefahrverteilung während der Ausführung
- g. Zwischenergebnis
- 3. Die schwierige Einordnung der Werkausführung
- a. Der Charakter der Werkausführung
- b. Der Stellenwert der Tätigkeitspflicht
- IV. Selbstvornahme vor dem Fälligkeitszeitpunkt
- C. Die Erkenntnisse des zweiten Abschnitts
- Dritter Abschnitt: Selbstvornahmerecht während der Werkherstellung de lege ferenda
- A. Die bisherigen Lösungsvorschläge und ihre Bewertung
- I. Ergänzungsentwurf von Kraus, Vygen, Oppler
- II. Freiburger Ergänzungsentwurf aus 2001
- III. Empfehlungen des 3. Deutschen Baugerichtstages
- IV. Ergänzungen der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz
- V. Die Regelungsvorschläge in der Lehre
- 1. Der Vorschlag von Jansen
- 2. Der Vorschlag von Schlier
- VI. Bewertung der Vorschläge
- B. Das Schweizer OR als Vorbild – ein anderes Verständnis
- I. Die Regelungen zur Ersatzvornahme im Allgemeinen
- II. Das Schweizer Werkvertragsrecht
- 1. Die werkvertraglichen Gewährleistungsrechte des Bestellers
- 2. Die Funktion der Abnahme
- 3. Leistungsstörungsrechte vor Abnahme
- III. Die Ersatzvornahme im Werkvertragsrecht nach Art. 366 Abs. 2 OR
- 1. Rechtsnatur der Ersatzvornahmeregelung
- 2. Tatbestandsvoraussetzungen der Ersatzvornahme
- 3. Der zeitliche Anwendungsbereich
- 4. Rechtsfolgen
- IV. Zusammenfassende Schlussfolgerung
- C. Eigene Formulierung eines Gesetzesvorschlags
- I. Ausdrückliche Regelung des maßgeblichen Zeitpunkts für die Mängelrechte
- II. Rechtsbehelfe während der Herstellung
- Thesen
- Literaturverzeichnis
Erster Abschnitt: Einleitung und Problemdarstellung
A. Allgemeines
Werkverträge sind erfolgsbezogene Tätigkeitsverträge. Der Unternehmer verpflichtet sich, für den Besteller ein mangelfreies Werk herzustellen. Im Gegenzug verspricht der Besteller, eine Vergütung zu entrichten. Trotz der meist Zeit kostenden Werkherstellung hat der Werkvertrag nach herrschender Lehre einen einmaligen punktuellen Austauschcharakter,1 sodass er kein Dauerschuldverhältnis darstellt. Allerdings wird er oft als Langzeitvertrag beschrieben, weil die Ausführung des Werks, besonders bei Bauverträgen, lange dauert.2 Diese Eigenart und das Erfolgskonzept des Werkvertrages führen zu einer zeitlichen Trennung zwischen der Phase vor und nach der Abnahme.3 Sie wirkt sich auf den zeitlichen Anwendungsbereich der allgemeinen Leistungsstörungsrechte und der werkvertraglichen Mängelrechte aus.
Die werkvertraglichen Mängelrechte werden in §§ 634 ff. BGB aufgezählt: Der Besteller kann Nacherfüllung verlangen, die Mangelbeseitigung selbst vornehmen, Minderung und Rücktritt erklären sowie Schadensersatz fordern. Praktische Bedeutung haben unter all diesen Rechten vor allem der Nacherfüllungsanspruch und das Selbstvornahmerecht, weil der Besteller typischerweise ein größeres Interesse an der vertragsgemäßen Leistung hat als an der Vertragsauflösung. Das Selbstvornahmerecht ermöglicht dem Besteller, den von ihm gewünschten Zustand ohne den Unternehmer herbeizuführen.
Die Selbstvornahme erfolgt, indem der Besteller die Beseitigung eines Mangels am Werk eigenhändig übernimmt oder sie durch einen Dritten ausführen lässt. Auf diese Weise hält er den Unternehmer, mit dessen Leistung er unzufrieden ist, aus dem Arbeitsprozess heraus. Dagegen hat der Unternehmer ein Interesse daran, seinen eigenen Herstellungsplan zu verfolgen und nicht die Kosten für eine fremde Leistung tragen zu müssen. Das Konfliktpotential ist besonders groß, wenn die Selbstvornahme vor der Abnahme stattfinden soll. Aufgabe dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie hier eine sachgerechte Lösung gefunden werden kann.
B. Anlass der Untersuchung
Die Selbstvornahme wird in der Lehre meistens mit Blick auf das Kaufvertragsrecht behandelt; über die Selbstvornahme im Werkvertragsrecht, ihren Sinn und Zweck und besonders über ihre Struktur wird weniger gesprochen. Da der Besteller sich in der Praxis häufig voreilig einmischt, drehen sich die Diskussionen vor allem um den zeitlichen Anwendungsbereich der Mängelrechte.4 Im BGB gibt es hierzu keine ausdrückliche Regelung. Obwohl die herrschende Ansicht in der Lehre der Meinung ist, die werkvertraglichen Mängelrechte seien erst nach der Abnahme anwendbar, gibt es noch andere Auffassungen, die hierfür die Vollherstellung bzw. die abnahmereife Herstellung, den Fälligkeitstermin oder den Herstellungsbeginn als maßgeblich sehen.5
Die Rechtsprechung war in dieser Frage lange Zeit uneins; allerdings hat der BGH Anfang 2017 die Gelegenheit, die ihm gleich mehrere gleichgelagerte Fälle boten, genutzt und entschieden, dass eine Selbstvornahme erst nach der Abnahme möglich ist.6 Von der Literatur wird dies zum Teil als unbefriedigend empfunden.7 Außerdem hat der Gesetzgeber kurz danach, Anfang 2018, in gewissem Umfang die Selbstvornahme im Kaufrecht zugelassen,8 was die Diskussion erneut befeuert hat.
In dieser Arbeit wird zunächst die Struktur der Selbstvornahme dargelegt. Danach werden die dogmatischen Fragen, zum einen der zeitliche Anwendungsbereich des Rechts auf Selbstvornahme und des allgemeinen Leistungsstörungsrechts und zum anderen der Kostenersatz bei Selbstvornahme, behandelt. Im nächsten Kapitel sollen die rechtspolitischen Aspekte zum Thema vorgetragen und anschließend rechtsvergleichende Lösungsansätze entwickelt werden.
C. Die Dogmatik der Selbstvornahme
I. Der Begriff Selbstvornahme
Im deutschsprachigen Schrifttum gibt es viele Begriffe dafür, dass der Gläubiger den geschuldeten Erfolg einer ordnungswidrigen Vertragsdurchführung auf Kosten des Schuldners entweder selber herbeiführt oder durch einen Dritten herbeiführen lässt. Im Allgemeinen hat sich der Begriff „Selbstvornahme“ eingebürgert. Er ist allerdings nicht ganz unproblematisch. Denn er vermittelt den falschen Eindruck, dass es sich dabei um das Gegenstück zur Fremdvornahme handelt. Dies verdeutlicht den Bedarf nach einer passenden Terminologie.
In der Lehre wurden noch weitere und ähnliche Begriffe angewendet. Die „Eigenvornahme“ ist der Selbstvornahme insofern ähnlich, als die Wörter „eigen“ und „selbst“ austauschbar sind. Auch die „Eigenverbesserung“ und die „Selbstverbesserung“ unterscheiden sich von der Selbstvornahme nicht wesentlich. Sie sind ein wenig konkreter als die Selbstvornahme, denn sie verdeutlichen, dass es um einen Versuch zur Verbesserung des Zustandes geht. Zugleich decken sie aber nicht den Fall ab, in dem der Schuldner überhaupt nicht tätig wird und der Gläubiger die gesamte Leistung selbst herstellen muss. Außerdem wird in der Literatur von der „Selbsthilfe bzw. Selbstabhilfe“ gesprochen. Der Begriff der Selbsthilfe kann für den Leser missverständlich sein, weil er im BGB im Rahmen von §§ 229, 859 ff. vorkommt. Die Selbstabhilfe hingegen scheint passender zu sein. Sie deutet auf die Beseitigung des Grundes der Unzufriedenheit. Der Begriff Abhilfe ist übrigens in § 314 BGB sowie in dem Mietvertrags- und im alten Reisevertragsrecht zu finden. Damit besteht ein Bezug zu den Mängelrechten. Der Begriff „Selbsterfüllung“ wurde vor der Schuldrechtsmodernisierung für die Herbeiführung des geschuldeten Erfolges durch den Gläubiger verwendet.9 Dabei wurde zwar auf die materiellrechtliche Rechtsverwirklichung abgestellt. Die geschuldete Forderung wird aber eben nicht erfüllt. Schließlich wird in der Schweizer Rechtsprache die „Ersatzvornahme“ verwendet. Dieser Begriff scheint treffend zu sein,10 weil es sich beim Wort „Ersatz“ um eine Person oder Sache handelt, die anstelle einer anderen solchen eingesetzt wird. Beabsichtigt der Gläubiger mit seinem Tun oder mit der Beauftragung von Dritten, eine vertragsgemäße anstelle einer vertragswidrigen Durchführung einzusetzen, so findet damit eine Ersetzung statt.
Die genannten Begriffe werden häufig noch mit einem Adjektiv kombiniert, so wie die „eigenmächtige oder voreilige Selbstvornahme“11. Sie enthalten eine Bewertung und dienen meist dazu, das Tätigwerden des Gläubigers zu diskreditieren. Zu beachten ist dabei, dass nicht jede Selbstvornahme ohne vorherige Fristsetzung eine eigenmächtige oder voreilige Selbstvornahme darstellt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Fristsetzung nach § 637 II entbehrlich ist. Daher wird der Begriff „eigenmächtige Selbstvornahme“ in dieser Arbeit hauptsächlich für solche Fälle angewendet, in denen der Gläubiger bei den Mangelbeseitigungsarbeiten den Vorrang der Nacherfüllung missachtet.
Weil der Begriff Selbstvornahme im deutschen Recht üblich geworden ist, soll er auch in dieser Arbeit Verwendung finden. Bei einer neuen Regelung wäre aber wünschenswert, dass sich der Gesetzgeber einer anderen Terminologie bedient.
II. Die Auswirkung der Selbstvornahme auf die Forderung
Eine erfolgreich durchgeführte Selbstvornahme führt zur Beseitigung des Leistungsdefizits, indem der versprochene Werkerfolg durch den Besteller oder dessen Beauftragten herbeigeführt wird. Damit muss die Forderung des Bestellers erlöschen.12 Fraglich ist, wie sich dieses Ergebnis herleiten lässt.
Zunächst bietet sich die Annahme einer Erfüllung gemäß § 362 I BGB an. In diesem Fall erlischt das Schuldverhältnis, „wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird“. Trotz insoweit nicht eindeutigen Wortlauts der Vorschrift erfordert dies, dass der versprochene Erfolg durch die Leistung des Schuldners herbeigeführt werden soll. So wird nicht nur dem Leistungsinteresse des Gläubigers Rechnung getragen, sondern auch dem tilgungsrechtlichen Interesse des Schuldners.13 Da die Selbstvornahme nicht durch die eigene Leistung des Schuldners stattfindet, scheidet § 362 I also aus.14
Auch eine Deutung als Leistung durch Dritte gemäß § 267 scheidet aus.15 Dritter im Sinne der Vorschrift kann nicht der Gläubiger selbst sein, denn wenn dieser einen anderen mit der Mangelbeseitigung beauftragt, erfolgt die Leistung auf eine eigene Schuld des Dritten gegenüber dem Gläubiger. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt der objektiven Theorie stellt, wonach zum Eintritt der Erfüllungswirkung schon die Identität von Schuld und Leistung genügen soll,16 gelingt die Anwendung von §§ 267, 362 nicht reibungslos. Es kann für die Zuordnung nämlich keine Rolle spielen, ob der Besteller selbst die Mängel beseitigt oder dies einem Auftragnehmer überlässt.
Des Weiteren könnte zwar zumindest im Hinblick auf den nach § 637 I geschuldeten Aufwendungsersatz eine Leistung an Erfüllungs Statt gemäß § 364 vorliegen. Hierfür fehlt es im Fall der Selbstvornahme aber an der erforderlichen Vereinbarung, durch die dem Schuldner eine Ersetzungsbefugnis eingeräumt wird. Im Wege der Selbstvornahme erlangt der Gläubiger nur das, was er ohnehin bekommen sollte, nur nicht infolge der Leistung des Schuldners, und die Aufwendungen sind Gegenstand einer dem Schuldner aufoktroyierten Pflicht.
Als Erlöschungsgrund bei Selbstvornahme wird außerdem die Unmöglichkeit der Leistung erwogen.17 Sie bietet sich aber deshalb nicht an, weil es sich ja um eine vom Gläubiger verursachte Störung der Leistung handelte. Die hierfür einschlägigen Regelungen in §§ 323 Abs. 6, 326 Abs. 2 folgen dem Grundgedanken, dass der aus der Unmöglichkeit resultierende Nachteil auf den Gläubiger abgewälzt werden soll. Dies kommt bei der Selbstvornahme aber keinesfalls in Betracht.
Findet sich im BGB kein passender Ansatzpunkt, könnte sich eine Lösung durch einen Blick auf das Pendant der Selbstvornahme im Vollstreckungsrecht ergeben. Auch hier ist man sich aber nur darüber einig, dass die nach § 887 ZPO vollstreckte Forderung erlischt. Worauf dies beruht, ist umstritten. Nach einer Ansicht kommt § 362 BGB zum Zuge,18 wobei im Fall einer Ersatzvornahme durch Dritte noch auf § 267 BGB verwiesen wird.19 Eine direkte Anwendung von § 362 hierauf erscheint aber fragwürdig. Denn weder hat der Schuldner freiwillig geleistet, noch kann er über die Tilgung seiner Schuld bestimmen. Eine andere Auffassung rekurriert auf die Vorschriften der ZPO, in denen die Tilgung der vollstreckten Forderung erwähnt oder zumindest angedeutet ist. Es handelt sich um §§ 815, 819, 897 ZPO.20 Bei der Ersatzvornahme können sie jedenfalls nicht unmittelbar zur Anwendung kommen. Denn sie betreffen nicht die Vornahme vertretbarer Handlungen, sondern regeln nur die Wirkungen einer Wegnahme gepfändeten Geldes oder einer herauszugebenden Sache sowie die Ablieferung eines Versteigerungserlöses. Sieht man hierin nicht nur Bestimmungen über den Gefahrübergang, kann man sie als Erfüllungsfiktionen ansehen.21 Vergleichbar ist die Fiktion, die § 894 ZPO bei der Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung anordnet. In § 887 ZPO kann man eine vergleichbare Fiktion dadurch bestimmt sehen, dass die Ersatzvornahme „auf Kosten des Schuldners“ erfolgen soll.22 Der durch die Zwangsvollstreckung bewirkte Erfolg wird dem Schuldner kraft Gesetzes und ohne Tilgungsbestimmung zugerechnet, sodass seine Schuld erlischt.23
Dieser Ansatz lässt sich auch auf die Selbstvornahme gemäß § 637 übertragen. Ebenso wie die Ersatzvornahme im Rahmen der Zwangsvollstreckung bezweckt die Selbstvornahme im Werkvertragsrecht die Befriedigung des Gläubigerinteresses ohne Beitrag des Schuldners. Dessen Tilgungsbestimmung wird dadurch ersetzt, dass dem Gläubiger die Befugnis zur Selbstvornahme eröffnet ist.
Erfolgt die Selbstvornahme unter Missachtung der Voraussetzungen von § 637 eigenmächtig, scheidet die Erfüllungsfiktion aus. Umstritten ist in diesem Fall, ob eine voreilige Selbstvornahme zu einer Unmöglichkeit führt. Nach einer Ansicht ist dies zu bejahen, weil das Leistungsdefizit infolge des Eingriffs des Bestellers nicht mehr beseitigt werden kann.24 Dieser Lösung kann nicht vorbehaltlos zugestimmt werden. Denn der Unternehmer kann die Mangelbeseitigung gemäß § 635 nach seiner Wahl durch die Nachbesserung oder Neuherstellung bewirken. Die Unmöglichkeit betrifft höchstens eine der beiden Varianten.25 Deshalb muss für die andere Form der Mängelbeseitigung auf die Figur der Zweckerreichung zurückgegriffen werden.26 Sie zeitigt nach allgemeiner Auffassung die Folgen einer Unmöglichkeit,27 weshalb § 275 I dann doch den Erlöschenstatbestand für beide Varianten der Mangelbeseitigung darstellt.
III. Die Auswirkung der Selbstvornahme auf die Gegenleistung
Geht man von einer Fiktion der Erfüllung aus, lässt diese die Gegenleistung ebenso unberührt wie der reguläre Tatbestand von § 362. Der Unternehmer behält seinen Anspruch auf Vergütung, dem aber der Anspruch des Bestellers auf Ersatz der bei der Selbstvornahme angefallenen Aufwendungen gegenübersteht. Erfolgt die Selbstvornahme eigenmächtig, ergeben sich die Konsequenzen für den Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aus § 326 II. Da der Besteller für die Unmöglichkeit und Zweckerreichung verantwortlich ist, behält der Unternehmer ebenfalls seinen Anspruch auf Vergütung, ist aber nicht zum Aufwendungsersatz verpflichtet und muss sich nur seine Ersparnis und anderweitigen Erwerb anrechnen lassen.
Gegen diese Lösung lässt sich freilich einwenden, dass der BGH in der parallelen Situation beim Kaufvertrag strikt auf dem Vorrang der Nacherfüllung beharrt und dem Käufer, der voreilig selbst einen Mangel beseitigt, jeglichen Ausgleich versagt.28 Denn der Verkäufer verliert dabei nicht nur sein zweites Andienungsrecht, sondern auch die Möglichkeit, das Bestehen und Vorliegen sowie die Ursache des Mangels festzustellen. Hält man dies für richtig,29 kommt man kaum umhin, ebenso beim Werkvertrag zu verfahren. Dies bedeutet, dass der Anspruch auf den Werklohn in voller Höhe erhalten bleibt.
D. Der zeitliche Anwendungsbereich der allgemeinen Leistungsstörungsrechte
I. Die Ansprüche des Bestellers aus dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht
Der Besteller hat zunächst einen Erfüllungsanspruch auf die Herstellung des Werkes, § 631 I i.V.m. § 241 I 1. Erbringt der Unternehmer seine Pflicht trotz Fristsetzung nicht oder nicht vertragsgemäß, so stehen dem Besteller folgende Ansprüche aus dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht zur Verfügung: Schadensersatz neben der Leistung nach § 280 I, Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 281 und 280, Schadensersatz wegen der Verzögerung der Leistung §§ 280 II, 286 und die Rücktrittsrechte nach § 323. Da die Rückabwicklung oder der Wertersatz bei langzeitigen Bauarbeiten zu evident ungerechten Ergebnissen führen, kann das Rücktrittsrecht unter Umständen auch durch das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund nach § 314 verdrängt werden.30 Neben diesen allgemeinen Leistungsstörungsrechte steht dem Besteller seit 2018 noch ein Kündigungsrecht nach § 648a zur Verfügung, „wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht zugemutet werden kann“31.
Erforderlich ist jeweils das Vorliegen einer Pflichtverletzung. Sowohl § 281 I als auch § 323 I knüpfen daran an, dass eine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbracht wird. Der Mangel einer Leistung ist als Pflichtverletzung zu verstehen. Darüber hinaus setzen Ansprüche aus §§ 280 ff., 314 und § 323 voraus, dass der Besteller dem Unternehmer zur vertragsgemäßen Erfüllung eine angemessene Frist setzt. Allerdings kann die Fristsetzung zuweilen entbehrlich sein, §§ 281 II, 323 II und § 314 II 2. Außerdem muss der Schuldner im Fall der Schadensersatzansprüche nach §§ 281 I, 280 I die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein solches Vertretenmüssen wird jedoch nach § 280 I 2 vermutet. Schließlich darf kein Ausschlussgrund vorliegen. Ein solcher ist gem. § 281 I 3 und § 323 V 2 hinsichtlich des Anspruchs auf Schadenersatz statt der Leistung und des Rücktritts- bzw. Kündigungsrechts gegeben, wenn die Pflichtverletzung nur unerheblich ist. Übrig bleibt dann lediglich der Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung. Ist der Besteller für die Pflichtverletzung überwiegend oder allein verantwortlich oder ist ihm mangelnde Vertragstreue vorzuwerfen, so ist das Rücktrittsrecht nach § 323 VI als ausgeschlossen anzusehen.
Details
- Seiten
- 166
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631925744
- ISBN (ePUB)
- 9783631925751
- ISBN (Paperback)
- 9783631925614
- DOI
- 10.3726/b22266
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Oktober)
- Schlagworte
- VOB/B § 887 ZPO § 637 BGB voreilig eigenmächtig privates Baurecht Werkvertrag Bereicherungsrecht Schadensersatz Aufwendungsersatz Ersatzvornahme Selbstvornahme
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 166 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG