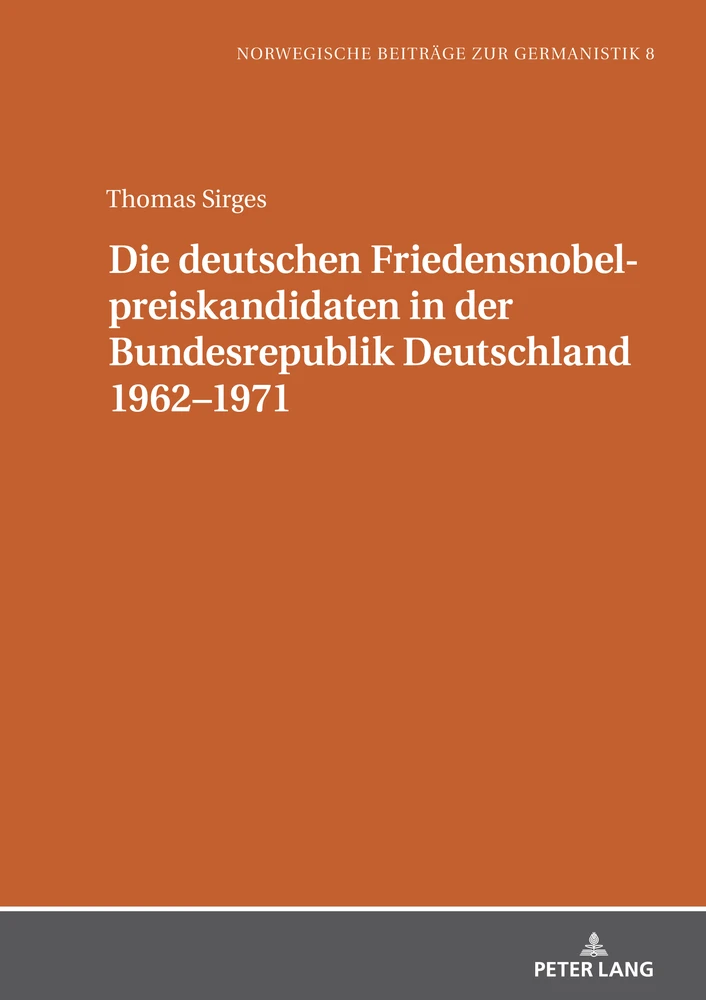Die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in der Bundesrepublik Deutschland 1962–1971
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Deutsche Friedensnobelpreiskandidaten als Forschungsthema
- Der Friedensnobelpreis und die Deutschen
- 1. Kandidaten
- 2. Vorschläge
- 3. Nobelkomitee
- 3.1. Vorauswahl
- 3.2. Gutachten
- 3.3. Entscheidungen
- 4. Öffentliche Reaktionen
- Die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in Einzelporträts
- I. Personen
- 1. Ernst Bloch
- 2. Willy Brandt
- 3. Friedrich Wilhelm Foerster
- 4. Heinrich Grüber
- 5. Kurt Hahn
- 6. Martin Niemöller
- 7. Friedrich Siegmund-Schultze
- 8. Fritz v. Unruh
- II. Institutionen
- 1. Internationales Jugend-Festspieltreffen Bayreuth
- Anhang
- Abkürzungen
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Nachweis der Abbildungen
- Namenregister
- Gesamtregister der deutschen Friedensnobelpreis- kandidaten 1901–1971
- Reihenübersicht
Thomas Sirges
Die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in der Bundesrepublik Deutschland 1962–1971
 Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford
Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Drucklegung erfolgte mit Unterstützung des Instituts für Literatur, Kulturkunde und europäische Sprachen der Universität Oslo.
ISSN 2566-5529
ISBN 978-3-631-92203-3 (Print)
E-ISBN 978-3-631-92528-7 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-92529-4 (E-PUB)
DOI 10.3726/b22233
© 2024 Peter Lang Group AG, Lausanne
Verlegt durch Peter Lang GmbH, Berlin, Deutschland
info@peterlang.com http://www.peterlang.com
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Autorenangaben
Thomas Sirges ist Professor für Deutsche Kulturkunde am Institut für Literatur, Kulturkunde und europäische Sprachen der Universität Oslo.
Über das Buch
Die Verleihung des Friedensnobelpreises von 1971 an Willy Brandt überraschte damals viele Deutsche. Doch das norwegische Nobelkomitee einte die Überzeugung, dass niemand im Jahr zuvor mehr für den Frieden in der Welt geleistet hatte als der deutsche Bundeskanzler. Über diesen Erfolg sollten jedoch die übrigen deutschen Friedensnobelpreiskandidaten der Jahre von 1962 bis 1971 nicht vergessen werden. Auch Ernst Bloch, Friedrich Wilhelm Foerster, Heinrich Grüber, Kurt Hahn, Martin Niemöller, Friedrich Siegmund-Schultze, Fritz v. Unruh und das von Herbert Barth ins Leben gerufene Internationale Jugend-Festspieltreffen Bayreuth haben sich um das Ansehen Deutschlands in der Welt verdient gemacht.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Deutsche Friedensnobelpreiskandidaten als Forschungsthema1
Die Verleihung des Friedensnobelpreises von 1971 an Willy Brandt überraschte damals viele Deutsche. Doch das norwegische Nobelkomitee einte die Überzeugung, dass niemand im Jahr zuvor mehr für den Frieden in der Welt geleistet hatte als der deutsche Bundeskanzler. Über diesen Erfolg sollten jedoch die übrigen deutschen Friedensnobelpreiskandidaten der Jahre von 1962 bis 1971 nicht vergessen werden. Auch Ernst Bloch, Friedrich Wilhelm Foerster, Heinrich Grüber, Kurt Hahn, Martin Niemöller, Friedrich Siegmund-Schultze, Fritz v. Unruh und das von Herbert Barth ins Leben gerufene Internationale Jugend-Festspieltreffen Bayreuth haben sich um das Ansehen Deutschlands in der Welt verdient gemacht.2
Obwohl es sich bei diesen Kandidaten – mit Ausnahme von Herbert Barth – um Persönlichkeiten handelt, die aus der biographischen und zeitgeschichtlichen Literatur gut bekannt sind, ist bislang nur der Friedensnobelpreis für Willy Brandt eingehender untersucht worden.3 Darüber hinaus haben sich knappe Hinweise in der Literatur nur zu Kurt Hahn,4 Martin Niemöller5 und Fritz v. Unruh6 gefunden. Ergänzend sei aber darauf hingewiesen, dass Friedrich Wilhelm Foerster7 und Friedrich Siegmund-Schultze8 bereits früher für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden waren und in den betreffenden Bänden des Verfassers über die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten vertreten sind.
Methodisch knüpft diese Studie über die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in der Bundesrepublik Deutschland von 1962 bis 1971 an das Vorbild der vier Vorgängerstudien für den Zeitraum seit 1901 an. Sie bildet zugleich den Abschluss des gesamten Projektes, das mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an Bundeskanzler Willy Brandt als vorläufiger Höhepunkt in der Geschichte der deutschen Friedensnobelpreiskandidaten endet – immerhin hat es seit mehr als einem halben Jahrhundert keinen deutschen Preisträger mehr gegeben. Wichtigste Grundlage auch dieser Studie bilden die im norwegischen Nobelinstitut (Det Norske Nobelinstitutt (NNI)) vorliegenden Vorschlagsschreiben, der einschlägige Postverkehr sowie die im Auftrag des Nobelkomitees angefertigten Gutachten (Redegjørelser).9 Mit Gewinn konnten auch wieder norwegische und deutsche Zeitungen herangezogen werden. Letztere dienten in der Hauptsache dazu, die deutschen Reaktionen auf die Verleihung der Friedensnobelpreise nachzuverfolgen. Mit Ausnahme des Preises für Willy Brandt, für den die Zeitungsausschnittsammlungen der Pressedokumentation des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (Bundespresseamt) und des Archivs der sozialen Demokratie (AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zur Verfügung standen, musste allerdings eine Beschränkung auf die kommerziellen Zeitungsarchive der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung erfolgen. Die norwegischen Zeitungen, die mittlerweile nahezu vollständig in digitalisierter Form einsehbar sind, dienten wiederum in der Hauptsache dazu, dem Bekanntheitsgrad und dem Ansehen der deutschen Kandidaten in Norwegen nachzuspüren.10 Da der Bekanntheits- und Popularitätsgrad eine nicht geringe Rolle im Entscheidungsprozess des Nobelkomitees gespielt hat – sowohl bei der Erstellung der Shortlist als auch bei der Wahl der Preisträger –, ergeben sich dadurch Anhaltspunkte für die Beurteilung der deutschen Kandidaten. Gleichwohl muss an dieser Stelle wiederholt gesagt werden, dass es aufgrund nicht vorhandender Protokolle von den Sitzungen des Nobelkomitees nicht möglich ist, den Entscheidungsprozess im Einzelnen nachzuvollziehen – ausgenommen es finden sich private Aufzeichnungen einzelner Komiteemitglieder, was aber hier nicht der Fall ist. Um die Beschlüsse des Nobelkomitees zu verstehen, ist die Forschung also auf Begründungen, Laudationes, Gutachten und Hinweise aus der Presse angewiesen.
Der dreiteilige Aufbau des Buches folgt auch diesmal dem bei den Vorgängerbänden eingeschlagenen Weg. Der erste Teil fasst die wichtigsten Ergebnisse zur Geschichte der deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in der Bundesrepublik von 1962 bis 1971 in systematisch-vergleichender Form zusammen, wobei auch punktuelle Vergleiche mit der vorhergehenden Periode von 1946 bis 1961 gezogen werden. Ergänzt wird der erste Teil mit einer Darstellung der Berichterstattung der beiden westdeutschen Zeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung über die Friedensnobelpreise. Der zweite Teil enthält kurze Biographien der Kandidaten mit Schwerpunkt auf ihren friedens- politischen Idealen und Aktivitäten sowie ihrer Kandidatur. Dabei werden auch die Motive und Intentionen der Antragsteller und Unterstützer wiederum eingehend untersucht. Der dritte Teil rundet schließlich die Studie mit ausgewählten Dokumenten zu den deutschen Kandidaten ab.11
1 Auch für diesen Band gilt ein weiteres Mal mein besonderer Dank den Kollegen Dr. Anneliese Pitz und Prof. John Ole Askedal für ihre Durchsicht des Manuskripts.
2 Diese Liste enthält drei exilierte deutsche Kandidaten, die zum Zeitpunkt ihrer Nominierung eine andere Staatsbürgerschaft besaßen: Friedrich Wilhelm Foerster hatte die französische, Kurt Hahn die britische und Fritz v. Unruh die amerikanische Staatsbürgerschaft. Von dem Nobelkomitee und seinen Gutachtern sind aber aller drei weiterhin als Deutsche angesehen worden. – Zu der Zeit von 1946 bis 1961 vgl. Thomas Sirges: Die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in der Besatzungszeit, in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR 1946–1961. Berlin: Peter Lang, 2023.
3 Vgl. Thomas Sirges u. Robin M. Allers: „20. Oktober 1971 – Friedensnobelpreis für Willy Brandt. Deutsche und norwegische Reaktionen auf ein Politikum“, in: Thomas Sirges u. Birgit Mühlhaus (Hgg.): Willy Brandt. Ein deutsch-norwegisches Politikerleben im 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2002, S. 135–164 (mit einem Bildteil), und Thomas Sirges: „Willy Brandt – Friedensnobelpreis für einen Versöhnungspolitiker“, in: ders.: Die deutschen Friedensnobelpreisträger Gustav Stresemann, Ludwig Quidde, Carl von Ossietzky und Willy Brandt. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2013, S. 195–247 (mit einem Bildteil). Ergänzend ist jetzt das nach Ablauf der Sperrfrist zugängliche Archivmaterial aus dem Nobelinstitut (NNI) – Vorschläge, Briefe und Gutachten – einbezogen worden. Es hat sich gezeigt, dass die Zeitungen, die damals die empirische Grundlage unserer Studie abgegeben haben, recht gut unterrichtet waren.
4 Vgl. Peter Friese: Kurt Hahn – Leben und Werk eines umstrittenen Pädagogen. Bremerhaven (Selbstverlag) 2000, S. 252. Dem Autor zufolge soll die Nominierung Hahns durch die Philosophische Fakultät der Universität Tübingen für den Friedensnobelpreis auf Anregung von Golo Mann erfolgt sein. Eine entsprechende Anfrage an das Universitätsarchiv ist jedoch ergebnislos geblieben.
5 Vgl. Fredrik S. Heffermehl: Medaljens bakside. Nobels fredspris – hundre års ubrukte muligheter. [Die andere Seite der Medaille. Friedensnobelpreis – hundert Jahre ungenutzte Chancen.] Rånåsfoss: Svein Sandnes, 2020, S. 266–267. Der norwegische Jurist vertritt die Ansicht, dass Martin Niemöller einen mit War Resisters International (WRI) geteilten Preis verdient gehabt hätte, „weil er ein überzeugter Pazifist, ein Gegner atomarer Waffen und ein Vorkämpfer des Gewaltverzichts geworden war.“ (Ebd.) Das alles trifft sicher auf Niemöller zu – aber eben auch auf viele andere Pazifisten. Für das Nobelkomitee waren das keine ausreichenden Kriterien.
6 Vgl. Karola Schulz: Fast ein Revolutionär. Fritz von Unruh zwischen Exil und Remigration (1932–1962). München: Iudicium-Verlag, 1995, S. 46 (Anm. 169), und Hans Joachim Schröder: „Fritz von Unruh (1885–1970) – Kavallerieoffizier, Dichter und Pazifist“, in: Wolfram Wette (u.M.v. Helmut Donat) (Hg.): Pazifistische Offiziere in Deutschland 1871–1933. Bremen: Donat, 1999, S. 319–337, hier: S. 333.
7 Vgl. Thomas Sirges: Die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in der Weimarer Republik 1919–1933. Berlin: Peter Lang, 2020, S. 119–133, ders.: Die deutschen Friedensnobelpreiskandidaten in der Zeit des Nationalsozialismus 1934–1945. Berlin: Peter Lang, 2021, S. 61–67, und ders.: a.a.O., 2023, S. 119–143.
8 Vgl. ders.: a.a.O., 2020, S. 229–243.
9 Kursivierungen in Zitaten zeigen Hervorhebungen im Original an. S-Laute wurden der zeitgemäßen Rechtschreibung angepasst. Die Umlaute Ae/ae, Oe/oe, Ue/ue erscheinen als Ä/ä, Ö/ö und Ü/ü. In runde Klammern gesetzte Auslassungen entsprechen dem Originaltext. In eckige Klammern gesetzte Auslassungen und Zusätze stammen vom Verfasser. Offensichtliche Schreib-, Druck- und Zeichensetzungsfehler in den Originaltexten wurden stillschweigend verbessert, abweichende Namensschreibungen ausgeglichen und Abkürzungen in der Regel aufgelöst. Bei der Übersetzung fremdsprachiger Zitate ist auf eine Anzeige von Wortumstellungen verzichtet worden.
10 Es wäre mehr als wünschenswert, wenn es auch im föderalen Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft möglich wäre, den gedruckten Zeitungsbestand in digitalisierter Form für Forschungs- und Dokumentationszwecke kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
11 Damit das Buch auch als Nachschlagewerk genutzt und die Kandidatenporträts selbstständig gelesen werden können, ließen sich Wiederholungen nicht gänzlich vermeiden. Das betrifft vor allem die Nennung der Friedensnobelpreisträger im Zusammenhang mit den Entscheidungen des Nobelkomitees.
1. Kandidaten
In den zehn Jahren von 1962 bis 1971 gingen – einschließlich der mehrfach vorgeschlagenen Kandidaten – 414 Nominierungen ein, die sich auf 326 Personen und 88 Institutionen bzw. Organisationen verteilten. Im Jahresdurchschnitt konnte also das norwegische Nobelkomitee aus 41,4 Kandidaten auswählen. Das war eine deutliche Steigerung gegenüber dem vorhergehenden Berichtszeitraum von 1946 bis 1961, in dem der Jahresdurchschnittswert bei 29,3 Kandidaten gelegen und erst 1961 die 40er-Grenze überschritten hatte. Jetzt kam der Spitzenwert auf 51 Kandidaten im Jahre 1963, wohingegen sich die Tiefstwerte bei 31 bzw. 33 Kandidaten in den Jahren 1965/66 bewegten. In den übrigen Jahren lag aber die Kandidatenzahl fünf Mal deutlich über und nur zwei Mal leicht unter dem Durchschnittswert, was den ansteigenden Trend bekräftigt:
Details
- Pages
- 426
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631925287
- ISBN (ePUB)
- 9783631925294
- ISBN (Hardcover)
- 9783631922033
- DOI
- 10.3726/b22233
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Deutschland Geschichte des Friedensnobelpreises Deutsche Friedensnobelpreiskandidaten Geschichte 1962-1971
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 426 S., 9 s/w Abb., 8 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG