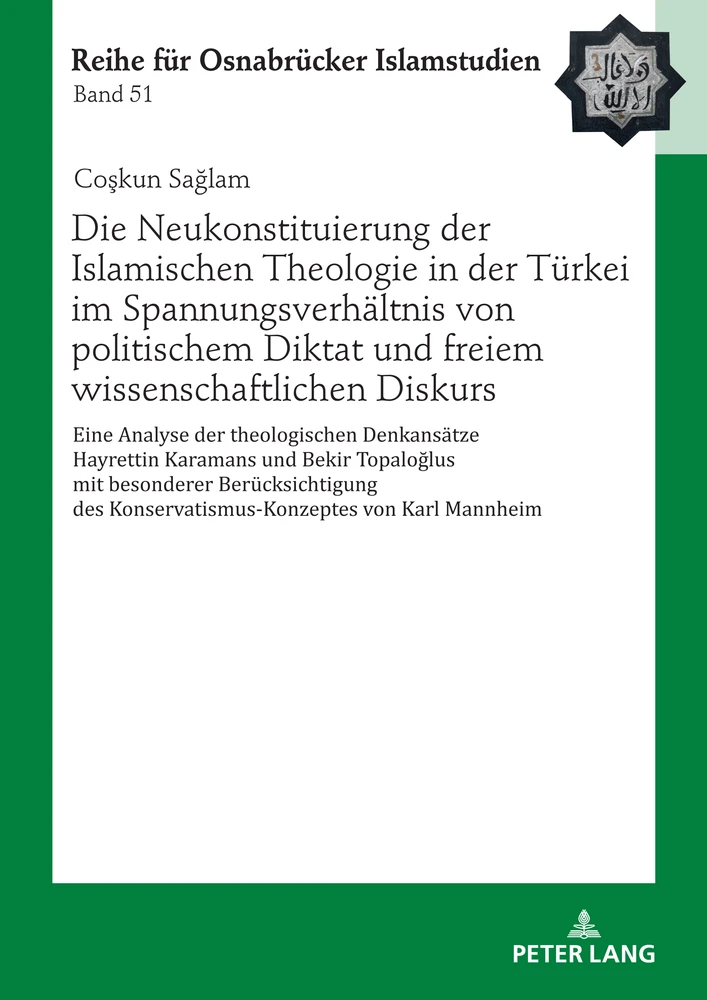Die Neukonstituierung der Islamischen Theologie in der Türkei im Spannungsverhältnis von politischem Diktat und freiem wissenschaftlichen Diskurs
Eine Analyse der theologischen Denkansätze Hayrettin Karamans und Bekir Topaloğlus mit besonderer Berücksichtigung des Konservatismus-Konzeptes von Karl Mannheim
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Vorwort & Danksagung
- 1. Einleitung
- 1.1 Hintergrund zur Einführung der Islamischen Theologie in Deutschland
- 1.2 Muslime in Deutschland
- 1.3 Authentizität vs. Relativismus
- 1.4 Gehört der Islam zur Türkei?
- 1.5 Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit
- 2. Islamische Theologie – Entstehung und Entwicklung des höheren religiösen Bildungssystems
- 2.1 Das Ende der charismatischen Prophetie und die anschließenden Kontroversen
- 2.2 Murǧiʾa, Qādirīya, Muʿtazila, Ašʿarīya, Māturīdīya und Ḫāriǧīya: Die ersten theologischen Dispute vor dem Hintergrund der stammesgeschichtlichen Zugehörigkeit der Strömungen
- 2.3 Koranexegese und Hadithwissenschaft
- 2.4 Die Integration der griechischen Philosophie in die islamische Wissenschaftstradition und heterogene Ansätze
- 2.5 Reformbewegungen durch die Konfrontation mit der Moderne und ihre Auswirkungen auf die islamische Theologie
- 2.6 Modernisierungsdruck auf das islamische Bildungswesen
- 3. Historische Entwicklung islamisch-theologischer Einrichtungen in der Türkei
- 3.1 Makātib: Die Anfänge der Institutionalisierung der islamischen Bildungseinrichtungen im Osmanischen Reich
- 3.2 Medresensystem als höheres Bildungswesen im Osmanischen Reich und der Lehrplan ausgewählter Medresen
- 3.3 Stagnation des höheren Bildungswesens
- 3.4 Erste Initiativen zur Reform des Bildungswesens infolge der Initiative Maarif-i Umumiye Nezareti
- 3.5 Ausdifferenzierung des Bildungssystems im Kontext der Reformprozesse
- 3.6 Die Tanzimat-Periode unter Abdulhamit II.
- 3.7 Niedergang des Osmanischen Reiches und Gründung der türkischen Republik: Reform des (religiösen) Bildungswesens im Zuge des staatlich initiierten Säkularismus
- 3.8 Verdrängung der Religion aus der öffentlichen Sphäre und Konsequenzen für das islamische Bildungswesen (Islam und Moderne)
- 3.8.1 Heterogenisierung der politischen Landschaft im Kontext der Herausforderungen der Moderne für das Osmanische Reich
- 3.8.2 Zwischen Säkularen und Traditionalisten: Politische Machtergreifung der westlich orientierten Elite im Übergang vom Osmanischen Reich zur modernen Türkei und intellektuelle Gegenkonzepte der ıslamcı
- 3.8.3 Ent-Islamisierung des Staates und der Öffentlichkeit: Machtkonsolidierung der Säkularen und Durchsetzung des laizistischen Paradigmas
- 3.9 Pragmatismus und kontrollierte Revitalisierung religiöser Institutionen: Paradigmenwechsel in der laizistischen türkischen Republik
- 4. Die Gründung der theologischen Fakultäten zur Förderung eines modernen Islamverständnisses
- 4.1 Gründung der Theologischen Fakultät Ankara
- 4.1.1 Erster Lehrplan 1949/50
- 4.1.2 Personelle Herausforderungen und der Lehrplan von 1955/56
- 4.1.3 Der Lehrplan 1972/73 und seine konzeptionelle Entwicklung bis 1980
- 4.2 Yüksek Islam Enstitüsü Istanbul – Der Grundstein für die Theologische Fakultät Marmara
- 4.2.1 Geistige Väter der Yüksek İslam Enstitüsü und ihre Zielsetzungen
- 4.2.2 Lehrplan des Yüksek İslam Enstitüsü Istanbul – 1959/60
- 4.2.3 Yüksek İslam Enstitüsü 1979/80
- 4.2.4 Der Militärputsch 1980 und die Transformation der Islaminstitute in theologische Fakultäten
- 4.2.5 Die Sozialstruktur der Studierenden an den neu gegründeten Fakultäten für Islamische Theologie sowie die neuen Lehrpläne
- 4.2.6 Die Organisationsstruktur der theologischen Fakultäten und die Frage des Theorie-Praxis-Transfers
- 5. Zwischenfazit
- 6. Das Konzept Konservatismus von Karl Mannheim, forschungsleitende Fragen und Methodik der Untersuchung
- 6.1 Karl Mannheim – Bedeutung und zentrale Thesen
- 6.2 Das Konzept Konservatismus von Karl Mannheim am Beispiel der Türkei
- 7. Innovation in Tradition: Die Neukonstituierung der islamischen Wissenschaften durch Hayrettin Karaman und Bekir Topaloğlu im Spannungsverhältnis von politischem Diktat und freiem wissenschaftlichen Diskurs
- 7.1 Hayrettin Karaman und seine Rolle im Diskurs um den iǧtihād in der Türkei
- 7.1.1 Die Biographie und der akademische Werdegang von Hayrettin Karaman
- 7.1.2 Die Bedeutung der Rechtsschulen
- 7.1.3 Modernistische Entwicklungen im Zuge des Niedergangs des Osmanischen Reiches
- 7.1.4 Übersetzung von Riḍās Werk
- 7.1.5 Karamans Buch Islam Hukukunda Ictihad
- 7.1.6 Traditionalistische Reaktionen auf die theologischen Methoden Karamans
- 7.1.7 Gesellschaftspolitische und theologische Positionen Hayrettin Karamans zu kontrovers geführten Disputen
- 7.1.7.1 Frauen
- 7.1.7.2 Polygamie und Zwangsehe
- 7.1.7.3 Gewalt gegen Frauen
- 7.1.7.4 Politik – Terror
- 7.1.7.5 Apostasie
- 7.1.7.6 Demokratie und Laizismus
- 7.1.7.7 Karamans Nähe zur Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
- 7.1.8 Schlussbetrachtungen zu Hayrettin Karaman
- 7.2 Bekir Topaloğlu
- 7.2.1 Biografie und akademischer Werdegang Topaloğlus
- 7.2.2 ʿIlm al-Kalām und die islamische Metaphysikdebatte
- 7.2.3 Salafīya
- 7.2.4 Die Positionierung zur Muʿtazila
- 7.2.4.1 Das Konzept des tawḥīd
- 7.2.4.2 ʿAdl
- 7.2.4.3 Al-Waʿd wa-l-waʿīd
- 7.2.4.4 Manzila bayna l-manzilatayn
- 7.2.4.4 Al-amr bi-l-maʿrūf wa-nahīy ʿan al-munkar
- 7.2.4.5 Die Bedeutung der miḥna
- 7.2.4.6 Abschlussbetrachtungen zur Muʿtazila
- 7.2.5 Die theologischen Schulen des sunnitischen Islam – Ašʿarīya und Māturīdīya
- 7.2.5.1 Al-Ašʿarī
- 7.2.5.2 Al-Māturīdī
- 7.2.6 Der Einfluss und die Bedeutung der griechischen Philosophie auf den Kelam und seine Entwicklung
- 7.2.7 Der moderne Kelam und aktuelle Herausforderungen
- 7.2.8 Schlussbetrachtungen zu Bekir Topaloğlu
- 8. Schluss
- 8.1 Zwischen Kontinuität und Brüchen: Die schwierige Geschichte der jungen Republik der Türkei auf dem Weg zu einer relativ konsensualen Gesellschaft
- 8.1.1 Religiosität in der Türkei
- 8.1.2 Stand der Theologie in der Türkei
- 8.2 Herausforderungen für die islamische Theologie in Deutschland
- 8.2.1 Islamische Theologie in Deutschland und ‚Politischer Islam‘
- 8.2.2 Rationalisierung vs. mythisch-transzendente Religion
- 8.3 Herausforderungen – Abschließende Bemerkungen
- Literaturverzeichnis
- Series index
Vorwort & Danksagung
Als der Einfluss der Religion auf die Menschen allmählich zurückging
und sie auf unterdrückende gesetzliche Vorschriften zurückgriffen,
wurde das religiöse Gesetz zu einer Wissenschaft und zu einem Gewerbe,
das man sich durch Erziehung und Belehrung aneignete.1
Ibn Ḫaldūn (1332–1406)
Bereits zum Ende des 14. Jahrhunderts beschreibt Ibn Ḫaldūn differenziert die Prozesse, die seiner Ansicht nach dazu führen, dass herrschende Dynastien nach vier Generationen der Niedergang ereilt und wie sich aus dem Kalifat – vor allem aufgrund des Bedeutungsverlustes der Religion – sukzessive ein (weltliches) Königtum entwickelt. Dies zeigt auf, dass Säkularisierungsprozesse – im weiteren Sinne – nicht erst seit der (europäischen) Aufklärung vernommen und analysiert werden. Ibn Ḫaldūn führt aus, wie mit zunehmendem Luxus und daraus resultierenden gesellschaftlichen bzw. sozialpsychologischen Prozessen – in bestimmten zyklischen Phasen – die Bedeutung der Religion stets abnimmt. Auch am Beispiel des Bedeutungsverlustes der Familie – der auch in der Religion eine besondere Rolle zukommt – zeigt Ibn Ḫaldūn auf, warum ihre Stellung in der urbanen Gesellschaft abnimmt, und ‚Familie‘ in der Stadt nur noch dem Namen nach besteht. Während für die Beduinen die Verwandtschaftsverhältnisse überlebenswichtig und darum von großer Bedeutung sind, werden ihre Bezüge in der Stadt sukzessiv abgebaut, da die (Schutz-)Funktion hier durch Mauern, Soldaten und die Institutionen der jeweiligen Machthaber übernommen wird.2 Für Ibn Ḫaldūn ist dies nur ein Beispiel dafür, dass der Mensch „das Kind seiner Gewohnheiten und Bräuche und nicht das seiner Natur und Gemütsart ist“.3
Die Moderne, auf die noch eingegangen wird, bringt jedoch eine neue Qualität der Herausforderung für alle Religionen mit sich, da Letztere nun in Gänze infrage gestellt werden. Für Charles Taylor ist dies eine historisch neue Situation:
The change I want to define and trace is one which takes us from a society in which it was impossible not to believe in God, to one in which faith, even for the staunchest believer, is one human possibility among others.4
Damit ist Religion für eine große Masse von Menschen nur noch eines von mehreren Welterklärungsmodellen, die zur Verfügung stehen.
In seinem Werk Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens erläutert Karl Mannheim die Ursachen und Prozesse, die in der Moderne dazu führen, dass es u. a. zu traditionellen, liberalen und konservativen politischen Strömungen kommt. Während im Mittelalter noch die Religion den Kristallisationskern für ideologische Strömungen darstellt, gewinnt – aufgrund der genannten Veränderung gesellschaftlicher Strukturen – ab dem 17. Jahrhundert immer mehr das politische Element an Bedeutung. Ursächlich hierfür ist gemäß Mannheim die aus der hierarchischen Ständegesellschaft in der Moderne herausgebildete klassenmäßig geschichtete Gesellschaft.5
Dies führt dazu, dass bestehende Ideenströmungen sich immer mehr auf konkrete soziale und politische Prozesse beziehen und auf diese hin funktionalisiert und dadurch eindeutiger erfassbar werden.6 Eben dieser Prozess vollzieht sich meines Erachtens zeitversetzt (spätestens) auch in der Endphase des Osmanischen Reiches und wirkt sich bis in die jüngste Geschichte der türkischen Republik aus. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Ausschnitt dieses Prozesses am Beispiel der Diskussionen um die Akademisierung des Islam in der Türkei im Allgemeinen sowie die Entstehung des (türkischen) ‚Konservativen‘ als – wie es Mannheim ausdrückt – Reflexivwerden des ‚Traditionalisten‘ und somit als Reaktion auf die Herausforderung der neuen Realitäten (d. h. der Moderne) – im Besonderen, erörtert werden. Dies geschieht am Beispiel von Bekir Topaloğlu und Hayrettin Karaman, denen in dieser Hinsicht eine exponierte Rolle in der jüngeren türkischen Geschichte zukommt. An ihnen – besonders an Hayrettin Karaman – bestätigt sich auch die Feststellung Mannheims, dass den Konservativen nicht nur die Vertreter der neuen liberalen Ideen entgegenstanden, sondern dass sie auch aus den Reihen der Traditionalisten, denen Mannheim ein rein reaktives Handeln zuschreibt, Widerstand erfuhren, da diese den Grad der Rationalisierung, der mit dem ‚Reflexivwerden‘ einhergeht, als Entweihung betrachten.7 Die Diskussionen um diesen Prozess halten bis heute an.
Am Schluss dieser Arbeit wird aufgezeigt, inwieweit sowohl die dargelegten Prozesse in der Türkei als auch wesentliche Elemente der Wissenssoziologie Karl Mannheims auch für uns in Deutschland aktuell und relevant sind.8
Es ist nun einige Jahre her, dass ich im Rahmen meines Studiums mit dem großen muslimischen Universalgelehrten Ibn Ḫaldūn in Kontakt gekommen bin. Dies habe ich vor allem meinem damaligen tunesischen Freund und Mentor Noka Khalladi Mokhtar zu verdanken, der auch durch seine eigene besondere Persönlichkeit und seine Authentizität einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen hat.
Bei Ibn Ḫaldūn waren es vor allem der analytische und unbestechliche Blick auf die Gesellschaft und seine detaillierte Beschreibung der Ursachen ihrer Veränderung, der von da an meinen Blick auf die Welt maßgeblich mitgeprägt hat. Auch wenn Ibn Ḫaldūn und seine Ideen nicht zentraler Gegenstand dieser Arbeit sind, so ist er doch ein Vorreiter der modernen Soziologie bzw. ihrer Väter und Vertreter. Für mich steht er – in dem Sinne, Zusammenhänge in den Entwicklungen und Veränderungen der Gesellschaft zu erkennen – in einer Reihe mit den späteren Vätern bzw. Vertretern der Soziologie, mit denen ich mich beschäftigt habe, wie bspw. Alexis de Tocqueville, Max Weber und eben auch Karl Mannheim, dem in dieser Arbeit eine zentrale Rolle zukommt.
In Bezug auf Karl Mannheim möchte ich Prof. Dr. Syed Farid Alatas von der National University of Singapore danken, der mich im Rahmen einer der vielen internationalen Tagungen, die wir an der Universität Osnabrück realisiert haben, in einem gemeinsamen Austausch zu Ibn Ḫaldūn auf Karl Mannheim aufmerksam gemacht hat. Wollte ich bei Mannheim zunächst lediglich seine Definition in Bezug auf Konservatismus betrachten, erkannte ich durch das Studium seiner Werke sehr bald, dass in diesen deutlich mehr zu entdecken war – nämlich nichts Geringeres als ein Konzept, das eine plausible und stichhaltige Erklärung dafür liefert, warum der Konservatismus ein Ergebnis der Moderne ist und welche Grundlagen sowie Prozesse für seine Entstehung verantwortlich sind. Diese habe ich hier auf die Entwicklung der modernen Türkei übertragen.
Zuvorderst bedanke ich mich bei meinen Betreuern und Kollegen im Fachbereich für Erziehung und Kulturwissenschaften der Universität Osnabrück, Prof. Dr. Dr. Rauf Ceylan sowie Prof. Dr. Andreas Kubik für ihr Vertrauen sowie die vielen wichtigen und substanziellen Anregungen, die sie mir bei der Realisierung und Systematisierung meiner Dissertation zukommen ließen.
Des Weiteren bedanke ich mich – auch stellvertretend für das gesamte Kollegium am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück – beim Leiter des Instituts, Herrn Prof. Dr. Bülent Uçar, der mir im Rahmen meiner Tätigkeit als Dozent und Koordinator ausreichend Raum und Gelegenheit für meine Arbeit bot, vor allem dafür, dass er mich zur Aufnahme der Promotion ermutigte.
An dieser Stelle sind auch meine Kollegen Herr Prof. Dr. Merdan Güneş, Herr Prof. Dr. Abdurrahim Kozali, Herr Dr. des. Yılmaz Gümüş, Herr Taha Tarık Yavuz sowie Frau Vanessa Walker zu nennen, die mir bei Fragen zur Theologie in der Türkei bzw. der Transliteration bzw. Übersetzung arabischer und osmanischer Termini mit Rat und Tat zur Verfügung standen. Sina Nikolajew, die meinen Text redigiert und lektoriert hat, bin ich ebenso zu großem Dank verpflichtet.
Große Unterstützung erhielt ich in den letzten Jahren bei meiner Arbeit am IIT auch von unseren werten Kolleginnen und dem Kollegen der Verwaltung: Birgit Ardelt, Inga Kröger, Heike Hedemann und Sebastian Klein.
Mein ganz besonderer Dank, den ich hier hervorheben möchte, gilt – neben meiner Frau, Suna Nur Sağlam, der ich diese Arbeit für so manche Entbehrung der letzten Jahre widme – auch meinen vier Kindern Harun, Musa, Muhammed sowie Meryem, die so manche Zeit ohne mich auskommen mussten. Meinen Eltern, namentlich meiner Mutter Aynur und meinem Vater Gençağa Sağlam, möchte ich für ihr Vorbild danken, das sie mir durch ihren Lebensweg und vor allem ihren liebevollen Umgang mit ihren Mitmenschen vorgelebt haben.
Schließlich gebührt alles Lob und aller Dank Allah – Heil und Segen seien auf Seinem Gesandten, Muhammed (sav), seiner Familie und seinen Gefährten.
1 Mathias Pätzold (Übers.), Ibn Khaldun: Buch der Beispiele, Leipzig 1992, S. 75.
2 Pätzold, Ibn Khaldun, S. 182.
3 Pätzold, Ibn Khaldun, S. 72. Siehe zu Ibn Ḫaldūn und der Systemtheorie auch: Dieter Weiss, „Arabische Wirtschaftspolitik im Lichte der Systemtheorie von Ibn Khaldun“, in: Die Welt des Islams N. F. 28, 1.4 (1988), S. 585–606.
4 Charles Taylor, A Secular Age, London 2007, S. 3.
5 Karl Mannheim, Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens (1924), Frankfurt am Main 1984, S. 70.
6 Mannheim, Konservatismus, S. 69 f.
7 Mannheim, Konservatismus, S. 97.
8 Karl Mannheim gilt als (Mit-)Begründer der Wissenssoziologie.
1. Einleitung
1.1 Hintergrund zur Einführung der Islamischen Theologie in Deutschland
Die Islamische Theologie als wissenschaftliche Disziplin hat an deutschen Universitäten hinsichtlich ihres Aufbaus in den letzten Jahren bereits beachtliche Schritte vollzogen, und dennoch steht sie erst am Anfang ihrer Entwicklung. Im Anschluss an die Deutsche Islamkonferenz (DIK)9 empfahl der Wissenschaftsrat im Jahr 2010 die Gründung universitärer Einrichtungen für Islamische Studien, welche neben der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern10 eines noch einzuführenden regulären islamischen Religionsunterrichtes an deutschen Schulen auch die Ausbildung der dazu erforderlichen „Religionsgelehrten“ verantworten sollte.11 Die also schlussendlich hierdurch (an)erkannte Notwendigkeit, sich mit der religiösen Unterweisung von Musliminnen und Muslimen zu beschäftigen, war jedoch bereits seit den 1970er-Jahren akut. Schon in dieser Zeit kam es im Zuge der Familienzusammenführung der in Deutschland ansässig gewordenen Gastarbeiter (und in Ausnahmen auch Gastarbeiterinnen) mit ihren bis dahin im Herkunftsland verbliebenen Angehörigen zu einer stark gestiegenen Anzahl muslimischer – vor allem türkischer – Kinder in Deutschland, welche aufgrund der allgemeinen Schulpflicht auch gleich zu neuen Schülerinnen und Schülern deutscher Schulen wurden. Dies regte einige Bundesländer bereits relativ früh dazu an, sich mit dem Thema der religiösen Unterweisung muslimischer Mitbürger – vor allem Kinder – zu beschäftigen. Die entsprechenden Projekte wurden jedoch zeitlich befristet konzipiert, da man zunächst noch von der baldigen Rückkehr der Gastarbeiter und ihrer Familien in ihre angestammte Heimat ausging. Obwohl schon bald deutlich wurde, dass die Frage nach islamischer Unterweisung kein temporäres Projekt darstellen sollte, verblieben die einzelnen Bundesländer (sogar bis heute) dabei, an ihren jeweiligen provisorischen (Sonder-)Lösungen festzuhalten. Unbestreitbar ist und war von Anfang an allerdings, dass alle Religionsgemeinschaften bzw. deren Anhängerinnen und Anhänger einen juristischen Anspruch auf religiöse Unterweisung haben. Diesen Anspruch garantiert das Grundgesetz, welches den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an deutschen Schulen vorsieht (GG Art. 7, Abs. 3).12 Ob der Islam als Religionsgemeinschaft im Sinne des GG zu gelten habe, ist viel diskutiert worden.13 Die Einführung des islamischen Religionsunterrichts an deutschen Schulen sowie der Islamischen Theologie an deutschen Universitäten sind ein wichtiger Schritt in Richtung einer weitgehenden Anerkennung, dennoch sind die Diskussionen damit wohl noch nicht beendet.14
Auch wenn der religionsrechtliche Status der organisierten Musliminnen und Muslime bzw. der muslimischen Verbände15 noch immer nicht abschließend geklärt ist, wurde das ‚Projekt‘ Islamische Theologie bzw. Islamischer Religionsunterricht (IRU) bereits begonnen. Janbernd Oebbecke sieht neben „großen Unsicherheiten im Umgang mit der Situation“16 vor allem in Bezug auf die Imamausbildung, die nicht von den organisierten Musliminnen und Muslimen ausgegangen sei, einen politischen Willen, der das Projekt vorantreibe:
Der Vorgang zeigt aber auch, dass die Hochschulpolitik in Land und Universität mit der Deckung des von ihr identifizierten Bedarfs an bekenntnisgebundener Wissenschaft vom Islam nicht gewartet hat, bis die rechtlichen Fragen, die für den Parallelfall Religionsunterricht seit langen Jahren diskutiert werden, geklärt sein würden. Wo ein Wille ist, wird politisch auch vorwärts gegangen, wenn rechtlich ein Weg (noch) nicht erkennbar ist. Das Interesse – mindestens was die Imamausbildung angeht, praktisch ausschließlich das Interesse des Staates, nicht der organisierten Muslime – an der Etablierung islamischer Theologie lässt auch rechtliche Unsicherheiten in Kauf nehmen.17
An den meisten Standorten wird die Islamische Theologie von konfessorischen Beiräten begleitet. Die Funktion dieses Beirats entspricht in etwa den Mitwirkungsrechten der christlichen Kirchen in theologischen Instituten, namentlich der Mitwirkung bezüglich der Zustimmung zu Studieninhalten und der Besetzung von Professuren und Juniorprofessuren nach Abschluss des hochschulinternen Verfahrens in Form einer Einverständniserklärung.18
Dadurch sind die muslimischen Gemeinden mittelbar in den Prozess der Etablierung der Islamischen Theologie in Deutschland eingebunden.19 Ein wichtiger Aspekt für die Einführung der Islamischen Theologie bzw. des Religionsunterrichts war zudem die Erwartung eines möglichen positiven Integrationseffekts,20 nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des seinerzeit schwelenden Karikaturen-Streits und hierum kreisender soziopolitischer Debatten. „Für die politischen Eliten ergab sich dadurch ein hoher Handlungsdruck, der auch dafür sorgte, dass der Kooperation mit den muslimischen Verbänden ein höherer Stellenwert beigemessen wurde.“21 Auch Rohe sieht bedeutende Effekte für die Integration, da ihr
neben fachlichen Aspekten auch erhebliche psychologische Bedeutung [zukomme]: Muslime ‚gehören nun dazu‘, was auch von vielen Eltern geschätzt wird, die zur Religion eher ein distanziertes Verhältnis pflegen. Nicht zuletzt erleichtert die Anwesenheit muslimischer Kollegen es anderen Lehrkräften, religionsspezifische Fragen und Probleme mit deren Unterstützung angehen zu können.22
Das hat auch dazu geführt, dass sowohl das Maß staatlichen Einflusses als auch die Rolle der muslimischen Verbände noch immer höchst umstritten sind. Heinig sieht die Beiratslösung primär als Strategie „zur Schaffung politischer Akzeptanz durch die Einbindung theologischer Expertise jenseits der Verbände und die Beteiligung nichtorganisierter Muslime“23, da die politisch Verantwortlichen negative Reaktionen der Bevölkerung befürchteten, welche dem Islam gegenüber misstrauisch eingestellt sei. Daher warnte er bereits im Jahre 2011 vor einem „‚Staatsislam‘ durch die Hintertür“,24 der zu befürchten sei, wenn der Staat sich seine Kooperationspartner selbst aussuche und dadurch die religiös-weltanschauliche Neutralität gefährde. Die Glaubensbindung der Theologien hat Konsequenzen für die Lehre an den Universitäten. Die historischen Ursachen (namentlich die Renaissance und Aufklärung), die zu einer Differenzierung zwischen Religionswissenschaft und Theologie geführt haben, schlagen sich auch im Grundgesetz nieder. Entsprechend obliegen die Ordnung und Verwaltung der eigenen Angelegenheiten den jeweiligen Religionsgemeinschaften.
Die Wissenschaftsfreiheit, die staatliche Universitäten und Fakultäten gegenüber dem Staat genießen, kann diese Staatsfreiheit alleine nicht hinreichend garantieren. Denn in der Theologie kreuzen sich, systemtheoretisch gesprochen, zwei Systemcodierungen: der Code der Wissenschaft (wahr/unwahr) und der der Religion (Glaube/Unglaube). Die Wissenschaftsfreiheit flankiert nur die funktionale Ausdifferenzierung der Wissenschaft, nicht aber die der Religion. Wissenschaftsfreiheit bezieht sich nur auf den Code eines, des wissenschaftlichen, Systems. Als glaubensbezogene Wissenschaft verlangt die Theologie aber eine additive Aktivierung der Religionsfreiheit in ihrer Funktion als verfassungsrechtlich intendiertem Autonomieschutz eines bestimmten Lebensbereichs.25
Doch indem Ergebnisse der modernen Wissenschaft und Forschung mit Glaube und Dogma konfrontiert würden, erhoffe sich der Staat auch durch entsprechend ausgebildete Geistliche eine Rückwirkung auf die theologische Praxis, ebenfalls durch einen interdisziplinären Austausch, der an den Universitäten gewährleistet sei.26 Entsprechend empfiehlt der Wissenschaftsrat die Institutionalisierung der Islamischen Theologie an einer „Philosophischen oder Kulturwissenschaftlichen“27 Fakultät. Einerseits solle durch die Mitwirkung der Religionsgemeinschaften eine „feindliche Übernahme“ verhindert werden, so Heinig,28 andererseits ist die Einwirkung der Religionsgemeinschaft (derzeit über die Beiräte) auf ausschließlich religiöse Inhalte begrenzt; in sonstigen Fragen, etwa (fach)wissenschaftlicher Kriterien bzw. Ansprüche, verfügen die Beiräte über kein Mitspracherecht. Entsprechend gehen sowohl personelle Besetzungen als auch die Einführung und Änderungen von Lehrplänen immer zunächst den üblichen Gremienweg der Universitäten und werden schließlich dem Beirat für das Votum vorgelegt. So werden die Beiräte vor allem in Fragen der Lehrpläne und des Personals (Berufung von Professuren) eingebunden.
Schröder und Hunger sehen im Rahmen der Einführung der Islamischen Theologie auch einen „Funktionswandel der muslimischen Verbände“, welcher „Anknüpfungspunkt für Beiträge zur Migrantenselbstorganisation und ihr Verhältnis zum Staat sein“29 könne. Özsoy wiederum drückt die Bedenken eines Teils der muslimischen Theologinnen und Theologen aus, wenn er in dem Einfluss der Verbände gar die Gefahr der Verkirchlichung des Islam sehe, was seinem Wesen nicht entspreche. Es gebe, so der Theologe weiter, keine Instanz, die darüber entscheiden könne, was ‚islamisch‘ sei bzw. wer islamische Theologin bzw. islamischer Theologe sein dürfe.30 Gerade das habe, so eine These Özsoys, auch zu einem toleranten Islam in der Geschichte geführt.31 Ceylan erwidert, dass in der islamischen Wissenschaftsgeschichte die Tradition der iǧāza (Erteilung der Lehrerlaubnis) üblich gewesen sei. Auch wenn im Zuge der Säkularisierung der Türkei muslimische Bildungseinrichtungen geschlossen worden seien, habe diese Tradition bis heute Bestand.32
Für Oebbecke besteht aufgrund der Bedeutung der Verbände für die Realisierung und Wahrnehmung der neuen Angebote (Islamische Theologie und Islamischer Religionsunterricht) faktisch ein Kooperationsbedarf der Länder und Hochschulen mit den Vertretungen der Musliminnen und Muslime.
Der Umstand, dass die zuständige religiöse Stelle eine Torwächterposition einnimmt, bei Religionslehrern über ihre Zustimmung und bei geistlichem Personal als Arbeitgeber, nötigt die Hochschule also schon faktisch dazu, durch organisatorische Maßnahmen auf klar geäußerte Einwände gegen die Tätigkeit bestimmter Personen zu reagieren, jedenfalls wenn diese wie hier nachvollziehbar begründet werden.33
Während Oebbecke in dem Beiratsmodell einerseits eine Übergangslösung sieht, die jedoch im Falle ihrer Bewährung durchaus ‚Traditionsgut‘ (so von Campenhausen/de Wall) werden könne, was nicht unüblich sei,34 können die Beiräte Rohe zufolge nur „für einige Zeit als rechtlich abgesichert gelten, jedoch keine Dauerlösung sein“, und daher sei es „erforderlich, den Übergang zur Kooperation mit den bestehenden bzw. entstehenden Religionsgemeinschaften zu planen“.35
Der Verfasser dieser Arbeit ist selbst seit dem Jahre 2012 Geschäftsführer des Konfessorischen Beirats an der Universität Osnabrück. Es hat sich gezeigt, dass durchaus unterschiedliche Motivationen und Interessen der verschiedenen Vertreterinnen und Vertreter zutage treten und der Beirat entsprechend auch die Möglichkeit bietet, etwaige Bedenken konstruktiv in den Austausch einzubringen. Die Erfahrungen in Osnabrück haben gezeigt, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Kooperationspartnerinnen, d. h. der Universität Osnabrück und der Religionsgemeinschaften – das sind die niedersächsischen Landesverbände, die Schura sowie die DİTİB –, möglich ist. Hier konnten die wissenschaftlichen und verwaltungstechnischen Kriterien der Universität mit den religiösen Sensibilitäten der muslimischen Vertreter in Einklang gebracht werden. Der Status des Beirats ist jedoch noch nicht endgültig geklärt, auch weil geplante Staatsverträge36 des Landes Niedersachsen mit den muslimischen Religionsgemeinschaften, die eine etwaige Modifikation des aktuellen Formats erfordern, auf Eis gelegt wurden.37
Dass es trotz der schwierigen Ausgangslage zu enormen Entwicklungen in der Islamischen Theologie in Deutschland kommen konnte, insbesondere die Einführung der Islamischen Theologie und die Einführung des Islamischen Religionsunterrichts betreffend, hat nicht zuletzt mit der bereits zitierten Analyse und darauf aufbauenden Empfehlung des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2010 zu tun:
Details
- Seiten
- 368
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631926185
- ISBN (ePUB)
- 9783631926192
- ISBN (Hardcover)
- 9783631925973
- DOI
- 10.3726/b22431
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Dezember)
- Schlagworte
- Islam Theologie politischer Islam Türkei Soziologie Karl Mannheim Hayrettin Karaman Bekir Topaloglu Konservatismus Islam in Deutschland Extremismusprävention Geschichte Psychologie Religionswissenschaft Reform Tradition Innovation Debatte
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 368 S., 1 s/w Abb., 10 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG