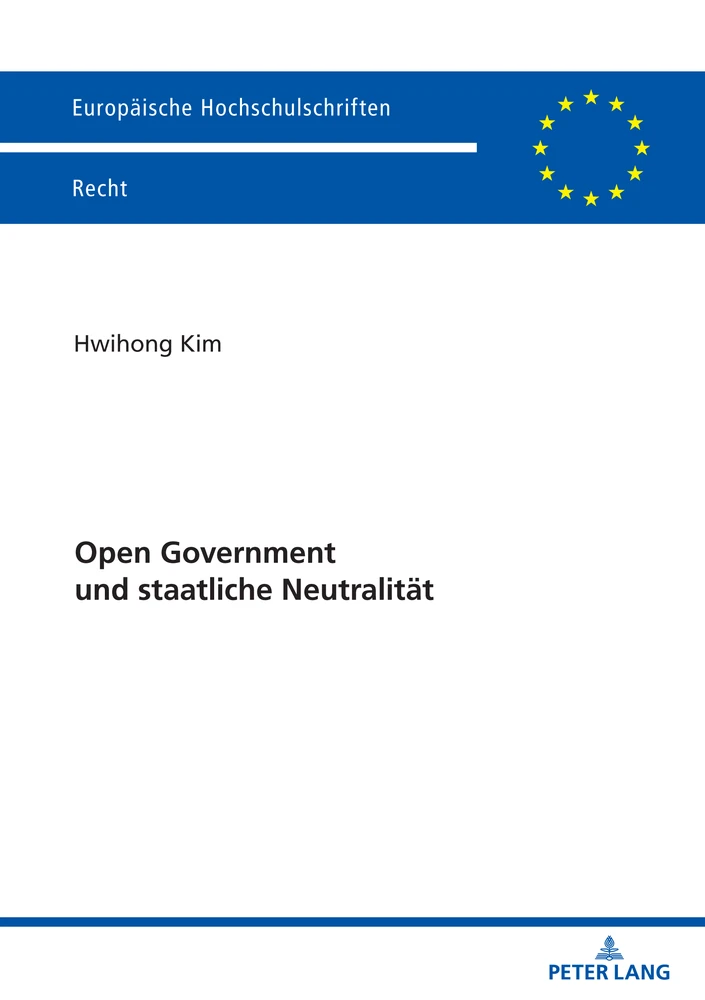Open Government und staatliche Neutralität
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Kapitel: Open Government
- A. Neues Paradigma für Staat und Verwaltung
- 1. Entwicklungsprozess
- 2. Digitalisierung
- (1) Digitalisierung als Treiber
- (2) Digitalisierung als Werkzeug
- B. Grundprinzipien von Open Government
- 1. Drei Grundprinzipien
- (1) Transparenz
- (2) Partizipation
- (3) Kollaboration
- 2. Ein viertes Grundprinzip: Neutralität
- (1) Open Government und Pluralismus
- (2) Zwei Dimensionen des Neutralitätsprinzips
- 1) Grundrechtliche Neutralität
- 2) Staatsorganisatorische Neutralität
- 3. Neues Profil von Open Government
- C. Demokratietheoretische Grundlegung
- 1. Partizipative Demokratie
- 2. Deliberative Demokratie
- 3. Komplexe Demokratie
- 4. Folgerungen für Open Government
- D. Verfassungsrechtlicher Rahmen
- 1. Grundrechte
- 2. Demokratieprinzip
- 3. Rechtsstaatsprinzip
- E. Kommunikationspflichten der Verwaltung
- 1. Einschränkungen bei formellen Verfahren
- 2. Informelle Verfahren für Open Government
- 3. Anforderungen und Grenze
- F. Zusammenfassung
- 2. Kapitel: Grundrechtliche Neutralität von Open Government
- A. Staatliche Wahrnehmung öffentlicher Kommunikation
- 1. Selbstdarstellung in sozialen Medien
- (1) Phänomene der Selbstdarstellung
- (2) Impression Management Theory
- (3) Konstruktion und Kuratierung der (virtuellen) Identität
- (4) Fazit
- 2. Grundrechtsrelevanz der öffentlich zugänglichen Daten
- (1) Bestimmung der öffentlichen Zugänglichkeit
- 1) Objektive Abgrenzung
- 2) Ein subjektiver Vorbehalt?
- (2) Übertragung auf soziale Medien
- 1) Registrierungspflicht
- 2) Privatsphäre-Einstellungen
- (a) Persönliche Nähebeziehung?
- (b) Individuell bestimmter Empfängerkreis
- (3) Rechtliche Folgen
- 1) Das Urteil zur Internetaufklärung
- 2) Entwicklungslinie
- 3) Dogmatische Begründung
- 3. Fazit
- B. Grundrechtliche Neutralitätsgewährleistungen
- 1. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
- (1) Persönlichkeitsentfaltung
- (2) Persönlichkeitsentwicklung
- 2. Recht auf den Schutz der Privatsphäre
- (1) Privatheit als Garant für Autonomie
- (2) Unbestimmtheit des Privaten
- 1) Dichotomie im Netz
- 2) Private Öffentlichkeit?
- 3) Inhaltliche Beurteilung der Daten?
- (3) Datenverknüpfung
- (4) Fazit
- 3. Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- (1) Herleitung
- (2) Ansätze in der Literatur
- 1) Limitationen des Privatsphärenschutzes
- 2) Soziologische Perspektive
- 3) Einschüchterung und Anpassungsdruck
- (3) Öffentlich zugängliche Daten
- 1) Personenbezogenen Daten
- 2) Gewährleistung der freien Kommunikation
- 3) Schutz äußerer Handlungsfreiheit
- (4) Theorie der Einschüchterungseffekte
- 1) Entstehung und Entwicklung
- 2) Rechtsprechung
- (5) Einschüchterungseffekte durch Überwachung sozialer Medien
- 1) Mögliche Nachteile
- (a) Gefahr sachwidriger Entscheidungen
- (b) Stigmatisierung und Diskriminierung
- (c) Informationelle Begründungslast
- 2) Empirisch beweisbare Nachteile?
- (6) Fazit
- C. Eingriffsqualität von Social-Media-Monitoring
- 1. Eingriffsbegriff
- 2. Informationelles Selbstbestimmungsrecht
- (1) Informationsbezogener Eingriffsbegriff
- (2) Begrenzung: Besondere Gefahrenlage für die Persönlichkeit
- (3) Kriterium: Objektive Gefahrenprognose
- 1) Eingriffsabwehrrecht: Treffer-Fall
- 2) Objektiv-rechtliche Garantien: Intransparenz
- 3) Fazit
- (4) Kritik und Lösungsansatz
- 1) Gegenstand: Objektiv-rechtliche Dogmatik
- 2) Problematik: Dilemma
- 3) Lösungsansatz: Subjektiv-rechtliche Dimension
- (a) Art der erfassten Daten
- (b) Anlass und Streubreite der Datenerhebung
- (c) Modus der Informationserhebung
- a) Heimlichkeit der Überwachungsmaßnahmen
- b) Art und Weise der Informationsverarbeitung
- (d) Art der möglichen Verwendung der Daten
- (5) Fazit
- 3. Kapitel: Staatliche Neutralität von Open Government
- A. Einflussnahme auf die politische Willensbildung
- B. Staatliche Neutralitätsgewährleistungen
- 1. Grundrechtsgewährleistungen
- 2. Staatsfreiheit und politische Neutralität
- 3. Chancengleichheit und politische Neutralität
- 4. Rechtsstaatliche Neutralität
- C. Zusammenfassung
- Gesamtergebnis und Schlussfolgerung
- 1. Kapitel:
- 2. Kapitel:
- 3. Kapitel:
- Literaturverzeichnis
- Sachverzeichnis
Einleitung
A. Problemaufriss und Motivation
„Demokratie heißt Zuhören und die Hand reichen.“1 Bundesinnenminister Thomas de Maizière gab mit dieser Formulierung am 7. Dezember 2016 die Teilnahme Deutschlands an Open Government Partnership bekannt. Im darauf folgenden Satz hebt er das Konzept von Open Government als ein Instrument hervor, das die Demokratie stärken soll. „Mit unserem Einsatz für Open Government leisten wir einen wichtigen Beitrag zu mehr Transparenz, zu mehr Teilhabe und mehr Innovation.“ Der zugrundeliegende Gedanke ist, dass „Open Government […] die Demokratie stärken [werde], wenn das offenere Regieren die demokratische Willensbildung für Interessen öffnet, die bislang chancenlos waren, ohne jedoch anderen die Gelegenheit zu nehmen, gehört zu werden.“2
Die Forderung nach einer Öffnung des Staates gegenüber den Bürgern ist allerdings keineswegs neu. Der Wunsch nach und die Diskussion um die Offenheit des Staates existieren bereits seit langem in Form von Dokumentenzugangsrechten. Das Konzept von Open Government war ursprünglich durch das Kernelement der Transparenz geprägt. Prominente Beispiele dafür sind der „Freedom of Press Act“ in Schweden aus dem Jahr 17663 und „Freedom of Information Act“ in den USA im Jahr 1966.4 Der Open Government-Begriff wurde in den letzten Jahren wieder aufgegriffen und hat einen Bedeutungswandel hin zur Interaktion erfahren. Der Anlass dafür war eine steigernde Umweltkomplexität5 und eine sinkende Akzeptanz von politischen Entscheidungen.6 Der Protest gegen „Stuttgart 21“ ist nur ein Beispiel dafür. Sicher ist jedenfalls, dass Zustimmung und Gehorsam zu kostbaren Gütern geworden sind.
Mit denselben Problemen haben nicht nur staatliche Institutionen zu kämpfen. Auch private Institutionen wie Unternehmen müssen ihre Existenz, ihr Handeln oder ihr eigenes Produkt in der Gesellschaft immer wieder begründen.7 Nach dem neuen Ansatz Open Innovation spielt dabei nachvollziehbare und mitwirkungsorientierte Kommunikation eine wesentliche Rolle,8 indem sie die Konsumenten zu einem frühen Zeitpunkt in den Entscheidungs- und Wertschöpfungsprozess integriert. Hier hat sich ein gebräuchliches Mittel durchgesetzt, das im Zeitalter der sozialen Medien immer mehr an Bedeutung gewinnt: Social-Media-Monitoring. „Die Kraft, große Dinge zu entscheiden, kommt aus der ununterbrochenen Beobachtung der kleinen Dinge.“ So skizzierte Gerd Bucerius, wenngleich weit vor Anbruch der digitalen Revolution, den Kerngedanken vom Monitoring sozialer Medien. Mithilfe der computergestützten Analyse sozialer Medien können die Unternehmen das Wissen und die Erfahrungen von außen identifizieren und darauf zurückgreifen. Soweit man den öffentlich geäußerten Meinungen zum Produkt und Unternehmen einen hohen Stellenwert einräumt, ist der Kommunikationsprozess, speziell Social-Media-Monitoring, aus dem modernen Wirtschaftsleben kaum wegzudenken.
Für die Kommunikation des Staates steht im Gegensatz zur privatwirtschaftlichen nur begrenzter Raum zur Verfügung. Im Hinblick auf ein dichotomisches Verhältnis von Staat und Gesellschaft sind die Überschneidungen beider Seiten die Ausnahme. Angesichts der Umweltkomplexität und Akzeptanzdefizite ist fraglich, ob nicht auch Staat und Verwaltung aufgerufen sind, für ihre Entscheidungen Monitoring der sozialen Medien durchzuführen. Im Unternehmenskontext wird Social-Media-Monitoring mit dem Ziel eingesetzt, die Innovationsimpulse für die Produkte zu erhalten und damit eigene Interessen verfolgen zu können. Für den öffentlichen Bereich gelten hingegen andere Regeln. Im freiheitlichen demokratischen Staat des Grundgesetzes ist kein genuines Eigeninteresse des Staates vorgegeben, zu dessen Verfolgung er das „Ohr an das Netz“ legen darf. Einen Ansatzpunkt dafür mag das Open Government- Konzept bieten, das jüngst durch den Open Innovation-Ansatz unterstützt wird. Demnach wird mehr Offenheit i.S.v. Interaktion gefordert, um die Effizienz und Effektivität staatlichen Handelns, aber auch die Akzeptanz und Legitimation zu erhöhen. Diese ist aber nur eine politische Forderung, deren Umsetzung im Ermessen des Gesetzgebers steht. Ob und zu welchem Zweck der Staat mit der Öffentlichkeit kommunizieren darf, wird durch öffentliches Recht definiert. Für das kommunikative Staatshandeln wird von der Rechtsprechung besonders mit einem Gebot der Neutralität argumentiert. Im Fokus stehen somit die rechtlichen Grenzen, die staatliches Social-Media-Monitoring beschränken. Ob und inwieweit die Einbeziehung der Bürger bzw. einer interessierten Öffentlichkeit in einen politisch-administrativen Entscheidungsprozess unter dem Gebot der Neutralität steht, bedarf einer rechtlichen Untersuchung.
B. Gang der Untersuchung
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, rechtliche Grenzen staatlicher Informationsgewinnung aus sozialen Medien zu analysieren. Das führt zu zwei zentralen Fragestellungen: Zum einen ist zu klären, wie das Kommunikationsverhältnis zwischen Staat und Bürger im Rahmen des Open Government ausgestaltet sein soll. Zum anderen stellt sich die Frage, welche Anforderungen beim Einsatz von Social-Media-Monitoring durch Staat erfüllt werden müssen.
Im 1. Kapitel der Arbeit wird untersucht, wie das Konzept von Open Government aussieht und wie ein solches realisiert werden soll. Dazu wird unter A. der Entwicklungsprozess von einem rein bürokratischen Verständnis zu Open Government dargelegt. Dies umfasst eine Betrachtung der Digitalisierung als Treiber und Werkzeug eines offenen Staates. Nötig ist dies insbesondere in Bezug auf das sogenannte Social-Media-Monitoring, das in der Arbeit thematisiert wird. Unter B. werden zuerst drei Eckpfeiler für das Verständnis von Open Government Transparenz, Partizipation und Kollaboration dargestellt. Daneben wird ein viertes Grundprinzip der Neutralität entwickelt. Die Begründung dieses Prinzips erfolgt durch die Heranziehung des Gedanken des Pluralismus und die Bestimmung der Offenheit i.S.v. Open Government. Das Neutralitätsprinzip ist anschließend aus grundrechtlicher und staatsorganisatorischer Sicht zu betrachten. Ausgehend davon wird das Konzept von Open Government neu konzipiert. Um einen normativen Anknüpfungspunkt für die Kommunikation zwischen Staat und Bürger herauszufinden, werden sodann die Demokratietheorien untersucht, die verstärkt auf die partizipative Sichtweise ausgerichtet sind. Das Verfassungsgebot zu derselben kann aus den Strukturprinzipien von Grundrechten, Demokratie und Rechtsstaat gewonnen werden. Das erste Kapitel schließt mit einer Betrachtung des geltenden Rechtsrahmens für Open Government. Die Entscheidung über Art und Umfang der Kommunikation im Rahmen informeller Verfahren stehen grundsätzlich im Ermessen der zuständigen Behörde. Die Neutralität des Staates bildet dabei die Grenze sämtlicher informeller Verfahren.
Staatliches Kommunikationshandeln im Rahmen von Open Government soll sich demnach grundrechtsneutral vollziehen. Im 2. Kapitel werden die computergestützten staatlichen Informationsmaßnahmen in sozialen Medien auf ihre grundrechtliche Eingriffsqualität befragt. Dazu werden unter A. die Phänomene der Selbstdarstellung in sozialen Medien aus soziologischer Perspektive betrachtet, um die persönlichkeitsrelevante Bedeutung sozialer Medien zu erfassen. Im Anschluss wird den Fragen anhand der Rechtsprechung des BVerfG nachgegangen, was unter öffentlich zugänglichen Daten im Internet zu verstehen ist und wozu eine Einordnung der Daten als öffentlich zugänglich führt. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den zur Begründung der fehlenden Eingriffsqualität vertretenen Auffassungen. Ausgehend davon befasst sich die Untersuchung unter B. mit dem Schutzbereich des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG. Aufgrund der soziologischen Erkenntnisse wird zunächst das allgemeine Persönlichkeitsrecht grundrechtsdogmatisch erläutert. Auf dieser Grundlage werden das Recht auf den Schutz der Privatsphäre und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung untersucht, um festzustellen, ob öffentlich zugängliche Daten unter den Schutzbereich jenes Grundrechtes fallen. Sodann wird der klassische und moderne Eingriffsbegriff insbesondere in Bezug auf das sogenannte Social-Media-Monitoring untersucht. Dessen Verhaltensbeeinflussung kann zwar nicht verneint werden. Ihm kommt jedoch im Rahmen der subjektiv-rechtlichen Funktion der Grundrechte keine Bedeutung zu. Die Analyse setzt sich mit der zugrundeliegenden, objektiv-rechtlichen Dogmatik der Einschüchterungseffekte auseinander. Im Anschluss werden anhand der Rechtsprechung des BVerfG Thesen erarbeitet, die darauf ausgerichtet sind, die subjektiv-rechtliche Dimension der Grundrechte durch Einschüchterungseffekte aktivieren zu können. Als Zwischenergebnis können die Anforderungen formuliert werden, die dazu dienen, die Einschüchterungseffekte zu minimieren und damit die Informationen grundrechtsneutral zu gestalten.
Der Staat soll zudem inmitten der verschiedenen Wertvorstellungen unparteiisch bleiben und sich nicht einer bestimmten Überzeugung anschließen. Das 3. Kapitel ist deshalb der Frage gewidmet, welche Anforderungen an staatliches Social-Media-Monitoring gestellt werden können. Dazu wird zunächst kommunikatives Staatshandeln dargestellt, zu dem Social-Media-Monitoring wegen seiner Funktion zur Teilnahme an dem Meinungs- und Willensbildungsprozess zählt. Sodann werden viele Potentiale und ein besonderes Manipulationsrisiko in Bezug auf die gesellschaftliche Willensbildung betrachtet. Grundrechte enthalten einen Neutralitätsaspekt, indem sie einen Anspruch auf die gleiche Freiheit gewähren und deren Achtung fördern. Die Anforderungen an diese Informationsgewinnung ergeben sich zudem aus dem Grundsatz der Staatsfreiheit und der Chancengleichheit. Neutralitätssicherndes Distanzgebot speist sich schließlich aus rechtsstaatlichen Quellen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
1 „Demokratie heißt Zuhören und die Hand reichen“ – Bundesminister de Maizière gibt Teilnahme an Open Government Partnership (OGP) bekannt, Pressemitteilung des BMI v. 07.12.2016.
2 Wewer/Wewer, Open Government, S. 203.
Details
- Seiten
- 216
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631926567
- ISBN (ePUB)
- 9783631926574
- ISBN (Paperback)
- 9783631926536
- DOI
- 10.3726/b22342
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (November)
- Schlagworte
- Wettbewerbsverhältnis Unparteilichkeit Einschüchterungseffekt Staatliche Neutralität Social-Media-Monitoring Gesellschaftliche Kommunikation Digitalisierung Open Government Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 216 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG