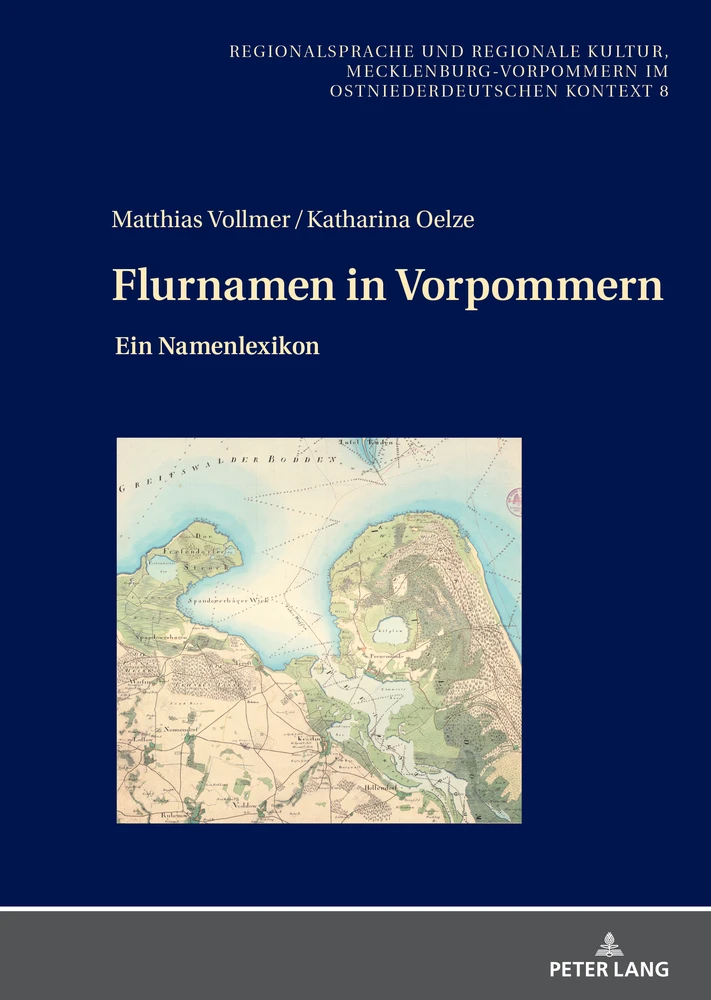Flurnamen in Vorpommern
Ein Namenlexikon
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Geschichte der Flurnamenforschung in Pommern
- 3. Zur Bildungsweise von Flurnamen
- 3.1 Simplizische Flurnamen
- 3.2 Komposita
- 3.3 Onymische Wortgruppen
- 3.4 Primär- und Sekundärbildungen
- 3.5 Flurnamennetze
- 4. Zum Verhältnis niederdeutscher und hochdeutscher Namen
- 5. Die niederdeutschen Dialekte der Region Vorpommern
- 6. Zu den Quellen der Datenerhebung
- 7. Der Aufbau der Artikel im Namenlexikon
- 8. Abkürzungsverzeichnis
- Flurnamenlexikon
- Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat von 2016 bis 2020 unter dem Titel „Digitales vorpommersches Flurnamenbuch“ ein namenkundliches Projekt am Pommerschen Wörterbuch der Universität Greifswald gefördert, dessen vorrangige Ziele die Sammlung und Dokumentation sowie die digitale Aufbereitung der schriftlich überlieferten Flurnamen in Vorpommern waren. Damit hat die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts weitgehend brachliegende Flurnamenforschung im östlichen Teil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern dankenswerterweise neue und wichtige Impulse erhalten. Als alleinige wissenschaftliche Mitarbeiterin war während der gesamten Laufzeit des Projekts Katharina Oelze M.A. tätig. Sie wurde für die Datenerhebung von Mai 2016 bis Januar 2018 von der studentischen Hilfskraft Friederike Burmann unterstützt.
Eine der wesentlichen Aufgaben des Vorhabens, nämlich die Bereitstellung einer digitalen Datenbank, die alle erhobenen vorpommerschen Flurnamen umfasst, konnte bereits kurz nach Abschluss des Projekts im Juni 2020 in die Tat umgesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde unter der Internetadresse https://flurnamenbuch-vorpommern.germanistik.uni-greifswald.de/ ein digitales Flurnamenbuch freigeschaltet, das seitdem sowohl für Forschungszwecke als auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Datenbank bietet für die Nutzerinnen und Nutzer vielfältige Möglichkeiten, das dort dokumentierte Namenmaterial nach bestimmten Gesichtspunkten zu durchsuchen beziehungsweise zu filtern. Dadurch kann eine große Bandbreite möglicher Fragestellungen in den Blick genommen werden. Dazu gehören beispielsweise Auflistungen aller Flurnamen bestimmter Ortspunkte, die Untersuchung der Häufigkeit und der regionalen Verteilung von bestimmten Bildungselementen, die Beteiligung von Personen- und Siedlungsnamen an der Flurnamengebung, Fragen zum Einsatz von lokalen Präpositionen, aber auch die Analyse von Aspekten, die mit der zeitlichen Schichtung des Materials zusammenhängen und vieles mehr. Erhoben worden sind im Verlauf der vierjährigen Förderungsdauer insgesamt knapp 90.000 Einzelbelege. Nach Abzug von Schreibvarianten, die in der digitalen Datenbank in einer dafür vorgesehenen Rubrik gesondert vermerkt worden sind, und der Tilgung von doppelt oder sogar mehrfach belegten Namen mit identischer Schreibung für dasselbe Flurstück umfasste das Datenkorpus im Januar 2024 die Zahl von 35.468 verschiedenen Flurnamen.
Die vorliegende Arbeit präsentiert eine namenkundliche Analyse der schriftlich überlieferten Flurnamen Vorpommerns, die sich besonders auf die niederdeutschen Flurnamen im Untersuchungsgebiet konzentriert, die den Großteil der erhobenen Mikrotoponyme ausmachen. Zentraler Bestandteil dieser Publikation ist ein Namenlexikon, das in weit über 500 Artikeln mit niederdeutschen Stichwörtern die wichtigsten Bildungselemente der Flurnamengebung in Vorpommern darstellt. In den einzelnen Artikeln wird zunächst die lexikalische Bedeutung der jeweiligen Bildungselemente erläutert. Daneben geht es um Informationen zu deren Häufigkeit und besonders um die Kombination dieser Einheiten mit anderen sprachlichen Elementen zu mehr oder weniger frequenten Bildungstypen von Flurnamen. Zur detaillierten Darstellung des Artikelaufbaus vgl. Kapitel 7. Während die zumeist jüngeren hochdeutsch überlieferten Namen in die Analyse einbezogen worden sind (vgl. hierzu Kapitel 4), ist aus naheliegenden Gründen auf eine namenkundliche Untersuchung der slawischen Flurnamen Vorpommerns verzichtet worden. Eine solche Analyse kann sinnvollerweise nur aus der fachwissenschaftlichen Perspektive der Slawistik, nicht aber von germanistischer Seite aus erfolgen und muss daher zumindest vorerst ein Desiderat bleiben. Die Datengrundlage für diesbezügliche Forschungen liegt aber in Gestalt der erwähnten Datenbank vor. Behandelt werden im Namenlexikon hingegen auch Flurnamen, die Entlehnungen in die niederdeutschen Dialekte Vorpommerns aus dem Slawischen oder aus anderen Sprachen enthalten. Die Zahl solcher Lehnwörter ist allerdings sehr überschaubar. Zu den slawischen Entlehnungen zählen Lank und Lietz, aus dem Schwedischen stammt Grän, während die Appellative Kås aus dem Dänischen und Huk aus dem Niederländischen entlehnt worden sind.
Flurnamen, die in der namenkundlichen Fachsprache auch als Mikrotoponyme bezeichnet werden, weil man mit ihrer Hilfe relativ kleinräumige Örtlichkeiten benennt, gehören innerhalb der Eigennamen zu der großen Gruppe der Toponyme, also zu den Ortsnamen. Ihre primäre Funktion besteht darin, die räumliche Orientierung in einer weitgehend agrarisch geprägten Umwelt durch sprachliche Mittel zu gewährleisten. Im engeren Sinn sind unter dem Begriff daher diejenigen Namen zu verstehen, mit denen unbewohnte, vor allem landwirtschaftlich genutzte Flächen aller Art versehen worden sind. Als Flurnamen können also in erster Linie die Namen von Äckern, Weiden, Wiesen, Gehölzen und Waldflächen gelten. In einem weiteren Begriffsumfang, dem hier aus pragmatischen Gründen gefolgt wird, sind aber auch die Bezeichnungen von Ödlandflächen, Mooren und Sümpfen sowie von Verkehrswegen und natürlichen Objekten außerhalb geschlossener Siedlungen noch zu dieser Namengruppe zu zählen. Selbst die Bezeichnungen von stehenden und fließenden Gewässern können noch als Teil eines erweiterten Flurnamenbegriffs aufgefasst werden, nicht zuletzt deswegen, weil in vielen Fällen die Lage eines Flurstücks an einem Gewässer das entscheidende Benennungsmotiv gewesen ist. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass die Namengebung in aller Regel durch die einheimische Bevölkerung und nicht am grünen Tisch erfolgt. Nicht alle Flurnamen in schriftlichen Quellen können jedoch die (ehemalige) sprachliche Wirklichkeit exakt abbilden. Diese Einschätzung trifft beispielsweise für eine Reihe von ursprünglich niederdeutschen Namen in Vorpommern zu, die vor allem von Katasterbeamten im Verwaltungsschrifttum verhochdeutscht worden sind und deswegen auch als Katasterformen bezeichnet werden können. Solche Katasterformen sind aber wegen ihres als offiziell empfundenen Charakters durchaus dazu in der Lage, sekundär auf die Mündlichkeit zurückzuwirken und somit den Anteil hochdeutscher Flurnamen zu erhöhen. An der Dominanz des Niederdeutschen und damit auch niederdeutsch geprägter Flurnamen im sprachlichen Alltag Vorpommerns bis weit in das 20. Jahrhundert hinein kann jedoch kein ernsthafter Zweifel bestehen (vgl. Vollmer 2017). Schließlich belegen zahlreiche Quellen diesen Befund. So wird jeder, der in den Archiven der Region auf der Suche nach Flurnamen einschlägige Text- sorten einsieht, unweigerlich auf sprachliche Gebilde wie Ellernkamp, in der Wische, Bäukenholt oder Blanksoll stoßen, bei denen es sich eben um niederdeutsche Flurnamen handelt, deren genaue Lage den meisten Mitgliedern der betreffenden Ortsgemeinschaft früher ganz selbstverständlich bekannt gewesen ist. In diesem Kontext ist übrigens darauf hinzuweisen, dass die kommunikative Reichweite von Flurnamen wesentlich geringer als die von Siedlungsnamen ist. Die Kenntnis über örtliche Flurnamen beschränkt sich nämlich in der Regel auf die jeweilige Dorfgemeinschaft, manchmal sogar auch nur auf Teile davon.
In der jüngeren Vergangenheit haben gleich mehrere Faktoren dazu beigetragen, dass die genaue Kenntnis über diese Gruppe von Eigennamen, ohne die früher die Organisation des bäuerlichen Arbeitsalltags und die sprachliche Orientierung vor Ort undenkbar gewesen wären, erheblich nachgelassen hat und teilweise sogar völlig in Vergessenheit geraten ist. Zu den sprachexternen Ursachen dieser Entwicklung zählen beispielsweise die Kollektivierung der Landwirtschaft in der ehemaligen DDR, aber auch damalige oder spätere Flurbereinigungsverfahren und Zusammenlegungen von landwirtschaftlichen Flächen zu größeren Einheiten. Daneben sind aber auch sprachliche Gründe zu nennen. Damit ist besonders die nach 1945 deutlich abnehmende Bedeutung der einheimischen niederdeutschen Dialekte im sprachlichen Alltag und der damit einhergehende Verlust plattdeutscher Sprachkompetenz großer Teile der Bevölkerung im dialektalen Rückzugsgebiet Vorpommern angesprochen.
Einerseits haben Flurnamen also ihre ehemals wichtige Orientierungsfunktion für die Menschen vor Ort und selbst für die heutige landwirtschaftliche Lebens- und Arbeitswelt weitgehend eingebüßt. Andererseits kann aber festgestellt werden, dass nicht nur aus einer wissenschaftlichen, also vorrangig namenkundlichen Perspektive heraus, sondern auch in Laienkreisen ein durchaus vitales Interesse an dieser Gruppe von Eigennamen besteht. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verdankt die Flurnamenforschung wohl in erster Linie ihrer Aussagekraft für heimatgeschichtliche Fragestellungen. Und in der Tat stellen Flurnamen unschätzbare historische Quellen dar, die wichtige Aufschlüsse über orts- und regionalgeschichtliche Aspekte vermitteln können. Deutlich weniger relevant ist aus der Sicht von Laien hingegen ein vorrangig sprachwissenschaftlich geprägter Zugang, der sich zwar auch, aber eben nicht ausschließlich auf die Namendeutung bezieht, sondern zusätzlich die formale Bildungsweise dieser sprachlichen Gebilde in den Blick nimmt, wortgeografische Aspekte untersucht und sprachhistorisch relevante Ziele verfolgt, um nur einige linguistische Forschungsinteressen zu nennen.
Als sprachliche Zeichen sind Flurnamen zwar primär ein Untersuchungsgegenstand der Namenkunde und damit der Sprachwissenschaft. Darüber hinaus stellen sie aber vor allem für Historiker unterschiedlicher Fachrichtungen, daneben aber auch für andere wissenschaftliche Disziplinen, beispielsweise für die Geografie und die Volkskunde, einen wichtigen Quellenhorizont dar. Deswegen kann man auch ohne zu übertreiben von einer interdisziplinären Brückenfunktion der Flurnamenkunde sprechen. Die historische Sprachwissenschaft hat übrigens schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Relevanz der Beschäftigung mit Flurnamen erkannt, ohne dass damit jedoch unmittelbare Impulse für konkrete Forschungsprojekte verbunden gewesen wären. So äußerte sich im Jahr 1840 kein geringerer als Jacob Grimm zu diesem Thema wie folgt: „Wenn aber die uralte zeit noch irgendwo haftet in der neuen, so ist es in der benennung der dorffluren, weil der einfache landmann lange jahrhunderte hindurch kein bedürfniss fühlt, sie zu verändern“ (Grimm 1840: 135).
Neben der Betonung der Langlebigkeit dieser Namengruppe weist der Sprachwissenschaftler Grimm mit diesem Zitat indirekt auch auf eine weitere Eigenschaft von Flurnamen hin, nämlich darauf, dass der Prozess der Namengebung keineswegs willkürlich erfolgt, sondern grundsätzlich als motiviert einzuschätzen ist. Die enorme Fülle der möglichen Benennungsmotive im Rahmen der Flurnamengebung soll und kann dabei an dieser Stelle nur angedeutet werden. So vermitteln Mikrotoponyme beispielsweise Informationen über die ehemalige Flora und Fauna einer Region, sie können aber auch die Erinnerung an wüst gewordene Ortschaften bewahren, frühere Besitzverhältnisse dokumentieren, die historische Nutzung von Flächen verdeutlichen und längst vergessenes Wortgut bewahren, um nur einige wichtige Aspekte zu nennen.
Details
- Seiten
- 206
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631927700
- ISBN (ePUB)
- 9783631927717
- ISBN (Hardcover)
- 9783631927694
- DOI
- 10.3726/b22520
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Dezember)
- Schlagworte
- Vorpommern Niederdeutsch Namenkunde Flurnamen
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 206 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG