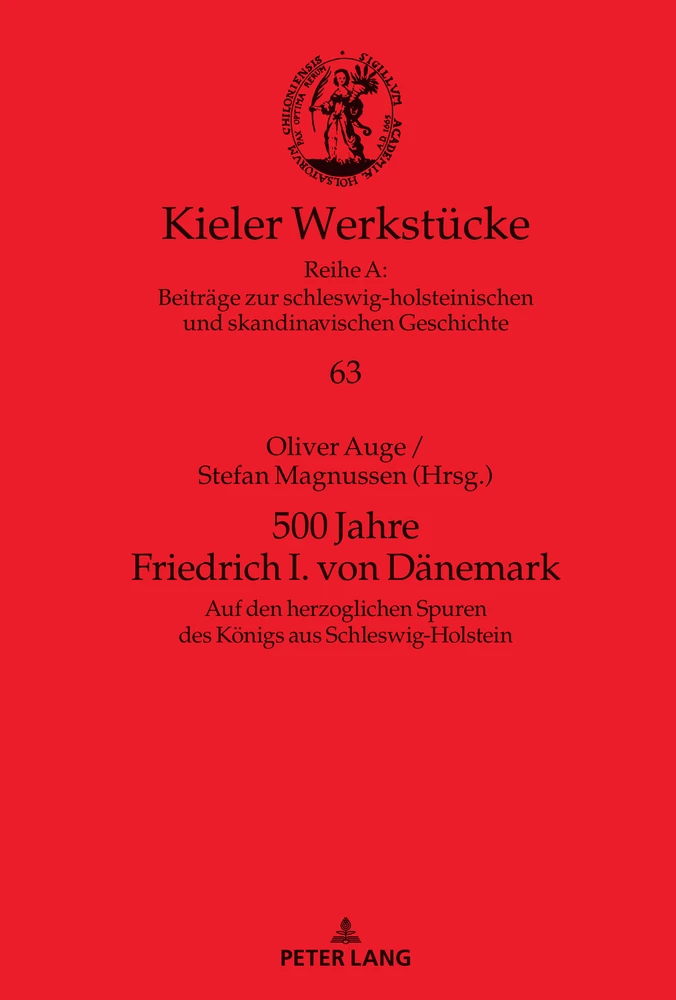500 Jahre Friedrich I. von Dänemark
Auf den herzoglichen Spuren des Königs aus Schleswig-Holstein
Summary
Dieser Band versammelt die Beiträge eines Symposiums, das zum 500. Jahrestag dieses Ereignisses im Schloss vor Husum stattfand. Die acht Beiträge widmen sich unter anderem seiner Kirchen- und Stadtpolitik, dem Verhältnis zum Adel oder den Spielräumen seiner Frauen und verdeutlichen, dass er ein Bauherr am Puls seiner Zeit war.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 500 Jahre Friedrich I. – Eine Spurensuche nach den herzoglichen Wurzeln des Königs aus Schleswig-Holstein: Hinführung
- Die Witwenversorgung der Gottorfer Herzoginnen Anna von Brandenburg (1487–1514) und Sophia von Pommern (1498–1568)
- Friedrich I., die schleswig-holsteinische Ritterschaft und die Anfänge des Gottorfer Hofs
- Gottschalk von Ahlefeldt (1475–1542) als herzoglich-gottorfischer Kanzler und Bischof von Schleswig. Loyaler Diener und treuer Berater Friedrichs I. und seines Sohnes Christian
- Reform- oder Reformationsfürst? Friedrich I. und die Kirche
- Die Performanz der Abwesenheit. Friedrich I. von Dänemark und die Flensburger Disputation
- Husums Gönner? Herzog Friedrich I. von Schleswig und Holstein und seine Beziehung zur Hafenstadt an der Westküste
- Von Kontinuität, Konfrontation und Kompromiss. Friedrich I. und seine Nachfolge
- Friedrich I. als Initiator des frühen fürstlichen Schlossbaus in Schleswig und Holstein
Oliver Auge und Stefan Magnussen
500 Jahre Friedrich I. – Eine Spurensuche nach den herzoglichen Wurzeln des Königs aus Schleswig-Holstein: Hinführung
Am 29. Januar 1523 traf der dänische Reichsrat Mogens Munk in Husum ein. Im Gepäck hatte er ein Schreiben an Herzog Friedrich I. von Schleswig und Holstein, worin eine Reihe von jütischen Adligen dem Herzog die dänische Krone anboten. Wenige Tage zuvor hatten diese die Regierung des bisherigen dänisch-norwegischen Königs und Neffen des Herzogs, Christians II., für beendet erklärt. Hohe Kosten durch einen Feldzug nach Schweden, eine durch die Blockade der Hansestädte ausgelöste Wirtschaftskrise und eine Handelsgesetzgebung, welche die Städte auf Kosten des Adels und Klerus bevorteilte, hätten ihnen keine andere Möglichkeit mehr gelassen. Auch wenn sich das Treffen womöglich eher zufällig in Husum ereignete,1 dürfte den Herzog das Angebot nicht wirklich überrascht haben. Kontakt zum jütischen Adel hatte er nämlich schon seit einigen Monaten. Zwar soll sich Friedrich zunächst Bedenkzeit erbeten haben, doch nahm er das Angebot letztlich an. Er erklärte seinem Neffen Anfang März desselben Jahres den Krieg und zog von Gottorf aus mit einem Gefolge, zu dem auch zahlreiche Untertanen von Nordstrand und Eiderstedt zählten, nach Viborg, wo ihm am 26. März desselben Jahres als neuem dänischen König gehuldigt wurde.2
Seit der historischen Rede des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz vom 27. Februar 2022, in der er erstmals zur wenige Tage zuvor ausgeweiteten russischen Offensive in die Ukraine Stellung bezog,3 ist der Begriff der „Zeitenwende“ ein fester Bestandteil unseres Sprachgebrauchs. Doch auch wenn angesichts der Tragweite der gegenwärtigen Ereignisse historische Analogien schwierig sind, lassen sich die geschilderten Ereignisse des Frühjahres 1523 doch auch als eine Zeitenwende für die nordische Geschichte ansprechen. Denn mit der Absetzung Christians II. in allen drei Reichen endete das Projekt einer politischen Union der drei nordischen Königreiche Norwegen, Schweden und Dänemark – die sogenannte Kalmarer Union.4 Dies gilt insbesondere für das Königreich Schweden, wo die Wahl Gustav Erikssons zum neuen schwedischen König am 6. Juni 1523 als Geburtsstunde des neuen, modernen schwedischen Staates gilt. Entsprechend feierte man hier ab März 2023 dann auch das doppelte Jubiläumsjahr anlässlich des 500. Jahrestages der Erhebung Gustavs I. Vasa und des 50. Thronjubiläums des gegenwärtigen Monarchen, Carl XVI. Gustav.5
Ein vergleichbares Interesse an diesem historischen Wendepunkt sucht man in Dänemark und Norwegen vergeblich. Dabei betrat nicht nur in Schweden eine neue Figur das königliche Parkett, denn auch in den beiden Nachbarreichen zierte die Krone fortan ein neues Haupt. Mag das mangelnde Interesse für Norwegen noch nachvollziehbar sein – kam es hier im Gegensatz zu Schweden doch nicht zur Geburt eines modernen Norwegens, sondern, ganz im Gegenteil, mittelfristig zum Verlust der Unabhängigkeit6 –, so verwundert das mangelnde Interesse in Dänemark dann doch. Immerhin ging die dänische Thronfolge bis zur Huldigung Christians IX. im Jahr 1863 für 340 Jahre in direkter Linie auf eben jenen Friedrich I. und dessen erste Ehefrau, Anna von Brandenburg, zurück. Doch als ‚Brückenkönig‘ zwischen den beiden großen historischen Klammern der Kalmarer Union und der Reformation wird seine Person nur all zu leicht von seinem schillernden Vorgänger, Christian II., und seinem Sohn, Christian III., überstrahlt. Das ist ein Befund, der im Übrigen auch für Friedrichs Bruder Hans (bzw. Johann) Gültigkeit besitzt.
Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Friedrich I. unter all den dänischen Monarchen eine pikante Sonderrolle einnimmt. Friedrich I. ist nämlich der einzige dänische König, dessen letzte Ruhestätte sich heute nachweislich in Schleswig-Holstein befindet – genauer gesagt im Dom St.-Petri zu Schleswig.7 Zwar sollen mit Niels, Erik IV. (plovpenning) und Abel auch einige seiner hochmittelalterlichen Vorgänger am selben Ort bestattet worden sein, jedoch ist von diesen kein historisches Grabmal überliefert.8
Dass sich Friedrich im Herzogtum bestatten ließ und nicht etwa an der Seite seiner Eltern im Dom zu Roskilde9 oder in dem von seinem Bruder Hans zur neuen königlich-oldenburgischen Hauptgrablege auserkorenen Franziskanerkloster in Odense,10 dürfte unterstreichen, dass Friedrich sich trotz seiner Erhebung zum dänischen König den Herzogtümern weiterhin stets verbunden fühlte, die er immerhin 43 Jahre lang regierte. Eine Regierungsdauer, die lediglich von Friedrichs Urenkel Christian IV. überboten wird.11 Alle Motive, die zur Bestattung in Schleswig führten, mögen heute nicht mehr zur Gänze zu rekonstruieren sein. Klar ist jedoch: Es war auch ein Statement.
Mit dem Begräbnis in der Petrikirche schloss sich in gewisser Weise ein Lebenskreis – und so möchten wir die Gelegenheit nutzen, um am Beginn dieses Bandes auch die biographischen Rahmenbedingungen zu klären. Denn anders als sein älterer Bruder Hans,12 der seinem Vater 1481 zunächst auf den dänischen und zwei Jahre später auch auf den norwegischen Thron folgte,13 und seine Schwester Margrethe, die 1469 den schottischen König James III. heiratete,14 war für Friedrich offenbar kein royaler Lebensweg vorgesehen. So erscheint es rückblickend fast schon als historischer Fingerzeig, dass er am 7. Oktober 1471 nicht im Königreich, sondern im herzoglichen Hadersleben das Licht der Welt erblickte. Zwar verbrachte er seine früheste Kindheit mit seiner Mutter Dorothea noch in Kalundborg auf der Insel Seeland. Seine Mutter soll jedoch schon früh und vermutlich in Abstimmung mit der schleswig-holsteinischen Ritterschaft für den jüngste Sohn die Herzogtümer Schleswig und Holstein als alleiniges Erbe vorgesehen haben.15 So folgte dann auch bald der Umzug nach Gottorf, wo Friedrich dann auch den größten Teil seiner Jugend verbrachte – und eben nicht, wie man es so oft liest, im Augustiner Chorherrenstift zu Bordesholm.16 Die Mutter machte ihre Rechnung jedoch ohne den älteren Bruder. Dieser soll zunächst bestrebt gewesen sein, seinen kleinen Bruder mit einer Pfründe am Kölner Domstift aus dem säkular-dynastischen Verkehr zu ziehen,17 doch verständigte man sich nach der gemeinsamen Belehnung im Jahr 1482 auf eine Landesteilung nach ‚deutschem‘ Vorbild im Jahr 1490. Friedrich erhielt ein Territorium um die wichtige Residenz Gottorf, zu dem neben den Städten Plön, Kiel, Neumünster, Itzehoe, Tondern oder Hadersleben auch der damals aufstrebende Handelsort Husum zählte.18
Obwohl ihn seine Biografie gewissermaßen zum idealen Gegenstand für die schleswig-holsteinische Landesgeschichte macht, fand die hiesige Forschung nie so recht einen Draht zu ‚ihrem‘ König. Dabei fallen in seine Regentschaft zahlreiche Prozesse, die einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Geschichte der Lande zwischen Nord- und Ostsee hatten: Landesteilung, Entstehung des Gottorfer Hofes, Anfänge der Reformation, die Ausweitung adliger Privilegien,19 der beginnende Schlossbau oder auch die Schlacht von Hemmingstedt20 – um nur einige zu nennen.
So war es im Grunde genommen naheliegend, dass wir im Umfeld einer Tagung zum Bordesholmer Altar im September 2021, auf der es immer wieder auch um Friedrich I. ging,21 auf dieses große landeshistorische Desiderat stießen. Eine glückliche Fügung war es zudem, dass wir mit dem 500. Jubiläum seiner Erhebung im Januar 2023 auch gleich den passenden Anlass für eine nähere Beschäftigung mit diesem Herzog auf dem Präsentierteller gereicht bekamen. Schnell kamen wir bei der Frage nach dem Tagungsort auf Husum zu sprechen, was sich auch mit unserem Ziel deckt, dass wir Wissenschaft nicht nur in Kiel oder auf Gottorf stattfinden lassen wollen, sondern im ganzen Land – im engen Austausch einerseits mit den Fachkolleginnen und -kollegen und andererseits mit der historisch interessierten Öffentlichkeit.
Mit diesem Band liegen nun die Beiträge des Symposiums vom 29. Januar 2023 in gedruckter Form vor und ermöglichen somit zum ersten Mal überhaupt einen gezielten Zugang zur Person Herzog Friedrichs I. Ergänzt wurden diese um zwei extra für diesen Band verfasste Beiträge von Detlev Kraack und Christian Hoffarth. Doch anders, als es bei den dänischen Königsbiografien klassischerweise üblich ist, wollten wir uns diesem Monarchen eben nicht als König, sondern als Herzog von Schleswig und Holstein nähern. Denn auch wenn die dänischen Könige von Christian I. bis Christian IX. zugleich auch Herzöge von Schleswig und Holstein waren, so spielt diese Doppelrolle in den meisten Darstellungen kaum eine tragende Rolle.22 Doch war dieser königlich-herzogliche Dualismus nicht trivial, sondern ein zentrales Element der dynastischen Politik – wie man etwa bei den Heiratsverhandlungen Christians II. sieht, der am habsburgischen Hof Karls V. eben nicht als dänischer oder norwegischer König vorstellig wurde, sondern explizit als holsteinischer Landesherr,23 oder bei Christians IV. Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg.24 Damit sind nur zwei Themenbereiche exemplarisch genannt.
Die acht Beiträge dieses Bandes sind freilich bloß als ein erster Aufschlag zu einer vertieften Auseinandersetzung nicht nur mit Friedrich I., sondern auch zu den frühen Gottorfern überhaupt zu begreifen, die trotz ihrer landeshistorischen Bedeutung als mehr oder weniger untererforscht gelten müssen. Sie bilden aber bereits das breite Panorama seiner Regentschaft ab und verdeutlichen somit die fundamentale Bedeutung der Herrschaft Friedrichs I. für der weitere Landesgeschichte.
Dabei ließe sich seine Geschichte nicht ohne die Berücksichtigung der beiden Frauen an seiner Seite schreiben, die sowohl als Herzoginnen als auch Herzoginwitwen und Vormundinnen stets wichtige Machtfaktoren waren.25 So beginnt auch dieser Band mit einem Beitrag von Mirja Piorr, die sich nicht nur intensiv mit den beiden Eheschließungen als Grundlagen fürstlichen Wirkens, sondern auch mit der Witwenversorgung Sophias als Herausforderung beschäftigt. Frederic Zangel behandelt dann das intensive Beziehungsgeflecht zwischen dem Herzog und der schleswig-holsteinischen Ritterschaft, die nicht nur ein wichtiger selbständiger Akteur war, sondern auch bewusst die Nähe zum Fürsten für die Ausweitung eigener Spielräume nutzen konnte. Mit dem herzoglichen Kanzler und Schleswiger Bischof Gottschalk von Ahlefeldt steht ein Stellvertreter dieser Elite auch im Zentrum des folgenden Beitrags, den Detlev Kraack zur Drucklegung dieses Bandes beisteuerte. Schon hierbei wird die zentrale Rolle des eigentlich ersten Gottorfers für die unter seinem Sohn Christian III. vollends realisierte Kirchenreformation deutlich, die Oliver Auge dann in seiner Erörterung der Frage danach, ob Friedrich I. nun eher Reformer oder Reformator gewesen ist, gezielt in den Fokus stellt – wobei er das Bild eines Fürsten zeichnet, der eher klug reagierte als strategisch vordachte. Das kluge und um das rechte Maß bemühte Vorgehen des Herzogs wird auch beim zweiten extra für diesen Band verfassten Beitrag deutlich, indem Christian Hoffarth in seiner Detailstudie zur sogenannten Flensburger Disputation von 1529 eine ganz neue Sicht auf die Rolle Friedrichs I. anbietet. Stefan Magnussen zeigt darauf in seinem Aufsatz anhand des Fallbeispiels Husum, dass Friedrich nach seinem Tod womöglich gerade aufgrund seiner Charaktereigenschaften ein beliebter regionaler ‚Erinnerungsort‘ wurde – was wiederum die ihm traditionell zugeschriebene väterliche Fürsorge für den aufstrebenden Hafenort in einem anderen Licht erscheinen lässt. Laura Potzuweit widmet sich im Anschluss in ihrem Beitrag der für die Dynastie so wichtigen Frage der Herrschaftsnachfolge und Landesteilung von 1544, die sie vor dem Hintergrund der jüngeren Forschung als weit weniger „verhängnisvoll“ deutet, sondern gerade durch die Partizipation der Landstände als kluge Strategie zur Verstetigung dynastischer Macht. Mit seinen kunsthistorischen und bildreichen Ausführungen zu Friedrich I. als Bauherrn rundet schließlich der Denkmalpfleger Deert Lafrenz den Band sinnvoll ab. Eindrucksvoll verdeutlicht er, dass sich unter Friedrich I. eine Architektur auf der Höhe ihrer Zeit entfaltete, die sich keineswegs hinter dem Bauprogramm seines Sohnes und Gottorfer Nachfolgers Adolf I. zu verstecken braucht.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Schlaglichter die angesprochene Notwendigkeit einer stärkeren Auseinandersetzung mit der Person Friedrichs I. sowie den anderen Herzögen in Schleswig und Holstein hinreichend verdeutlichen. Sie zeigen aber schon jetzt das große Potential neuer Perspektiven auf diese weitgehend im Schatten seiner Vorgänger und Nachfolger stehenden Persönlichkeit.
Abschließend bleibt uns nur noch der Dank an unsere Kolleginnen von der Abteilung, insbesondere Anne Krohn und Felicia Engelhard, die sich tatkräftig für das Gelingen der mit über 100 Personen gut besuchten Nachmittagsveranstaltung im Schloss vor Husum verdient gemacht haben, sowie unsere Hilfskräfte Hannah Fischer und Kai Wittmacher, die sich bei der redaktionellen Bearbeitung des Bandes engagiert haben. Unser Dank gilt aber auch dem Museumsverbund Nordfriesland, der sich sofort für die Idee dieses Symposiums erwärmte. Uwe Haupenthal übergab uns zunächst den Schlüssel für das Schloss und später dann auch das gemeinsame Vorhaben in die Hände seiner Nachfolgerin Tanja Brümmer. Unser Dank gilt natürlich auch den generösen Förderern der Veranstaltung und des daraus hervorgegangenen Bandes: Dies sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte sowie die vom Kreis Nordfriesland verwaltete Stiftung Vermächtnis Johan von Wouwer, die schon aufgrund der biographischen Verbindung des Stifters zum Gegenstand des Symposiums und Bandes ein naheliegender Partner war.26 Und nicht zuletzt gilt unser Dank dem Peter Lang-Verlag für die Unterstützung bei der Realisierung dieses Bandes, der die Beiträge dann auch noch einmal nachhaltend verfügbar macht.
Ohne solche starken und verlässlichen Partner, die auch kleinere Vorhaben in der Region bereitwillig fördern, wäre ein öffentlichkeitsorientierter Ansatz, wie ihn die Kieler Abteilung für Regionalgeschichte verfolgt, nicht möglich.
1 Siehe hierzu den Beitrag von Stefan Magnussen in diesem Band.
2 Hierzu umfassend Venge, Christians 2.s Fald.
3 Regierungserklärung.
4 Siehe hierzu statt vieler die Gesamtdarstellungen bei Etting, Fællesskab. – Larsson, Kalmarunionens tid. – Enemark, Kalmarbrev. Es fehlt bis heute an einer umfassenden deutschsprachigen Darstellung.
Details
- Pages
- 236
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631928363
- ISBN (ePUB)
- 9783631928370
- ISBN (Hardcover)
- 9783631893005
- DOI
- 10.3726/b22459
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Flensburg Husum Herrscherinnen Reformation Kalmarer Union Gottorf Schleswig-Holstein Dänemark Herrscherwechsel
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 236 S., 9 farb. Abb., 7 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG