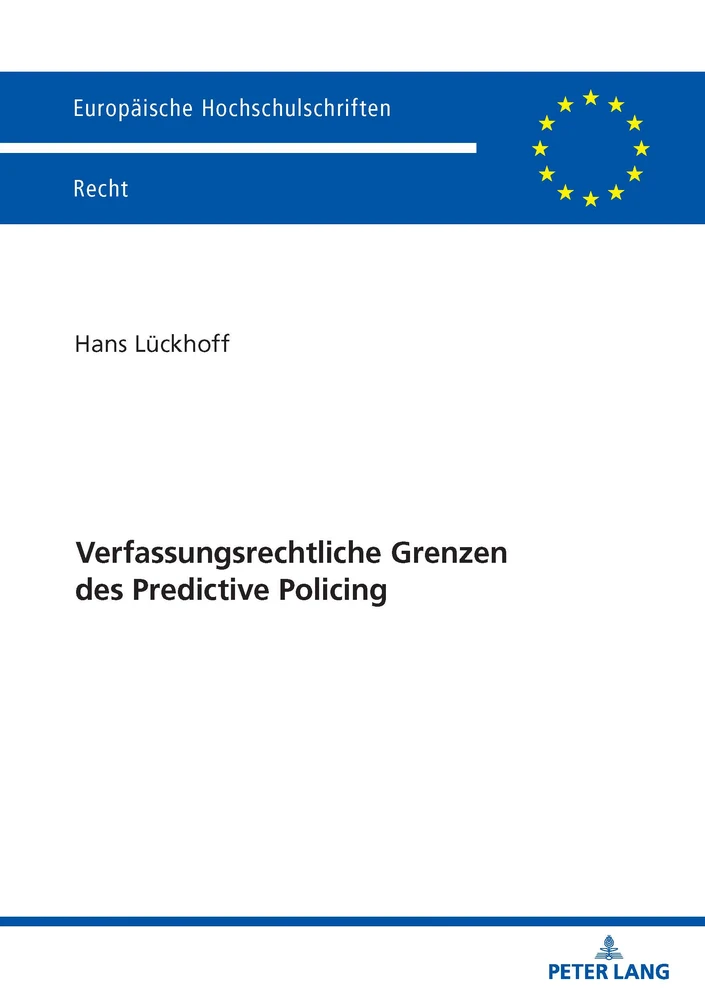Verfassungsrechtliche Grenzen des Predictive Policing
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Hingabe
- Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- 1. Begriff und Arten des Predictive Policing
- 2. Entwicklung
- II. Ortsbezogenes Predictive Policing
- 1. Theoretische Grundlagen
- 1.1. Rational-Choice-Theorien
- 1.2. Routine-Activity-Approach
- 1.3. Near-Repeat-Phänomen
- 1.4. Broken Windows
- 1.5. Crime-Pattern-Theorie
- 1.6. Weitere Ansätze
- 2. Technische Grundlagen der Computerprognose
- 2.1. Hot-Spot-Analyse
- 2.2. Regressionsmethoden
- 2.3. Risk Terrain Analysis
- 3. Bisherige Untersuchungen zur Wirksamkeit der Anwendungen
- 4. Bestandsaufnahme in Deutschland
- 4.1. PRECOBS
- 4.2. SKALA
- 4.3. PreMAP
- 4.4. KrimPro
- 4.5. KLB-operativ
- 4.6. ELSA
- 4.7. Ausblick für Deutschland
- 5. Internationaler Ausblick
- 6. Fazit
- III. Personenbezogenes Predictive Policing
- 1. Technische Differenzierungen
- 2. Bestandsaufnahme, Einordnung und Abgrenzung in Deutschland
- 2.1. Palantir Gotham (hessenDATA / DAR), VeRA
- 2.2. „Intelligente“ Videoüberwachung
- 2.3. RADAR-iTE und RADAR-rechts
- 2.4. Musterabgleich des Fluggastdaten-Informationssystems
- 2.5. Weitere Anwendungsfälle
- 3. Bestandsaufnahme in der Europäischen Union
- 3.1. Sensing Project
- 3.2. iBorderCtrl
- 4. Internationaler Ausblick
- 5. Fazit
- IV. Verfassungsrechtliche Grenzen
- 1. Ortsbezogene Systeme
- 1.1. Ortsbezogene Prognosen ohne Ermächtigungsgrundlage
- a. Grundsätze
- b. Bedenken zu möglicher Ungleichbehandlung
- c. Stigmatisierende Verhaltensprofile
- α. Einordnung in Art. 3 GG
- β. Anwendung im ortsbezogenen Predictive Policing
- χ. Drohende Lücken im Grundrechtsschutz
- δ. Lösung: Die objektiv-rechtliche Schutzfunktion der Grundrechte
- 1.2. Die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in der ortsbezogenen Prognose
- 1.3. Die Eingriffsschwelle der ortsbezogenen Prognose
- a. Eröffnung des Schutzbereichs des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung
- α. Öffentlich zugängliche Daten
- β. Soziostrukturelle Daten
- χ. Geokoordinaten und damit verbundene Informationen
- b. Mögliche Rechtfertigung
- 1.4. Probleme um die Einhaltung des verfassungsrechtlichen Rahmens
- 1.5. Fazit
- 2. Transparenz als übergreifende verfassungsrechtliche Grenze
- 2.1. Verschiedene Formen der Intransparenz
- 2.2. Staatliche Geheimhaltungsbefugnisse
- 2.3. Die Rolle der Transparenz im Verfassungsrecht
- a. Informationsfreiheit
- b. Rechtsstaats- und Demokratieprinzip
- c. Sonstige Grundrechte
- d. Landesverfassungen
- e. Europarecht
- 2.4. Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Transparenz von Predictive Policing-Systemen
- a. Grundsätze
- b. Exkurs: State v. Loomis
- c. Transparenz bei ortsbezogenen Systemen
- 2.5. Kontrolle und Durchsetzung der Transparenzregeln
- a. Rolle der Öffentlichkeit
- b. Rechte von Prognosen Betroffener
- c. Rolle staatlicher Kontrollinstanzen
- α. Bestehende und mögliche Kontrollinstanzen
- β. Rechtsprechung des BVerfG: ATDG und BKA-Gesetz
- χ. Übertragbarkeit auf Predictive Policing
- d. Rechte der Parlamente und Abgeordneten
- 2.6. Fazit
- 3. Personenbezogene Fragen
- 3.1. Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- a. Grundsätzliche Einordnung
- b. Die automatisierte Datenverarbeitung durch Sicherheitsbehörden in der Rechtsprechung des BVerfG
- α. Rasterfahndung
- β. Automatisierte Kennzeichenerfassung
- χ. Antiterrordateigesetz I und II
- δ. Palantir
- c. Anwendbarkeit der Rechtsprechung auf personenbezogenes Predictive Policing
- α. Rasterfahndung – konkrete Gefahr
- β. Kennzeichenkontrollen – anlasslose Überwachung
- χ. ATDG, Palantir –Zweckbindung und hypothetische Datenneuerhebung im Licht der technischen Entwicklung
- d. Problemfelder jenseits der bestehenden Rechtsprechung
- α. Erhöhte Sichtbarkeit des Missbrauchspotentials
- β. Verbot der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen
- e. Europarechtliche Aspekte
- α. Art. 7 und 8 GRCh
- β. Urteile des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung
- χ. Gutachten des EuGH zum PNR-Abkommen mit Kanada
- δ. Urteil des EuGH zur PNR-Richtline
- ε. Fazit europarechtliche Aspekte
- f. Fazit informationelle Selbstbestimmung
- 3.2. Diskriminierung – Art. 3 GG
- a. Rechtlicher Rahmen: Art. 3 GG
- α. Allgemeiner Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG)
- β. Spezielle Diskriminierungsverbote, Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG
- αα. Rechtfertigung von Anknüpfungen in Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG
- ββ. Die einzelnen Merkmale des Abs. 3 S. 1
- χχ. Anwendungsbereich des Verbots mittelbarer Diskriminierung
- b. Mögliche Ursachen von Ungleichbehandlungen
- c. Maßstäbe für faire Algorithmen
- d. Personenbezogenes Predictive Policing und Art. 3 GG
- e. Statistische Ungleichbehandlungen und Rechtfertigungen
- α. Kein widerspruchsfreier Maßstab
- β. Kein prädestinierter Maßstabsgeber
- χ. Keine stigmatisierenden Anknüpfungen
- δ. Keine Rechtfertigung durch Vergleich mit menschlichem Verhalten
- ε. Konsequenzen dieser Grundsätze
- f. Sonstige Rechtfertigungen von Ungleichbehandlungen und Anknüpfungen
- g. Fazit
- 4. Grenzen aus dem Staatsorganisationsrecht
- 4.1. Gesetzgebungskompetenzen
- 4.2. Normenklarheit und Bestimmtheit
- 5. Sonstige Grenzen
- 6. Fazit
- V. Leitlinien jenseits klassischer Grenzen
- 1. Lektionen aus dem Menschenbild des Grundgesetzes
- 1.1. Die Menschenwürde als Schranke und Leitlinie
- 1.2. Bezüge zur Unschuldsvermutung
- 1.3. Das Vollzugsdefizit als freiheitliches Gut
- 1.4. Das Recht auf menschliche Entscheidung
- 2. Rechtspolitische Konsequenzen einer neuen verfassungsrechtlichen Realität
- 2.1. Predictive Policing als Element der Überwachungsgesamtrechnung
- 2.2. Kann es eine Pflicht zur Nutzung von Predictive Policing geben?
- 3. Normative Widersprüche durch algorithmische Entscheidungen: Automation Bias
- 4. Schlussfolgerungen
- VI. Fazit
- Literaturverzeichnis
I. Einführung
Die fortschreitende Digitalisierung macht Dinge möglich, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren. Zu diesen früher unvorstellbaren Szenarien gehört auch der Gedanke, dass ein Programm in der Lage sei, Prognosen zu zukünftigen Straftaten abzugeben. Selbst in der Science-Fiction-Literatur konnte man sich früher nur ausdenken, dass Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten in Zukunft diese Rolle übernehmen würden – so sah es etwa Phillip K. Dick in seiner vielzitierten Kurzgeschichte „The Minority Report“. Heutzutage ist die Perspektive eine andere: Inzwischen befeuern das chinesische „Social Scoring“-Programm und die biometrische Totalüberwachung in der chinesischen Provinz Xinjiang die Angst vor einem vollautomatisierten Überwachungsstaat.
Der Stand der Technik in Europa und den USA zeigt gegenüber diesen Dystopien ein wesentlich nüchterneres Bild. Die deutschen Polizeibehörden nutzen Software, die sie bei der Planung von Streifenfahrten unterstützen soll – die Software wird dabei als eine von verschiedenen Möglichkeiten zur Erkenntnisgewinnung genutzt. Biometrische Videoüberwachung wird in Deutschland bislang kaum eingesetzt, über die Ausgereiftheit der Technologie besteht Uneinigkeit.1 Die bisherigen Rechtsgrundlagen für die Technologie sind jedoch schon in ihren Pilotphasen umstritten: Zur teilweisen Verfassungswidrigkeit des hessischen „Palantir-Paragraphen“ § 25a HSOG und seines Hamburger Äquivalents § 49 HmbPolDVG erging kurz vor Fertigstellung dieser Arbeit ein erstes Urteil des BVerfG.2 Für das Pilotprojekt zur biometrischen Videoüberwachung am Berliner Südkreuz war sogar umstritten, ob eine Rechtsgrundlage überhaupt existiert.3
In vielerlei Hinsicht ist es (insbesondere bei ortsbezogenem Predictive Policing) bislang schwierig zu beurteilen, wie weit Grund zur Sorge besteht oder ob hier bloß die Digitalisierung bestehender Polizeiarbeit vonstattengeht. Der Automatisierungsgrad der unter den Begriff subsumierten Programme ist teilweise noch gering: Analysen wie die der Gefährderprognosesoftware „RADAR-iTE“ des Bundeskriminalamtes könnten theoretisch auch analog mit Zettel und Stift durchgeführt werden.4 Mit zunehmenden technischen Möglichkeiten steigt aber das Potential zusätzlicher bzw. intensiverer Grundrechtseingriffe. Im Vordergrund stehen dabei bislang zwei Sorgen: Zum einen bietet die Kombination aus dem „Automation Bias“ – dem menschlichen Vorurteil, computergenerierte Ergebnisse als zuverlässig einzuschätzen – und der algorithmischen Verarbeitung z. B. durch rassistische Diskriminierung beeinträchtigter Datensätze ein hohes Risiko, bestehende Diskriminierungen zu verstärken. Zum anderen besteht die Gefahr, dass durch die Datafizierung der Polizeiarbeit und dem damit verbundenen Paradigmenwechsel eine stärkere Ausrichtung der Polizeiarbeit vom reaktiven in den präventiven Bereich erfolgt – Konsequenz wäre ein immer stärkeres Vordringen in das tatbezogene Vorfeld.5 Diese Sorgen und Gefahren werden in der vorliegenden Arbeit verfassungsrechtlich eingeordnet.
Die Arbeit soll einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion um das Forschungsfeld der vorhersagebasierten Polizeiarbeit, des sog. Predictive Policing, leisten. Zunächst erfolgt eine kurze Untersuchung der theoretischen Grundlagen des Predictive Policing sowie eine Bestandsaufnahme sowohl ortsbezogener als auch personenbezogener Predictive Policing-Software in Deutschland (Kapitel II und III). In diesen Kapiteln wird als Grundlage für die weiteren Kapitel herausgearbeitet, wie weit Predictive Policing bloß bekannte Methoden effizienter gestaltet und inwiefern es das Potential hat, Polizeiarbeit zu revolutionieren.
Sodann wird ermittelt, ob es unabhängig von den konkret eingesetzten Programmen abstrakte verfassungsrechtliche Anforderungen für die Technik und ihren Einsatz geben kann und soll (Kapitel IV). Hierbei wird auch mit Hilfe von Rechtsprechung und Literatur zu vergleichbaren Methoden herausgearbeitet, wie die Ansätze zur Kontrolle analoger oder zumindest nicht prognostizierender Polizeiarbeit auf Predictive Policing übertragbar sind. Der Fokus liegt dabei auf Ansprüchen an die Transparenz der Systeme, Eingriffen und Rechtfertigungsanforderungen für die informationelle Selbstbestimmung sowie potentiellen Verstößen gegen die Gleichheitsgrundsätze.
Im letzten Teil der Arbeit wird untersucht, wie weit der Einsatz der Algorithmen, der nicht an bestehenden Maßstäben gemessen werden kann, eine Herausforderung für das Verfassungsrecht und die juristische Methodik darstellt (Kapitel V). Es geht dabei insbesondere um Fragen, die nicht eindeutig einzelnen Verfassungsnormen zugeordnet werden können oder um Probleme, bei denen sich keine konkreten verfassungsrechtlichen Einschränkungen ableiten lassen, weil sie nicht in die konventionelle Verfassungsdogmatik eingeordnet werden können.
Bei allen diesen Fragen ist zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der bisherigen Forschung zu Predictive Policing das Thema aus der Perspektive der Soziologie und der Kriminologie beleuchtet. Wesentlicher Forschungsbeitrag der Dissertationsschrift soll daher in dem Transfer dieser soziologischen und kriminologischen Erkenntnisse in den Rahmen des materiellen (Verfassungs-)Rechts bestehen. Viele juristische und soziologische Arbeiten zum Thema Predictive Policing befassen sich darüber hinaus primär mit der Frage, ob die darunter gefassten Methoden und Strategien wirksam sind bzw. sein können. In bislang veröffentlichten rechtswissenschaftlichen Dissertationsschriften wurde das Thema umfassend und in diesem Rahmen gleichermaßen kriminologisch, verfassungsrechtlich und am einfachgesetzlichen Maßstab untersucht – so etwa bei Sommerer in Bezug auf das personenbezogene Predictive Policing und bei Hofmann für ortsbezogenes Predictive Policing.6 Eine solche umfangreiche Darstellung ist nicht Ziel dieser Arbeit. Kriminologische, einfachgesetzliche und entstehungsgeschichtliche Fragestellungen werden daher nur so weit dargestellt, als es für die Erforschung der verfassungsrechtlichen Probleme notwendig ist. Hierfür wird auf die oben genannten Arbeiten sowie auf die schwerpunktmäßig kriminologische Dissertation von Thüne verwiesen.7
Leitfragen dieser Arbeit sind somit: Welche Grenze setzt die Verfassung Prognosen im Rahmen des Predictive Policing – und wo offenbaren sich durch neue Möglichkeiten des Predictive Policing bisher noch nicht gestellte verfassungsrechtliche Fragen?
Vor allen diesen Fragen soll jedoch zunächst der Begriff und die Entwicklung des Predictive Policing dargestellt werden.
1. Begriff und Arten des Predictive Policing
Predictive Policing ist eine Methode, bei der Daten mittels kriminologischer Theorien ausgewertet werden, um Prognosen über zukünftige Straftaten zu erstellen. Eine einheitliche exakte Definition des Begriffs gibt es nicht, obwohl (oder vielleicht vielmehr weil) es zu dem Thema etwa seit 2009 insbesondere in den USA umfangreiche Forschungsliteratur gibt. International häufig zitiert wird insbesondere Uchidas Definition von Predictive Policing als “multi-disciplinary, law enforcement-based strategy that brings together advanced technologies, criminological theory, predictive analysis, and tactical operations that ultimately lead to results and outcomes – crime reduction, management efficiency, and safer communities”.8 Andere Definitionen sind vergleichbar weit, da unter den Begriff des Predictive Policing eine Vielzahl verschiedener Methoden subsumiert werden sollen. Immer geht es um die computergestützte Auswertung von Daten mit kriminologischen Mitteln zur Prognose künftiger Straftaten.9 Im deutschsprachigen Raum, wo bislang vor allem ortsbezogene Systeme Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen waren, wird unter anderem im Rückgriff auf die oben genannte Definition Predictive Policing definiert als „die polizeiliche Anwendung von analytisch-digitalen Verfahren, um operative Prognosen in Bezug auf wahrscheinliche Ursprünge bzw. Zeiten und Orte zukünftiger Kriminalität zu generieren und umzusetzen“.10 Hofmann spricht nach ausführlicher Analyse der Genese des Begriffs über
die zielgerichtete Verarbeitung von Daten und / oder personenbezogenen Daten aus polizeilichen Dateisystemen und / oder polizeifremden Dateisystemen anhand von spezifisch konzipierten Algorithmen auf der Grundlage von kriminologischen Theorien zur Ermittlung einer statistischen Wahrscheinlichkeit über die Tat, den / die Täter, die Tatzeit, den Tatort, das Opfer einer Straftat oder eine Kombination jener Desiderate zur Unterstützung der polizeilichen Kriminalprävention oder der Aufklärung bereits begangener Delikte.11
Dass teilweise derart lange Definitionen bemüht werden, demonstriert auch die Schwierigkeit eines solchen Unterfangens. Aufgrund des technischen Fortschrittes, der zunehmenden Kreativität der Ermittlungsbehörden bei Nutzung der dadurch geschaffenen Möglichkeiten und wahrscheinlich vor allem aufgrund der fehlenden Notwendigkeit einer klaren Definition wird es wohl auch in absehbarer Zeit hierzu keine Einigkeit geben. In Anbetracht der Dynamik, mit der sich die verschiedenen Technologien entwickeln und aktuelle Fantasien übersteigen können, ist eine einheitliche und starre Definition ohnehin nicht sinnvoll.
Diese Dynamik zeigt sich insbesondere bei personenbezogenen Anwendungen, wo das Fehlen einer exakten Definition für erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten sorgt, welche teilweise nur mit Hilfe ausgesprochen spezifischer Präzisierungen zu lösen wären.12 Da es aber keinerlei Regularien gibt, die Predictive Policing als Ganzes betreffen, hat die daraus folgende Ambiguität keinerlei praktische Bedeutung, sondern erschwert höchstens die wissenschaftliche Kategorisierung. Die verschiedenen Systeme, die unter den Begriff gefasst werden können, sind zudem in ihren Funktionsweisen so unterschiedlich, dass durch die Subsumtion unter den Oberbegriff kaum Aussagen über die Intensität damit verbundener Grundrechtseingriffe gemacht oder sonstige rechtspolitisch relevanten Schlüsse daraus gezogen werden könnten. Zahlreiche überwiegend nicht als Predictive Policing klassifizierte, aber der Logik stark ähnelnde Systeme wie die biometrische Videoüberwachung und der Einsatz künstlicher Intelligenz bei Grenzkontrollen greifen etwa in gleichem Maße, wenn nicht gar höher in die Grundrechte Betroffener ein, während sich bei ortbezogenem Predictive Policing oft die Frage stellt, ob überhaupt ein Grundrechtseingriff vorliegt.
Sprachlich wird am Begriff des Predictive Policing vereinzelt kritisiert, dass die Prognose keine prediction, sondern vielmehr ein forecast sei, da predictions subjektiv-intuitiv seien und forecasts objektiv-wissenschaftlich.13 Während die beiden Begriffe in anderen Wissenschaften (wie z. B. der Seismologie) strikt getrennt werden, werden sie jedoch in der Auseinandersetzung mit Predictive Policing wie im allgemeinen Sprachgebrauch üblicherweise synonym verwendet. Im Deutschen ist diese Unterscheidung ohnehin nicht sprachlich abbildbar.
In Deutschland wird fast durchgehend der englische Begriff verwendet, übersetzte Begriffe sind selten isoliert anzutreffen. Gängige Übersetzungen sind insbesondere „vorausschauende“ bzw. „vorhersagende Polizeiarbeit“.14 Daneben wird deutlich seltener auch der Begriff „vorhersagebasierte Polizeiarbeit“ verwendet, um in Abgrenzung zu den beiden Begriffen zu verdeutlichen, dass die Strategien auf den Prognosen beruhen, sich darin aber nicht erschöpfen.15
Die oben genannten Definitionen treffen im Kern drei Aussagen darüber, was unter Predictive Policing zu verstehen ist.16 Zunächst werden davon nur computergestützte Analyseverfahren, insbesondere solche der prädiktiven Analytik, erfasst. Diese Beschränkung zeigt vor allem auf, worin das wesentlich Neue der Methoden besteht: Die mit dem Computer meistens algorithmisch erstellten Prognosen können sehr schnell erstellt werden, entsprechend können die Ergebnisse einfach und regelmäßig in die unmittelbare Polizeiarbeit Einfluss finden. Die dabei angewandten Theorien sind überwiegend nicht neu, waren jedoch von Hand nur mit einem deutlich ressourcenintensiveren und damit oft schlichtweg unverhältnismäßigen Aufwand zu bewältigen.
Zweitens bleibt damit offen, aus welchen Quellen die zu analysierenden Daten kommen. Es muss sich dabei nicht immer um polizeilich erhobene Kriminalitätsdaten handeln.17 Insbesondere im Bereich des personenbezogenen Predictive Policing ist dieses weite Verständnis essenziell, etwa bei der Einordnung der biometrischen Videoüberwachung oder beim Abgleich von Fluggastdaten nach dem FlugDaG/der PNR-Richtlinie, wo auch Kameraaufnahmen und Fluggastdaten verarbeitet werden. Wie weit darüber hinaus auf Daten zugegriffen werden darf, wird in der Arbeit gesondert untersucht.
Zuletzt schränken die Definitionen kaum ein, was genau prognostiziert wird. Predictive Policing prognostiziert nicht nur Räume, an denen Straftaten zu erwarten sind, sondern auch potentielle Täter und Opfer (wobei Opfer bislang nur bei bestimmten Programmen in den USA Prognosegegenstand sind).
Bislang wird innerhalb des Predictive Policing primär zwischen orts- und personenbezogenen Verfahren unterschieden. Beim orts- bzw. raumbezogenen Predictive Policing beziehen sich die Prognosen auf künftige Risikoorte und -zonen. Personenbezogene Verfahren hingegen prognostizieren potentielle Täter und Opfer. Ortsbezogene Verfahren sind bislang sowohl in Deutschland als auch international stärker verbreitet, jedoch gewinnt personenbezogenes Predictive Policing immer mehr an Bedeutung. Zu letzterem ist anzumerken, dass personenbezogenes Predictive Policing in der Praxis oft nicht als solches bezeichnet wird und bei einzelnen computergestützten Maßnahmen auch in der Wissenschaft umstritten ist, wie sie eingeordnet werden sollen.
2. Entwicklung18
Während die ersten Versuche einer Kriminalgeografie bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, wurden die ersten wissenschaftlichen Versuche, mit statistischen Methoden kriminologische Prognosen zu erstellen, in den 1920er Jahren in den USA angestellt. Insbesondere versuchten Kriminologen dabei die Rückfallwahrscheinlichkeit vorzeitig aus der Haft Entlassener zu berechnen, waren aufgrund der schlechten Datenlage aber ausgesprochen unpräzise.19 Die ersten Theorien, die als Grundlagen für Modelle des ortsbezogenen Predictive Policing herangezogen werden, beruhen auf dem Konzept der Repeat Victimisation und werden seit den 1970ern intensiv diskutiert.20 Obwohl bereits die ersten amerikanischen Prognoseversuche in Deutschland schon in den 1930ern rezipiert wurden,21 begann die ernsthafte Auseinandersetzung mit zukünftiger Kriminalität hierzulande erst in den 1990ern und nahm in den 2000er Jahren dann erheblich an Fahrt auf.22 Diese Ansätze waren aber nicht operativer, sondern überwiegend strategischer Natur; meist war das Ziel, eine Stütze für die Personalpolitik zu finden.
Die ersten Ansätze für operative Prognosen, die Einfluss auf die alltägliche Einsatzplanung haben sollen, kommen ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Zu den Pionieren des Predictive Policing als wichtigstem Teil dieser Prognosen gehört das Los Angeles Police Department (LAPD) unter Polizeichef William J. Bratton, der das Konzept durch Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Wissenschaft und anderen Sicherheitsbehörden popularisiert hat.23 Im Anschluss hieran übernahmen zunächst zahlreiche Großstädte in den USA die Methoden. Durch intensive mediale Berichterstattung, insbesondere über das aus Los Angeles stammende Programm PredPol, wurde Predictive Policing auch der breiten Öffentlichkeit bekannt.
Pionier der Predictive Policing-Arbeit für den deutschsprachigen Raum ist die 2011 vom Institut für musterbasierte Prognosetechnik (IfmP) entwickelte Software PRECOBS (Pre Crime Observation System). PRECOBS begann seinen Einsatz in Deutschland im Rahmen von Pilotprojekten in Bayern und Baden-Württemberg im Jahr 2015. Zeitgleich entwickelte das LKA NRW mit SKALA ein eigenes ortsbezogenes Predictive Policing-System.
1 Deutscher Anwaltverein, Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Gefahrenabwehrrecht zur sog. intelligenten Videoüberwachung, 2017.
2 BVerfG, Urteil vom 16. Februar 2023 – 1 BvR 1547/19 -.
3 Vgl. BT-Drs. 19/5011, S. 1 ff.
4 Bei RADAR-iTE handelt es sich um ein System, das mit einem Fragenkatalog die Gefährlichkeit sogenannter Gefährder einschätzen soll. Vertieft dazu siehe S. 47 ff., kurz dargestellt auch bei BKA, RADAR (Regelbasierte Analyse potentiell destruktiver Täter zur Einschätzung des akuten Risikos), abrufbar unter https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/PMK/Radar/radar_node.html (zuletzt abgerufen am 31.07.2023).
5 Egbert, Predictive Policing in Deutschland. Grundlagen, Risiken, (mögliche) Zukunft, in: Strafverteidigervereinigungen (Hrsg.).: Räume der Unfreiheit, 2018, S. 241, 265.
6 Sommerer, Personenbezogenes Predictive Policing, 2020; Hofmann, Predictive Policing, 2020.
7 Thüne, Predictive Policing, 2020.
8 Uchida, Predictive Policing 2014, S. 3871.
9 Z. B. als “The application of analytical techniques—particularly quantitative techniques—to identify likely targets for police intervention and prevent crime or solve past crimes by making statistical predictions” (Perry/McInnis/Price/Smith/Hollywood, Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations 2013, S. 1 f.); “Any policing strategy or tactic that develops and uses information and advanced analysis to inform forward-thinking crime prevention” (Morgan, zitiert in Uchida, A National Discussion on Predictive Policing: Defining Our Terms and Mapping Successful Implementation Strategies, NCJ 230404, 2010, S. 1); teilweise aber auch rein ortsbezogen verstanden als “the collection and analysis of data about previous crimes for identification and statistical prediction of individuals or geospatial areas with an increased probability of criminal activity to help developing policing intervention and prevention strategies and tactics” (Meijer/Wessels Predictive Policing: Review of Benefits and Drawbacks, International Journal of Public Administration, 42:12 (2019), S. 1031, 1033).
Details
- Pages
- 254
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631929872
- ISBN (ePUB)
- 9783631929889
- ISBN (Softcover)
- 9783631929858
- DOI
- 10.3726/b22537
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (April)
- Keywords
- Künstliche Intelligenz Predictive Policing Polizei Verfassungsrecht
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 254 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG