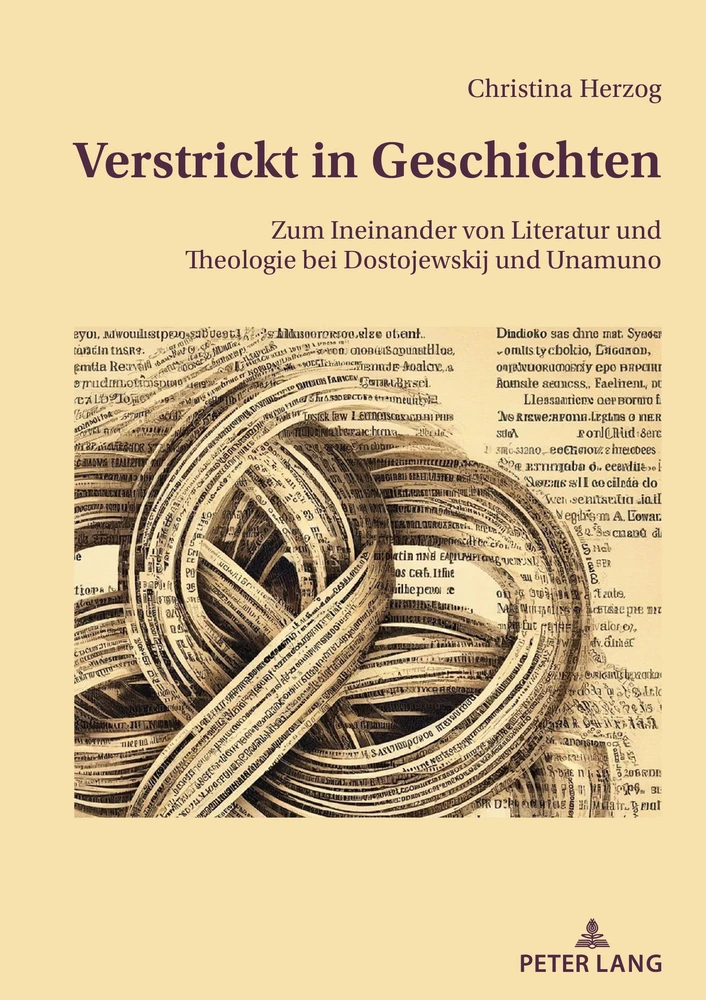Verstrickt in Geschichten
Zum Ineinander von Literatur und Theologie bei Dostojewskij und Unamuno
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Die Erzählung als Ort der Auseinandersetzung des Menschen mit sich und der Welt
- Lesen im Beziehungsdreieck Autor-Text-Leserschaft
- Die Problematik des dreifachen Lesens
- Die fiktionale literarische Erzählung als freie Bühne
- Der streitbare Spanier und der vertrackte Russe
- Verstrickt in Geschichten
- Methodische Vorüberlegungen
- 1. Teil: Analyse der Texte
- 1. Dostojewskij:
- 1.1. Einführung
- 1.2. Äussere Gegebenheiten, Raum und Zeit
- 1.2.1. Orte und Wege
- 1.2.2. Zeit und Atmosphäre
- 1.2.3. Finanzielle und gesellschaftliche Umstände
- 1.3. Eigenschaften
- 1.4. Verstrickt mit Leib und Seele: Die Macht der Empfindungen
- 1.5. Das neue Wort aussprechen: Die Macht der Ideen
- 1.6. Das Netz der Beziehungen: Verstrickung und Lösung
- 1.6.1. Aljona Iwanowna
- 1.6.2. Lisaweta
- 1.6.3. Marmeladow
- 1.6.4. Dunja
- 1.6.5. Rasumichin
- 1.6.6. Porfirij
- 1.6.7. Swidrigajlow
- 1.6.8. Sonja
- 1.7. Das Wirken überirdischer Mächte
- 1.8. Zusammenfassung
- 2. Unamuno: Abel Sánchez
- 2.1. Einführung
- 2.2. Abel Sánchez: Eine Leidensgeschichte
- 2.3. Zusammenfassung
- 2. Teil: Vergleich von Verbrechen und Strafe und Abel Sánchez
- 1. Einführung
- 2. Verbrechen und Strafe und Abel Sánchez im Überblick
- 3. Die Rolle des Bewusstseins
- 4. Innere und äussere Realität
- 5. L’enfer, c’est les autres?
- 6. Die Gesamtstruktur der Erzählung als Spiegel der Verstrickung und Lösung
- 7. Dostojewskijs Lazarus und Unamunos Kain und Abel
- 8. Abschliessende Betrachtung
- 3. Teil: Wie lesen? Entwurf eines Vektorenmodells
- 1. Lesen im Beziehungsdreieck
- 2. Vektorenmodell des dreifachen Lesens
- 3. Plädoyer
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Abstract
Fjodor M. Dostojewskij (1821–1881) in Russland, Miguel de Unamuno (1864–1936) in Spanien: zwei Autoren, deren Feder jeweils für ihr Land (und darüber hinaus) und ihre Zeit bis in die Gegenwart hinein prägend war, in den Bereichen der Geisteswissenschaften, Politik und Gesellschaft ebenso wie im ästhetisch-künstlerischen Bereich der Literatur. Besonders die fiktionalen literarischen Werke, die eine je ganz eigene Form ästhetisch-literarischer Gestaltung aufweisen, zeugen von einer lebenslangen intensiven Auseinandersetzung beider Autoren auch mit philosophischen und christlich-theologischen Fragen, einmal unter russisch-orthodoxen, einmal unter römisch-katholischen Vorzeichen. Diese Auseinandersetzung beider ist von Seiten der christlichen Theologie und Philosophie vielfach rezipiert. Auffällig an vielen Arbeiten zu literarischen Texten aus einer solchen Perspektive war bis noch vor wenigen Jahren, dass das Hauptaugenmerk auf ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Fragestellung (zugehörig dem Was des Textes) gerichtet wurde, wie sie auch ausserhalb des literarischen Textes formuliert werden kann, wogegen die künstlerisch-ästhetische Seite in den Hintergrund trat. Betrachtungen zum Wie des Textes wurden unter jenem Blickwinkel von Philosophie und Theologie häufig ausser Acht gelassen. In letzter Zeit ist das Bewusstsein für die Problematik dieser Schwerpunktsetzungen in deutlichem Mass gestiegen. Noch gibt es allerdings wenige Beiträge, die mit konkreter Arbeit am Text die Annahme stützen, dass die Besonderheit der literarischen Gestaltung eines theologisch-philosophischen Themas an den spezifischen Text gebunden bleibt, aus dessen Zusammenhang nicht eine Aussage herausgehoben werden kann, ohne dass diese Besonderheit selbst dabei aufgehoben wird. Dies führt zum Hauptanliegen dieser Arbeit: eine Verschränkung literarischer Schöpfung und darin gestalteter philosophisch-theologischer Auseinandersetzung aufzuzeigen, wobei die narrative Form nicht nur als möglicherweise austauschbarer Rahmen, sondern tatsächlich als konstitutives Element einer solchen Auseinandersetzung verstanden wird. Auf dem Hintergrund verschiedener Zugänge seitens LeserInnen mit vorwiegend theologischem oder philosophischem Interesse soll erörtert werden, inwiefern eine grössere Aufmerksamkeit für die künstlerisch-ästhetische Seite des Textes sowie für das eigene Selbstverständnis und die eigene Position als LeserIn gewinnbringend sein kann. Es ist eine konstruktive Anregung, den Text verstärkt als Kunstwerk in den Blick zu nehmen und als solches in seinem Wesen und Anliegen besser zu verstehen.
Im ersten Teil der Arbeit werden in zwei Kapiteln der Roman Verbrechen und Strafe von Fjodor M. Dostojewskij und die Erzählung Abel Sánchez. Geschichte einer Leidenschaft von Miguel de Unamuno gesondert analysiert. Im Versuch, das Wie und das Was des Textes in ausgeglichenem Mass in Bezug zu setzen, wird mit dem Begriff der Verstrickung in Geschichten zwar ein Ausgangspunkt auf der thematischen Seite des Textes gesetzt, gleichzeitig jedoch auch der gestalterische Prozess angesprochen. Im zweiten Teil folgt ein Vergleich der Texte mit Blick auf das Verhältnis zwischen Autor, Text und Leserschaft. Überlegungen zu einem Vektorenmodell zum Lesen fiktionaler literarischer Texte bilden einen dritten Teil, worauf ein Plädoyer für eine weitergehende Annäherung an die Literaturwissenschaft seitens der Philosophie und der christlichen Theologie die Arbeit abschliesst.
Einleitung
Die Erzählung als Ort der Auseinandersetzung des Menschen mit sich und der Welt
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum bin ich? Wozu bin ich? Wer bin ich? Was ist gut? Was ist schlecht? Wie soll ich handeln?
Seit jeher haben wir Menschen uns diese Fragen gestellt und auf vielfältige Weise versucht, Antworten zu finden. Erste schriftliche Zeugnisse dieser Versuche in der jüdischen Tradition sind die Schöpfungserzählungen der Genesis. Die Erschaffung der Welt, der Pflanzen, Tiere und Menschen, wird als Geschichte erzählt, in der die Schöpfungshandlungen eines als Ursprung des Lebens angenommenen Gottes konsekutiv angeordnet sind. Die Beziehungsgeschichte der Menschen mit diesem Schöpfergott und die daraus entspringenden Fragen nach Sterblichkeit und Geschöpflichkeit, nach der Unterscheidung von Gut und Böse, nach Freiheit und Bestimmung, nach Macht und Herrschaft finden Eingang in die ersten Texte des Alten Testaments in den Geschichten von Adam und Eva, Kain und Abel und vielen weiteren.
Biblische Geschichten sind also eine Form von Theologie im ganz ursprünglichen Sinn: eine erzählende Rede von Gott und den Menschen, noch lange bevor die wissenschaftliche Theologie sich diese in Gestalt der Bibelwissenschaft, Exegese, Systematik oder Dogmatik zum Gegenstand macht. Generell (literarische) Geschichten als Orte der Auseinandersetzung zu betrachten, ist daher naheliegend. Das Erzählen von Geschichten, um sich selbst und die Welt zu beschreiben, zu ordnen und zu deuten, um das bereits Erfahrene und Erkannte zu erinnern, untereinander zu teilen und an die kommenden Generationen weiterzugeben, um sich zu unterhalten, Gemeinschaft zu pflegen oder sich von Anderen abzugrenzen, ist eine der ursprünglichsten gemeinschafts- und identitätsstiftenden Handlungen.
Mythen, Epen, Dramen, Lieder, Psalmen, Sagen, Märchen, Fabeln, Gleichnisse, Gedichte, Romane, Erzählungen – der Reichtum an Formen und Gattungen mündlicher wie schriftlicher Überlieferungen zeigt auch, dass die Auseinandersetzung des Menschen mit sich, den Anderen und der Welt unabhängig von Ort, Zeit, Kultur und Sprache zwar in durchaus unterschiedlicher Gestalt, doch immer schon auch auf erzählende Weise stattgefunden hat. Geschichten, ob nun eher fiktionale oder faktengebundene, sind demnach eine wesenhaft menschliche bzw. allen Menschen gemeinsame sprachliche Ausdrucksform dessen, was uns im Innersten bewegt. Die Praxis des Erzählens an sich, das, was die Geschichte als solche definiert und das, was in der Geschichte erzählt wird, folgen in aller Vielfalt ähnlichen Mustern und berufen sich auf ein grundlegendes gemeinsames Verständnis.
Lesen im Beziehungsdreieck Autor-Text-Leserschaft
Über dieses grundlegende Verstehen des Erzählens bzw. des Erzählten hinaus ist jedoch auch von unterschiedlichen (Vor-)Verständnissen, Erwartungen und Interessen seitens der Erzählenden wie auch der Hörer- oder LeserInnen auszugehen. Über die Geschichte treten beide Seiten (die LeserInnen evtl. auch untereinander) in ein vielschichtiges Beziehungsgeschehen ein, das hier im Folgenden als „Beziehungsdreieck zwischen Autor, Text und Leserschaft“1 bezeichnet wird. Es dient als eine Art Koordinatensystem, in welchem verschiedene Verbindungen, (momentane) Verortungen und Standpunkte, Interessen, Zugänge oder Wirkungen beleuchtet werden können. Jeder Winkel des Dreiecks steht in Abhängigkeit von den beiden anderen. Weder der Autor noch sein Text noch die Leserschaft können für sich alleine existieren, auch wenn alle drei je nach Fragestellung in den Fokus gerückt werden, so z.B. als Bezugspunkte für entsprechende autor-, text- und leserorientierte Literaturtheorien.2
Allein schon bei der Leserschaft bzw. hier tatsächlich bei jeder einzelnen Leserin und jedem einzelnen Leser ist bereits ein ganzes Universum von Hintergrundinteressen auszumachen. So schwingt vielleicht ein soziologisches, psychologisches, naturwissenschaftliches, juristisches, geschichtliches, politisches oder eben philosophisches und theologisches Interesse an einer bestimmten Geschichte mit. Hier ist entsprechend auch mein eigenes Interesse als Theologin und als Leserin und als Literaturwissenschaftlerin darzustellen und einzuordnen.
Die Problematik des dreifachen Lesens
In diesem Und bzw. in dieser Dreiheit liegt das Zentrum der Problematik, der sich vorliegende Arbeit widmet. Aus der Perspektive der Theologin richtet sich der Blick hier einmal auf die Frage christlich geprägter Anthropologie, wie sie der Autor in der Darstellung seiner Figuren realisiert, auf den Einfluss philosophischer oder wissenschaftlich-theologischer Ideen, auf die Einarbeitung intertextueller, evtl. biblischer Motive. Als Leserin stellt sich die Frage nach der Wirkung des Textes auf meine Person, im lesenden Nachvollzug, in der Identifikation mit den Figuren, im (Mit-)Erleben der Geschichte. Als Literaturwissenschaftlerin wird der Text an sich Gegenstand beobachtender und beschreibender Analyse, die den Text als Kunst-Werk, als sprachliche Schöpfung erkennt, bevor die Interpretation beginnt.
Die Frage ist also, ob bzw. inwieweit sich gerade im Bewusstsein dieser Dreiheit die verschiedenen Anliegen und Zugänge gewinnbringend verbinden lassen. Präsentiert sich die theologische Frage im Kontext der Erzählung evtl. anders oder umfassender? Kann mit Hilfe literaturwissenschaftlicher Methoden ein besserer Einblick in die Struktur, Form und Gestaltung des Textes und damit eine breitere Grundlage zu dessen Deutung erarbeitet werden? Erweitert sich die Erkenntnis, verändert oder vertieft sich das Leseerlebnis?
Dieser ganze Komplex steht im Zusammenhang mit dem nicht unproblematischen Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Theologie und Literatur, das in verschiedensten Kombinationen und Schwerpunkten zwischen Ethik, Philosophie, christlicher Anthropologie, praktischer Theologie, Religionswissenschaft, Homiletik, Ästhetik, Poetik, Literaturtheorie, Literaturwissenschaft etc. bereits vielfach dargestellt und erörtert worden ist,3 und auf das als solches im Gesamten nicht noch einmal ausführlich eingegangen werden kann. In den letzten Jahren ist jedoch vermehrt die Beobachtung zu machen, dass auch aus theologischer Perspektive die Aufmerksamkeit für den Text als solchen wächst. Vielerorts ist bemerkt worden, dass sich bisher häufig das Hauptaugenmerk beim Lesen mit theologischem Interesse auf eine bestimmte Problematik (als Teil oder auch als übergeordnetes Thema des Was4 des Tíextes) richtete, wie sie auch ausserhalb des literarischen Textes formuliert werden kann, wogegen die künstlerisch-ästhetische Seite des Textes in den Hintergrund trat. Der Slawist und Dostojewskijforscher Horst-Jürgen Gerigk hat diese Problematik nicht nur in Bezug auf eine Leserschaft mit theologischem Interesse vor über 20 Jahren pointiert ausformuliert:
Niemand wird bestreiten, daß in der Dostojewskij-Forschung die Abhandlungen über seine moralische Botschaft weitaus zahlreicher sind als Analysen seiner Erzähltechnik. Das liegt daran, daß ganz offensichtlich die meisten Menschen Literatur ausschließlich daraufhin ansehen, was sie ihnen sagt: auf ihre Aussage, die dann auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft und kritisch beurteilt wird. Mit Bejahung und Ablehnung ist man meistens schnell bei der Hand. In einer solchen Perspektive wird die künstlerische Intelligenz eines Autors überhaupt nicht sichtbar. Sie aber ist, wenn man so will, die Seele seiner Kunst. Wer seinen Sinn nur auf die Aussage eines Kunstwerks richtet, wird allerdings die Faszination der gestalteten Inhalte durchaus verspüren, er setzt solche Faszination aber nur „irgendwie“ voraus, ohne sie in ihrem Grund zu bedenken, um sich sofort mit aller Aufmerksamkeit den vermittelten Inhalten zu widmen.5
Betrachtungen zu Darstellung bzw. Form, Anordnung, Stil, Struktur, Redeweise, Erzählperspektive, etc. (das Wie6 des Textes), für welche die Literaturwissenschaft wiederum ihre eigenen Methoden entwickelt hat und die in ihrer Feinarbeit im Gegenzug bis zur fast gänzlichen Loslösung vom Was des Textes geführt werden können, wurden unter jenem Blickwinkel von Philosophie und Theologie häufig ausser Acht gelassen. Die Annahme, dass die Besonderheit der literarischen Gestaltung einer solchen Frage aber doch gerade an den spezifischen Text gebunden bleibt, aus dessen Zusammenhang nicht eine Aussage herausgehoben werden kann, ohne dass diese Besonderheit selbst dabei aufgehoben wird, führt zum Hauptanliegen dieser Arbeit: die Verschränkung literarischer Schöpfung und darin gestalteter philosophisch-theologischer Auseinandersetzung aufzuzeigen, wobei die narrative Form nicht nur als möglicherweise austauschbarer Rahmen, sondern tatsächlich als konstitutives Element einer solchen Auseinandersetzung verstanden wird. Davon ausgehend soll erörtert werden, inwiefern denn eine grössere Aufmerksamkeit für die künstlerisch-ästhetische Seite des Textes sowie für das eigene Selbstverständnis, die eigene Position als LeserIn gerade mit theologischem Interesse gewinnbringend sein kann.
Die fiktionale literarische Erzählung als freie Bühne
Wieso diese Fragestellung konkret an zwei literarischen Erzählungen Dostojewskijs und Unamunos unter der Problematik der Verstrickung zwischen Bestimmung und Freiheit erörtert werden soll, wird im Folgenden dargestellt.
Dem Zusammentreffen meiner beiden Studienrichtungen Theologie und Romanistik sind einerseits persönliche Vorlieben für die Sprachen der Bibel und ihre Geschichten sowie für die (christliche) Philosophie entsprungen, andererseits für die französische Literatur und darin in erster Linie für die fiktionale Prosaliteratur des 18.–20. Jahrhunderts. Abgesehen vom sprachlichen und ästhetisch-darstellenden Reichtum bei Autoren wie Rousseau, Diderot, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Sartre und Camus findet sich darin eine Unmenge an grossen philosophischen und auch explizit theologischen Themenkomplexen7 wie die Natur des Menschen, der Mensch in der Gemeinschaft, Mann und Frau, Mensch und Gott, (christlicher) Glaube, Religion und Kirche, die oft in ausgesprochen analytischer, kritischer, mancherorts satirischer Art und Weise bearbeitet werden. Direkte Referenzen auf biblische Erzählungen und Motive sind vielerorts zu finden. Dass ähnliche Fragestellungen auch in der spanisch- und italienisch-, deutsch-, englisch-, russischsprachigen etc. Literatur verarbeitet sind, ist offensichtlich.
Wieso die fiktionale literarische Erzählung (zu der hier der Roman und die Novelle gezählt werden) besonders häufig als Bühne für solche Themen gewählt wird, erschliesst sich zumindest teilweise aus der ihr eigenen künstlerischen Gestaltungsfreiheit. Sie ist frei im Textumfang, in der Form der Prosa (im Vergleich beispielsweise zum Epos in Versform oder der Lyrik), in den Redeweisen (Dialog, Monolog, Beschreibung etc.) und Perspektiven (3. Person, 1. Person, Stimmen etc.). In der Fiktionalität ist sie nicht wie z.B. der Bericht, die Nachricht oder der wissenschaftliche Beitrag an Fakten, Daten, Gesetze, Regeln und andere Gegebenheiten aus Geschichte, Politik, Kultur, Kirche oder Wirtschaft gebunden. So setzt sich z.B. Science Fiction mancherorts phantasievoll über die Gesetze der Physik, den Stand der Technik etc. hinweg. Nur die äusseren Bedingungen und Umstände, unter denen der Text entsteht, wirken sich möglicherweise steuernd oder einschränkend auf Inhalt und Form aus: Vorgaben durch die Verleger, Vertragsbindungen oder auch die Zensur sind solche Faktoren. Dennoch bleibt die Freiheit in der Auswahl von Themen, Geschichten und Charakteren, in der Anordnung und Gestaltung von Ereignissen, Erlebnissen, Figuren, Zeitabschnitten, Lebensgeschichten grösstenteils bestehen, und sie erlaubt dem Autor, die Komplexität menschlicher Realität nach seinen Vorstellungen aufzunehmen und zu fassen. Diese menschliche Realität muss sich in der Erzählung gerade nicht in einer Systematik, einer schon festen bzw. statischen Ordnung abbilden, sondern kann organisch wachsen, sich entwickeln. In der ihr selbst immanenten Bewegung lassen sich in der Erzählung zeitliche und kausale Abfolgen, Prozesse und Entwicklungen, das Ineinandergreifen verschiedenster Elemente abbilden und nachvollziehen, ohne auf eine systematische Darstellung angewiesen zu sein.
Aus dieser Freiheit entspringt für den Autor die Notwendigkeit, eine Auswahl aus allen Möglichkeiten zu treffen und sie mitsamt ihren inneren und äusseren Bewegungen zu ordnen, zusammenzusetzen und schriftlich festzuhalten. Konzeption und Umsetzung werden zu einem Schöpfungsprozess, an dessen Ende ein literarisches Produkt, ein Kunstwerk steht. Es ist das neu zusammengesetzte Bild einer Welt und ihrer Menschen, so wie der Autor sie dieses eine Mal ausprobiert, gedeutet und gestaltet hat – sozusagen eine Welt auf Probe, ein Durchspielen eines Falles, der so und nicht anders im Text festgehalten ist. Horst-Jürgen Gerigk formuliert den lesenden und deutenden Nachvollzug dieses Prozesses als ein „Herauslegen“ dessen, was „Sache der Dichtung“ ist, nämlich in erster Linie das explizit und implizit aus dem Text hervortretende Menschenbild.
Die erste Aufgabe der Herauslegung dessen, was ein literarischer Text von sich aus zum Ausdruck bringt, besteht in der verbalen Fixierung der zentral gestalteten objektiven Situation (sei dies eine vermeintliche oder die tatsächliche) und der in sie eingelagerten subjektiven Situation des erlebenden Ich. An diese Aufgabe schließt sich als zweite die Herausarbeitung des Menschenbildes an, das von der im literarischen Text beschworenen Welt impliziert wird.
Das Menschenbild einer Dichtung legt fest, von welchen Realitäten der Mensch bestimmt wird, ob etwa die Angst vor dem Tod, körperlicher Schmerz oder materielle Not ihm etwas anhaben können. Das Menschenbild einer Dichtung ist immer Stellungnahme zu denjenigen Realitäten, die den Menschen überhaupt etwas angehen können – das heißt: es hat immer schon selektiert, was als wichtig zu gelten hat. Zwar ist das Menschenbild einer Dichtung umfassend, in dem es eine Stellungnahme zum Seienden im ganzen abgibt, doch kann diese Stellungnahme in ihrer Bestimmtheit immer nur selektiv sein – indem sie nämlich darüber entscheidet, welche der ewigen Realitäten aus dem Machtbereich der Seelenangst, des körperlichen Schmerzes und der materiellen Not auf welche Weise nach vorn gerückt werden. Das Menschenbild einer Dichtung liefert der zentral gestalteten subjektiven Situation die Ortsbestimmung innerhalb des Seienden im Ganzen. Man könnte auch sagen: das Menschenbild einer Dichtung ist das Koordinatensystem, innerhalb dessen die zentral geschilderte subjektive Situation ihren Ort erhält.8
Trotz der jeweiligen Einzigartigkeit der Erzählung und der jeweiligen einzigartigen Gestaltung der fiktiven Welt mit ihren Figuren und Geschichten, die durchaus verschieden von der konkret erfahrenen und erlebten Welt des Autors ist, liegt ihr wohl ein Menschen- und Lebensbild zugrunde, das ähnliche innere Zusammenhänge aufweist und ähnlichen Gesetzen folgt, wie sie der Autor in der eigenen Realität erfährt oder die er zumindest für möglich und schlüssig hält.9
Die fiktive Welt lässt sich also zumindest in der Deutung ihrer inneren Verknüpfungen als eine Art Ableitung dieser eigenen realen Autorenwelt verstehen. Wie „direkt“ die Erzählung, die durch die Sprache, durch ihre Ordnung und Gestaltung, durch die Wahl ihrer Figuren und ihres Themas bereits mehrfach gebrochen ist, die Erfahrungen und Gedanken des Autors verarbeitet oder abbildet oder inwieweit vice versa ausgehend vom Text auf den Autor und seine eigene Auseinandersetzung mit seiner Welt und seinem Menschsein geschlossen werden kann, ist eine der grossen (offenen) Fragen in der Literaturwissenschaft bzw. in den Literaturtheorien (Literaturphilosophien). Sie ist auf eine Art in autororientierten Theorien10 über eine Konzentration auf die historischen Zusammenhänge, die Bedingungen, Lebensumstände und Beziehungen des Autors und seine (Schaffens-)Psychologie ausserhalb seines Werkes zu beantworten versucht worden. Einflüsse aus den Wissenschaften, Philosophie und Theologie, Literatur etc., denen der Autor ausgesetzt ist oder sich selbst aussetzt, werden dabei einerseits als biographische behandelt, andererseits in ihren expliziten oder assoziativen Verarbeitungen im literarischen Werk aufgespürt. Als wesentliche Inspiration von aussen ist hier auch die Intertextualität biblischer Motive und Geschichten oder die Neuadaption biblischer Figuren zu nennen, die ebenfalls in das eigene Werk hineingetragen und verarbeitet werden.
Details
- Seiten
- 318
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783034349406
- ISBN (ePUB)
- 9783034349413
- ISBN (Hardcover)
- 9783034349390
- DOI
- 10.3726/b21970
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (November)
- Schlagworte
- Literatur und Religion Literaturwissenschaft Theologie Unamuno Dostojewskij
- Erschienen
- Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford, 2024. 318 S., 2 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG