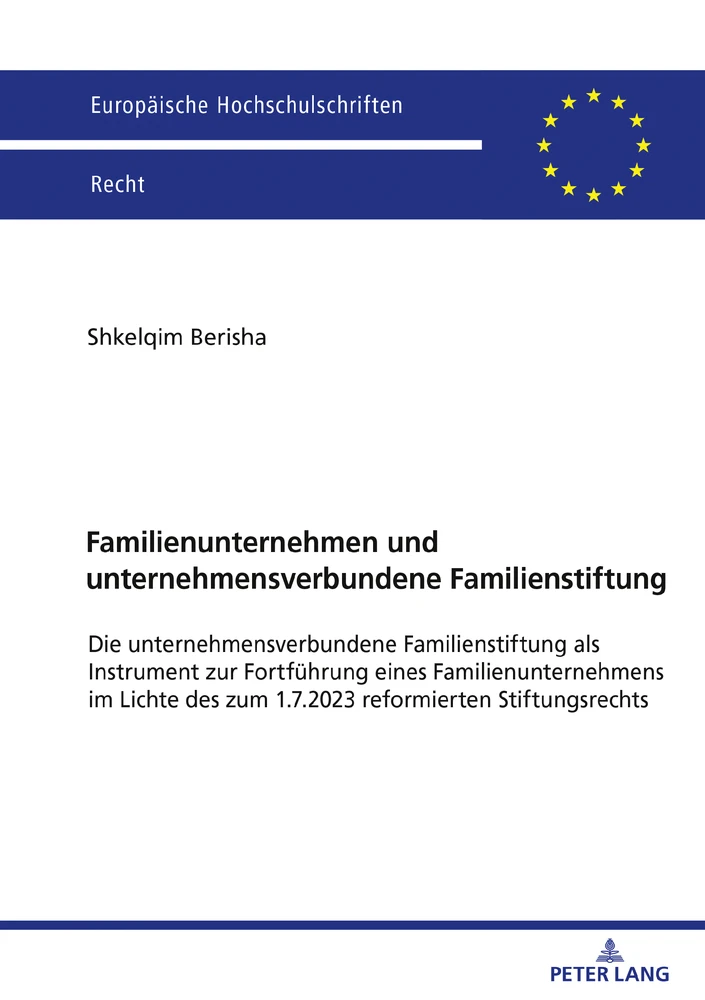Familienunternehmen und unternehmensverbundene Familienstiftung
Die unternehmensverbundene Familienstiftung als Instrument zur Fortführung eines Familienunternehmens im Lichte des zum 1.7.2023 reformierten Stiftungsrechts
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abdeckung
- Halbtitel
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Hingabe
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Teil 1: Einleitung
- A. Kontext und Ziel der Untersuchung
- B. Gang der Untersuchung
- Teil 2: Familienunternehmen und die Relevanz des Familieneinflusses
- A. Typus und Charakteristika eines Familienunternehmens
- I. Der Typus „Familienunternehmen“
- 1. Familiäre Verbundenheit
- 2. Einfluss der Familie
- a) Intensität des Familieneinflusses
- b) Argumentative Anleihe an § 290 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 HGB?
- 3. Zwischenergebnis
- II. Die Charakteristika eines Familienunternehmens
- 1. Verzahnung von Familie und Unternehmen
- a) Die Systeme Familie und Unternehmen
- b) Unternehmens- vs. Familieninteresse
- c) Balance zwischen den verschiedenen Interessen
- d) Zwischenergebnis
- 2. Erhöhtes Konfliktpotential
- 3. Nachfolgeproblematik
- a) Unternehmensnachfolge als die größte Herausforderung von Familienunternehmen
- b) Gestaltung der Unternehmensnachfolge
- aa) Gestaltungsziele
- bb) Typische Gestaltungsmöglichkeiten bei Familienunternehmen
- c) Unternehmensverbundene Familienstiftung als Instrument der Unternehmensnachfolge
- d) Zwischenergebnis
- B. Relevanz der Sicherung des Familieneinflusses im Rahmen einer Stiftungsgestaltung
- Teil 3: Relevante Aspekte bei der Wahl und Errichtung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung als Instrument zur Regelung der Familienunternehmensnachfolge
- A. Motive für den Einsatz von Familienstiftungen im Unternehmensbereich
- I. Familiäre Motive
- II. Unternehmensorientierte, wirtschaftliche Motive
- III. Steuerrechtliche Motive
- IV. Sonstige (insb. ideelle) Motive
- V. Zwischenergebnis
- B. Risiken und Herausforderungen einer Stiftungsgestaltung
- I. Allgemeine rechtsformbedingte Risiken
- 1. Starrheit der Stiftung
- 2. Strukturelles Kontrolldefizit
- 3. Staatliche Stiftungsaufsicht
- 4. Ersatzerbschaftsteuer für Familienstiftungen
- 5. Publizitätsgefahr durch Transparenz- und Stiftungsregister
- a) Transparenzregister (§§ 18 ff. GwG)
- aa) Bedeutung und Inhalt
- bb) Meldepflicht bei rechtsfähigen (Familien-)Stiftungen
- b) Stiftungsregister (§§ 82b ff. BGB i. V. m. StiftRG)
- aa) Bedeutung, Inhalt und Vertrauensschutz
- bb) Einsichtnahme für jedermann
- cc) Beschränkungsmöglichkeiten, insbesondere für unternehmensverbundene Familienstiftungen
- dd) Kritik und Auswirkungen auf unternehmensverbundene Familienstiftungen
- ee) Verhältnis zum Transparenzregister
- c) Legislatorische Empfehlung hinsichtlich der Berücksichtigung der Anonymitätsinteressen von Familienunternehmen und -stiftungen
- II. Spezifische Risiken für Familienunternehmen
- 1. Unumkehrbarkeit
- 2. Enteignung der Familie bzw. einzelner Familienmitglieder
- 3. Verlust des Einflusses und des Unternehmergeistes der Familie sowie deren Bindung zum Familienunternehmen
- 4. Publizitätsrisiko
- III. Zwischenergebnis: Reduzierung der Risiken durch Gestaltung und Kommunikation mit der Familie
- C. Zeitpunkt zur Errichtung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung
- I. Grundlegendes zur Stiftungserrichtung
- 1. Stiftungsgeschäft
- a) Organisationsrechtlicher Teil
- b) Vermögensrechtlicher Teil, insbesondere Höhe der Vermögensausstattung
- c) Schriftform bei Stiftungsgeschäft unter Lebenden ausreichend
- 2. Anerkennung und Vermögensübertragungspflicht
- a) Anerkennung durch die zuständige Landesstiftungsbehörde
- b) Vermögensübertragungspflicht
- II. Errichtung zu Lebzeiten oder von Todes wegen?
- III. Relevante gesellschaftsrechtliche Aspekte vor Übertragung der Gesellschaftsanteile
- Teil 4: Die rechtliche Verfassung der unternehmensverbundenen Familienstiftung im Lichte des reformierten Stiftungsrechts
- A. Begriff und Erscheinungsformen der unternehmensverbundenen Familienstiftung
- I. Stiftungsbegriff des BGB
- II. Unternehmensverbundene Stiftung
- 1. Unternehmensträgerstiftung
- 2. Beteiligungsträgerstiftung
- III. Familienstiftung
- 1. Grundlegendes
- 2. Die Familienstiftung speziell im unternehmerischen Kontext
- 3. Zwischenergebnis
- IV. Weitere besondere Erscheinungsformen unternehmensverbundener Familienstiftungen
- 1. Familienstiftung & Co. KG
- a) Grundlegendes
- b) (Un-)Zulässigkeit nach der Stiftungsrechtsreform 2021
- c) Künftig verstärktes Instrument zur Vermeidung von unternehmerischer Mitbestimmung gerade bei Familienunternehmen?
- 2. Doppelfamilienstiftung
- 3. Gemischte Familienstiftung
- 4. Stammesfamilienstiftung
- B. Grundsätzliches zur Zulässigkeit unternehmensverbundener Familienstiftungen
- I. Verbot der Unternehmensselbstzweckstiftung
- II. Grundsätzlich uneingeschränkte Zulässigkeit
- III. Zwischenergebnis und Praxisempfehlung für die Anerkennung
- C. Die besondere Bedeutung des Stifterwillens
- D. Stiftungssatzung und Stiftungszweck
- I. Stiftungssatzung
- 1. Grundlegendes
- 2. Satzungsänderungsmöglichkeiten
- a) Rechtszersplitterung im alten Recht
- b) Bundeseinheitliche Regelungen im neuen Recht
- aa) Voraussetzungen für Satzungsänderungen
- (1) Die Identität der Stiftung verändernde Zweckänderungen
- (2) Andere Zweckänderungen und Änderungen anderer prägender Satzungsbestimmungen
- (3) Änderung sonstiger (einfacher) Satzungsbestimmungen
- (4) Abweichende Regelung durch den Stifter
- (a) Ausschluss oder Beschränkung von Satzungsänderungen
- (b) Erweiterung der organschaftlichen Änderungsrechte
- (c) Regelungsstandort der entsprechenden abweichenden Bestimmungen
- bb) Verfahren bei Satzungsänderungen
- (1) Satzungsänderung durch die Organe
- (2) Satzungsänderung durch die Stiftungsbehörde
- (3) Sonderregelung für Sitzverlegungen
- (4) Keine Satzungsänderung gegen den Willen des Stifters
- cc) Anmeldung von Satzungsänderungen im Stiftungsregister
- dd) Zu- und Zusammenlegung sowie Aufhebung und Auflösung der Stiftung
- c) Keine Einführung eines lebzeitigen Änderungsrechts des Stifters und Ablehnung korporativer Strukturen im Stiftungsrecht durch den Reformgesetzgeber 2021
- 3. Zwischenergebnis
- II. Stiftungszweck
- 1. Grundlegendes
- 2. Besondere Zwecke einer unternehmensverbundenen Familienstiftung
- 3. Stiftungszweck und Unternehmensinteressen
- E. Stiftungsvermögen
- I. Grundlegendes nach altem Recht
- II. Grundlegendes nach neuem Recht
- 1. Das Stiftungsvermögen nach § 83b BGB
- a) Regelung allein im Stiftungsgeschäft ausreichend
- b) Zusammensetzung des Stiftungsvermögens
- aa) Grundstockvermögen
- bb) Sonstiges Vermögen
- c) Gesetzliche Fixierung der sog. Teilverbrauchsstiftung
- 2. Die Verwaltung des Grundstockvermögens nach § 83c BGB
- a) Bundeseinheitliche Kodifizierung des Vermögenserhaltungsgrundsatzes
- b) Umschichtungszuwächse und Teilverbrauch des Grundstockvermögens
- III. Zwischenergebnis
- F. Stiftungsorganisation
- I. Stiftungsvorstand
- 1. Grundlegendes
- 2. Vertretungsmacht des Stiftungsvorstands
- a) Grundlegendes und Beschränkung auf den Stiftungszweck
- b) Nachweis der Vertretungsmacht de lege lata et ferenda
- II. Fakultative Organe
- III. Zulässigkeit von Geschäfts-/Nebenordnungen
- IV. Innenhaftung der Stiftungsorgane nach neuem Recht
- 1. Anspruchsgrundlage
- 2. Pflichtverletzung und Business Judgment Rule
- a) Pflichtverletzung
- b) Business Judgment Rule
- aa) Im alten Recht bereits ohne gesetzliche Regelung anerkannt
- bb) Nunmehr gesetzliche Normierung in § 84a Abs. 2 S. 2 BGB
- 3. Sorgfaltsmaßstab gem. § 84a Abs. 2 S. 1 BGB und Verschulden
- a) Sorgfaltsmaßstab gem. § 84a Abs. 2 S. 1 BGB
- b) Verschulden
- 4. Schaden und Anspruchsdurchsetzung
- 5. Enthaftungsmöglichkeiten
- 6. Gestaltungsbedarf aufgrund der Stiftungsrechtsreform 2021
- G. Destinatäre
- I. Grundlegendes
- II. Die Rechts(los)stellung der Destinatäre
- H. Staatliche Stiftungsaufsicht
- I. Grundlegendes
- II. Stiftungsaufsicht über eine unternehmensverbundene Familienstiftung
- Teil 5: Gestaltungsaspekte zur Sicherung des Familieneinflusses auf Ebene der Familienstiftung und des Familienunternehmens
- A. Verzahnungsmöglichkeiten von Familienstiftung, Familienunternehmen und Familie
- I. Typ 1: Keinerlei Organbeteiligung der Familie
- II. Typ 2: Familie nur im Familienunternehmen vertreten
- III. Typ 3: Familie nur in der Familienstiftung vertreten
- IV. Typ 4: Familie auf Stiftungs- und Unternehmensebene vertreten
- V. Zwischenergebnis
- B. Einsatz- und Einflussmöglichkeiten des Stifters in der Familienstiftung
- I. Reichweite und Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Stifters
- II. Einflussmöglichkeiten des noch lebenden Stifters
- 1. Rechtsstellung des Stifters
- 2. Einflusssicherung durch statutarische Stifterrechte
- a) Widerrufs- und Rückforderungsrechte
- aa) Betreffend die Stiftungserrichtung
- bb) Betreffend die Unternehmensbeteiligung
- b) Einfluss auf die Organisation und Willensbildung der Familienstiftung
- aa) Etablierung von Stiftungsorganen
- bb) Bestellungs- und Abberufungsmodalitäten
- (1) Bestellungsmodalitäten
- (a) Bestellungsverfahren
- (b) Bestimmung der Organmitglieder
- (2) Abberufungsmodalitäten
- cc) Einwirkungsmöglichkeiten in Bezug auf die Willensbildung in der Stiftung
- dd) Zwischenergebnis
- C. Einsatz- und Einflussmöglichkeiten der Stifterfamilie auf Ebene der Familienstiftung
- I. Rechtsstellung der Stifterfamilie
- II. Involvierung der Familienmitglieder in die Familienstiftungsstruktur
- III. Family Business Foundation Governance
- D. Einsatzmöglichkeiten des Stifters und der Familienmitglieder auf Unternehmensebene
- E. Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten auf Ebene des Familienunternehmens zur Sicherung des Einflusses der Familienstiftung
- I. AG
- II. GmbH
- Teil 6: Zusammenfassung, Schlussbetrachtung und Ausblick
- A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
- I. Zu Teil 2: Familienunternehmen und die Relevanz des Familieneinflusses
- II. Zu Teil 3: Relevante Aspekte bei der Wahl und Errichtung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung als Instrument zur Regelung der Familienunternehmensnachfolge
- 1. Betreffend die Motive
- 2. Betreffend die Risiken und Herausforderungen einer Stiftungskonstruktion
- 3. Betreffend die Stiftungserrichtung
- III. Zu Teil 4: Die rechtliche Verfassung der unternehmensverbundenen Familienstiftung im Lichte des reformierten Stiftungsrechts
- 1. Betreffend den Begriff und Erscheinungsformen der unternehmensverbundenen Familienstiftung
- 2. Betreffend die grundsätzliche Zulässigkeit von unternehmensverbundenen Familienstiftungen
- 3. Betreffend die Bedeutung des Stifterwillens
- 4. Betreffend die Stiftungssatzung und den Stiftungszweck
- a) Stiftungssatzung
- b) Stiftungszweck
- 5. Betreffend das Stiftungsvermögen
- 6. Betreffend die Stiftungsorganisation
- 7. Betreffend die Destinatäre
- 8. Betreffend die Stiftungsaufsicht
- IV. Zu Teil 5: Gestaltungsaspekte zur Sicherung des Familieneinflusses auf Ebene der Familienstiftung und des Familienunternehmens
- 1. Betreffend die Verzahnungsmöglichkeiten von Familienstiftung, Familienunternehmen und Familie
- 2. Betreffend die Einsatz- und Einflussmöglichkeiten des Stifters und der Familienmitglieder in der unternehmensverbundenen Familienstiftung
- a) Reichweite und Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Stifters
- b) Einflussmöglichkeiten des noch lebenden Stifters
- c) Einsatz- und Einflussmöglichkeiten der Stifterfamilie im Organisationsgefüge der Familienstiftung
- d) Einsatzmöglichkeiten des Stifters und der Familienmitglieder im Unternehmen
- e) Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten auf Ebene des Familienunternehmens zur Sicherung des Einflusses der Familienstiftung
- B. Schlussbetrachtung und Ausblick
- Literaturverzeichnis.
- Back Cover
Teil 1: Einleitung
A. Kontext und Ziel der Untersuchung
Von den derzeit in Deutschland existierenden Unternehmen (ca. 3 Mio.) handelt es sich bei ca. 90 % um sog. Familienunternehmen.2 Etwa 52 % des Gesamtumsatzes deutscher Unternehmen wird von Familienunternehmen erwirtschaftet.3 Es verwundert daher nicht, dass Familienunternehmen eine herausragende volkswirtschaftliche Stellung für die Unternehmenslandschaft in Deutschland zukommt.4 Sie werden dementsprechend zu Recht als „Rückgrat“5 bzw. „Säulen“6 der deutschen Volkswirtschaft angesehen und in vielen Produktbereichen gelten sie oftmals als „Hidden Champions“7. Indes ist eine amtliche Statistik mit genauen Zahlen, u. a. vor dem Hintergrund, dass es keine einheitliche, geschweige denn gesetzliche Definition des Begriffs Familienunternehmen8 gibt, nicht vorhanden.9
Speziell für Familienunternehmen stellt sich im Laufe der Zeit die unumgängliche, folgenreiche und wohl wichtigste Frage: die Frage der Unternehmensnachfolge.10 Kein Familienunternehmen ist wie das andere, sodass für jedes Familienunternehmen die Nachfolgefrage individuell zu beantworten ist. Demgemäß wird die Kautelarpraxis11 bei der Nachfolgegestaltung von Familienunternehmen12, insbesondere im Hinblick auf die zu berücksichtigenden gesellschafts-, familien-, erb- sowie steuerrechtlichen und – bei einer Nachfolgelösung mittels einer unternehmensverbundenen Familienstiftung – auch und im Besonderen stiftungsrechtlichen Fragestellungen, stark juristisch intradisziplinär gefordert13. Dabei besteht zudem die Besonderheit, dass bei der Nachfolgegestaltung von Familienunternehmen einerseits die Belange der Unternehmerfamilie und andererseits die des Familienunternehmens zu berücksichtigen sind, sodass nicht nur juristische Aspekte, sondern auch interdisziplinäre Bezüge etwa zur Soziologie, Psychologie sowie Betriebswirtschaftslehre eine Rolle spielen.
Die vorliegende Untersuchung hat die unternehmensverbundene – nicht i. S. d. §§ 51 ff. AO gemeinnützige14 – Familienstiftung in Gestalt einer sog. Beteiligungsträgerstiftung15 zum Gegenstand. Bei dieser handelt es sich um eines von vielen möglichen, aber gegenwärtig, insbesondere zur Perpetuierung16 der Unternehmenskontinuität, immer beliebter werdendes Instrument bei der Nachfolgegestaltung von Familienunternehmen.17 So sind die meisten unternehmensverbundenen Familienstiftungen in der Praxis das Ergebnis der Unternehmensnachfolgeentscheidung von Familienunternehmern bzw. Familienunternehmerinnen.18 Die Bezugnahme speziell von Familienunternehmen samt Berücksichtigung ihrer Besonderheiten im Rahmen dieser Arbeit ist demgemäß berechtigt und erforderlich.19
Die „Sicherung des Familieneinflusses“20 und der Erhalt der „DNA“21 bzw. des „Charakters“22 des Familienunternehmens stellt bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge mittels einer unternehmensverbundenen Familienstiftung für ein Familienunternehmen im Allgemeinen23 und für den Familienunternehmer als Stifter im Besonderen neben der Unternehmensperpetuierung24 den wohl wichtigsten Aspekten dar.25 Denn die Kehrseite der Sicherung des Familienunternehmens vermittels einer unternehmensverbundenen Familienstiftung – dies sei hier bereits vorgegriffen – ist insoweit primär in dem Verlust der lebzeitigen, unmittelbaren Einflussmöglichkeiten auf das Familienunternehmen zu sehen. Die Familienstiftung wird Eigentümerin des Familienunternehmens; Stifter und Familie verlieren ihr Anteilseigentum und damit letztlich auch ihre Gesellschafterstellung. Die Verknüpfung von Familienunternehmen und Familienstiftung scheint insofern auf den ersten Blick in einem Spannungsverhältnis zu stehen26. Kann in diesem Fall noch von einem Familienunternehmen gesprochen werden? So warf namentlich auch Holger Fleischer in jüngerer Zeit die Frage auf, ob unternehmensverbundene (Familien-)Stiftungen und Familienunternehmen sich als „Kontrastmodell“ gegenüberstünden oder doch (weiterhin) jedenfalls eine „Familienähnlichkeit im Wittgensteinschen Sinne“27 bestehen könne.28
Da ein jeder und besonders ein Familienunternehmer Einfluss zu Lebzeiten ungern abgibt, wird der Familienunternehmer resp. Stifter in der Regel ein Interesse an der weiteren Ausgestaltung und Entwicklung „seiner“ Familienstiftung haben und dabei mitunter bemüht sein, sich und seiner Familie einen gewissen Einfluss in Gestalt von weitreichenden Einwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten in ebendieser und so zumindest mittelbar auch im Familienunternehmen zu erhalten.29 Vor diesem Hintergrund ist eigentlich schon zwecks Erhalts der Familienharmonie davon auszugehen, dass jedenfalls in einer unternehmensverbundenen Familienstiftung, bei der die Familienstiftung u. a. zwecks Fortführung des Familienunternehmens gegründet wurde, deren Organe mit Familienmitgliedern besetzt werden.30 Daher ist es durchaus erstaunlich, dass eine Studie aus dem Jahre 201231 bei der rund 100 „Stiftungsunternehmen“32 untersucht wurden, ergab, dass bei diesen sowohl in der Stiftung als auch im mit ihr verbundenen Familienunternehmen selbst, ein nur noch relativ geringer Einfluss des Stifters und/oder seiner Familie vorhanden war. Dies kann auf vielfältige Gründe zurückzuführen sein, etwa ein Misstrauen des Familienunternehmers gegenüber seiner Familie oder schlicht auf die Unkenntnis in Bezug auf die Möglichkeiten des Stifters bzw. der Stifterfamilie, sich über eine entsprechende Satzungsgestaltung den Familieneinfluss zu erhalten.33 Erschwerend kommt hinzu, dass selbst einige Stiftungsbehörden wohl in Bezug auf die Gestaltungsfreiheit des Stifters, insbesondere betreffend Sonderrechten, nicht immer im Klaren sind und einflussreichen Rechten des Stifters und seiner Familie deshalb generell kritisch gegenüberstehen, sodass diese teilweise im Anerkennungsverfahren nicht durchzusetzen sind34, obgleich sie stiftungsrechtlich durchaus zulässig sind.
Einer Stiftungskonstruktion wird insofern auch überwiegend attestiert, dass sie zu einer Trennung von Familie und Unternehmen führe bzw. führen solle, indem der Familieneinfluss gerade durch die Stiftung verhindert oder beschränkt werden solle.35 Dies mag zwar in der Praxis oftmals das Motiv eines Familienunternehmers zur Wahl einer unternehmensverbundenen Familienstiftung als Nachfolgeinstrument36 sein, da er ggf. keinen, einen unpassenden oder – gerade bei großen Familien – zu viele potentielle Nachfolger hat. Gleichwohl muss er sich vor Augen führen, dass dies prima vista zur Folge hätte, dass mangels bestimmenden Familieneinflusses nicht mehr von einem Familienunternehmen, sondern nur noch von einem von der Familie losgelösten Stiftungsunternehmen gesprochen werden könnte.37 Denn sämtliche oder jedenfalls die Mehrheit der Geschäftsanteile am Familienunternehmen werden ab da an von der unternehmensverbundenen Familienstiftung gehalten und nicht mehr vom Stifter bzw. der Stifterfamilie selbst.38 Dass dann eigentlich nicht mehr von einem „Familienunternehmen“ die Rede sein kann, ist zum einen dem Stifter resp. Familienunternehmer wohl selten bewusst. Dasselbe gilt im Besonderen, wenn die Familienstiftung als Nachfolgeinstrument gerade für Familienunternehmen in der Literatur und Praxis angepriesen wird. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer differenzierteren Betrachtung hinsichtlich der konkreten Ziele des Familienunternehmers, aber auch der Risiken, die mit einer Familienstiftungskonstruktion einhergehen können. Will er nicht nur das Familienunternehmen als Unternehmen erhalten, sondern gerade mit seinem familiären Charakter, so bedarf es einer diesbezüglichen Gestaltung der unternehmensverbundenen Familienstiftungskonstruktion, die die Interessen der Familie, der Familienstiftung und des Familienunternehmens schützt.
Die Arbeit untersucht – besonders im Hinblick auf das zum 1.7.2023 reformierten Stiftungsrecht –, ob und wie Familienunternehmen und unternehmensverbundene Familienstiftungen zueinanderstehen bzw. miteinander derart verbunden werden können, dass bei der Wahl einer unternehmensverbundenen Familienstiftung als Nachfolgeinstrument, das Familienunternehmen weiterhin als solches fortgeführt werden kann. Dabei sollen die Möglichkeiten, aber auch Grenzen des Stifters bzw. der Stifterfamilie bei der Gestaltung der Familienstiftungskonstruktion aufgezeigt werden. Die Untersuchung betrifft daher auch die stiftungsrechtlichen Thematik betreffend die Gestaltungsfreiheit und Rechtsstellung des Stifters und der ihm zustehenden Rechte im Rahmen der Stiftungsgestaltung, die bereits „als das vielleicht zentralste und zugleich intrikateste Thema des modernen Stiftungsrechts“39 angesehen wurde – zumal der Reformgesetzgeber 2021 sich diesbezüglich positioniert hat, worauf noch einzugehen sein wird.40
Eben die bei Familienunternehmern verständliche und durchaus verbreitete Intention der Einflusserhaltung mag Friktionen mit dem vorherrschenden Bild der rechtsfähigen (Familien-)Stiftung als „eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristische Person“41 und der grundsätzlichen Emanzipation der Stiftung vom Stifter nach ihrer Anerkennung42 hervorrufen.43 Die Implementierung einer Familienstiftung muss aber nicht zwingend mit dem Entzug des Familieneinflusses und der Bindung der Familie zum Familienunternehmen einhergehen. Dies ist jedenfalls für denjenigen Familienunternehmer resp. Stifter von besonderem Interesse, der die beiden „Erfolgsmodelle“44 – Familienunternehmen und unternehmensverbundene Familienstiftung – langfristig verbinden möchte.45
Insofern wird nicht verkannt, dass es durchaus – je nach Familiensituation – seitens des Familienunternehmers beabsichtigt oder jedenfalls ratsam sein kann, die Familie von bzw. den Familieneinfluss auf die Unternehmensführung gänzlich zu verhindern und diesen höchstens eine sog. Destinatärstellung46 zuzuweisen, um so etwa wenigstens das Unternehmen (insbesondere aufgrund der Arbeitsplätze) zu erhalten, aber zugleich die Familienmitglieder versorgt zu wissen. Eine entsprechende Situation kann vor allem dann vorliegen, wenn aus Sicht des Familienunternehmers resp. Stifters keiner seiner Angehörigen zur Unternehmensfortführung geeignet ist oder auch in dem Fall, dass keiner der potentiellen Nachfolger willens ist, die Unternehmensfortführung oder andere Leitungsaufgaben im Unternehmen zu übernehmen.47 In dieser Arbeit geht es indes nicht um derlei Konstellationen. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die beiden „Erfolgsmodelle“ Familienunternehmen und unternehmensverbundene Familienstiftung seitens des Familienunternehmers verbunden werden sollen, um einen generationenüberdauernden Erhalt des Familienunternehmens als ebensolches und die Versorgung der Unternehmerfamilie zu gewährleisten.
Einen Automatismus zur Wahrung des Familienunternehmenscharakters bedeutet die Übertragung der Unternehmensanteile auf eine Familienstiftung freilich nicht.48 Dreh- und Angelpunkt für die Gestaltung der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahmemöglichkeit der Familie auf das Familienunternehmen ist neben dem Gesellschaftsvertrag des Familienunternehmens im Falle einer Familienstiftungskonstruktion vornehmlich die Stiftungssatzung und der in ihr verkörperte Stifterwille.49 Insofern kann man auch nicht „pauschal“ davon ausgehen, dass der Familieneinfluss durch Involvierung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung stark gemindert oder gar unterbrochen wird.50 Eine allgemeingültige Lösung gibt es dabei eingedenk der Heterogenität von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien sowie der Vielgestaltigkeit einer Stiftungskonstruktion freilich nicht.
Zwischen den beiden bei der Nachfolgeplanung zu berücksichtigenden Komplexen – Familienunternehmen und Unternehmerfamilie – tritt der Komplex (unternehmensverbundene) Familienstiftung freilich hinzu. Es gilt dann, diese drei Komplexe (bzw. Interessenlagen) bei der Planung und Gestaltung der Unternehmensnachfolge in Einklang zu bringen.
Im Fokus der Arbeit stehen die durch das Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes (StiftVereinhG) vom 16.7.202151 überwiegend seit dem 1.7.2023 in Kraft getretenen Neuregelungen.52 Damit sind bedeutende Änderungen und Neuerungen der stiftungsrechtlichen Normen (§§ 80 ff. BGB), insbesondere auch im Hinblick auf die rechtliche Verfassung der (unternehmensverbundenen) Familienstiftung53 verbunden. Mit der Stiftungsrechtsreform 2021 geht auch die erstmalige Einführung eines bundeseinheitlichen Stiftungsregisters, das allerdings erst zum 1.1.2026 in Betrieb genommen wird54, einher.
In dieser Arbeit wird insgesamt untersucht, welche Auswirkungen die Stiftungsrechtsreform 2021 auf (unternehmensverbundene) Stiftungen im Allgemeinen und auf die Wahl und Gestaltung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung als Instrument zur Fortführung eines Familienunternehmens im Speziellen hat und ob es mit Blick auf das reformierte Stiftungsrecht zu Einschränkungen oder Erweiterungen der Stifterfreiheit bei der Wahl und Gestaltung der Familienstiftung gekommen ist. Die Arbeit soll damit zugleich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem reformierten Stiftungsrecht bieten und Familienunternehmern und ihren Beratern bei der Wahl, der rechtssicheren Gestaltung sowie der (rechtlichen) Handhabung ihrer Familienstiftungskonstruktion hilfreich sein, indem auch auf – gerade für Familienunternehmen und Familienstiftungen – relevante Aspekte eingegangen wird.
B. Gang der Untersuchung
Da in dieser Arbeit die unternehmensverbundene Familienstiftung speziell im Zusammenhang mit einem Familienunternehmen errichtet wird und dabei untersucht werden soll, ob das Familienunternehmen auch nach der Verbindung von Familienstiftung und Familienunternehmen weiterhin seinen Familienunternehmenscharakter behalten kann, werden im zweiten Teil der Arbeit zunächst der Typus und die Charakteristika, die ein Familienunternehmen auszeichnen, erörtert.55 Dabei wird auch auf die mögliche Rolle und Auswirkungen der Implementierung der Familienstiftung als Nachfolgeinstrument in die Familienunternehmensstruktur eingegangen.56 Am Ende von Teil 2 wird dargelegt, weshalb die Sicherung des Familieneinflusses im Rahmen einer unternehmensverbundenen Familienstiftungskonstruktion von besonderer Relevanz ist.57
Der dritte Teil widmet sich sodann den Motiven für die Errichtung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung im Zusammenhang mit Familienunternehmen, welche vielfältig sein können, aber mit den allgemeinen Zielen der Unternehmensnachfolgegestaltung bei Familienunternehmen im Einklang stehen.58 Ferner werden die rechtsformspezifischen Risiken und Herausforderungen, die mit einer Familienstiftungskonstruktion als Unternehmensnachfolgemodell im Allgemeinen und bei Familienunternehmen im Speziellen einhergehen, erörtert und untersucht, wie diesen begegnet werden kann.59 Hierbei wird im Besonderen auch auf die Auswirkungen der Verschärfung des Transparenzregisters und vor allem des künftigen Stiftungsregisters auf die Anonymitätsinteressen von Familienstiftungen und Familienunternehmen eingegangen, wobei diesbezüglich ein beachtlicher Paradigmenwechsel zu konstatieren ist.60 Darüber hinaus wird sodann erörtert, ob im Falle einer unternehmensverbundenen Familienstiftung eine Stiftungserrichtung von Todes wegen oder unter Lebenden erfolgen sollte und wie die Stiftungserrichtung im Lichte des reformierten Stiftungsrechts und besonders mit Blick auf die Übertragung von Unternehmensanteilen oder Grundstücken auf die Familienstiftung abläuft. Denn gerade bei Familienunternehmen stellt die Frage des Zeitpunktes der Stiftungserrichtung die erste Weichenstellung dar.61 Im Rahmen der im unternehmerischen Kontext favorisierten Stiftungserrichtung unter Lebenden wird ferner herausgearbeitet, dass Formvorschriften betreffend eine notarielle Beurkundung (insb. § 311b BGB und § 15 Abs. 4 GmbHG), die nicht speziell auch auf das für die Errichtung einer Stiftung erforderliche Stiftungsgeschäft adressiert sind, nicht – auch nicht analog – auf das Stiftungsgeschäft anwendbar sind, was auch im reformierten Stiftungsrecht, trotz einer nunmehr aus Sicht des Reformgesetzgebers klarstellenden Regelung, weiterhin diskutiert wird.62 Zum Schluss des dritten Teils werden noch gesellschaftsrechtlich zu beachtende Aspekte vor Übertragung der Gesellschaftsanteile auf die Familienstiftung aufgezeigt.63
Der vierte Teil der Arbeit hat anschließend die rechtliche Verfassung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung im Hinblick auf die Änderungen und Neuerungen im Zuge der Stiftungsrechtsreform 2021 zum Untersuchungsgegenstand. Im Rahmen der einzelnen Teilaspekte wird ein besonderes Augenmerk auf die Tatsache geworfen, dass es sich bei einer unternehmensverbundenen Familienstiftung um eine besondere Art der Stiftung bürgerlichen Rechts handelt. Daher werden zunächst die Begriffe Stiftung, unternehmensverbundene Stiftung und Familienstiftung ausführlich erläutert sowie besondere Erscheinungsformen unternehmensverbundener Familienstiftungen (Familienstiftung & Co. KG, Doppelfamilienstiftung, gemischte Familienstiftung und Stammesfamilienstiftung) aufgezeigt.64 Vertieft und kritisch erörtert, wird in Teil 4 auch die Zulässigkeit unternehmensverbundener (Familien-)Stiftungen vor dem Hintergrund des auch heute noch hochgehaltenen, aber vermehrt in Zweifel gezogenen, Verbots der Unternehmensselbstzweckstiftung.65 In Bezug auf die Gestaltungsvariante der sog. (Familien-)Stiftung & Co. KG werden zudem Bedenken hinsichtlich ihrer Zulässigkeit im reformierten Stiftungsrecht, die aus einer „[sibyllinischen] Formulierung“66 in der Begründung zum Regierungsentwurf des StiftVereinhG 2021 entsprungen sind, ausgeräumt und erörtert, weshalb diese Gestaltungsvariante mit Blick auf die geplante Verschärfung des Mitbestimmungsrechts künftig vermehrt in den Fokus von Familienunternehmen rücken könnte.67 Nach Klärung der Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und der Zulässigkeitsfrage wird sich ausführlich den Auswirkungen der Stiftungsrechtsreform 2021 auf die Bedeutung des Stifterwillens, auf die Stiftungssatzung und den Stiftungszweck samt den Neuregelungen zu den Satzungsänderungsmöglichkeiten, dem Stiftungsvermögen samt der diesbezüglichen Neuregelungen sowie der Stiftungsorganisation und der Neuregelungen betreffend die Stiftungsorgane, insbesondere ihrer Haftung, gewidmet. Sodann wird auf die Rechtsstellung der Destinatäre einer Familienstiftung, die gerade bei dieser eine besondere Bedeutung haben, eingegangen. Gegenstand des Schlusses des vierten Teils ist die Stiftungsaufsicht, wobei im Rahmen dessen die Rolle und Reichweite der Stiftungsaufsicht im reformierten Stiftungsrecht und ihr Verhältnis in Bezug auf unternehmensverbundene Familienstiftungen beleuchtet wird.
Nach Erörterung der stiftungsrechtlichen Verfassung einer unternehmensverbundenen Familienstiftung werden in Teil 5 der Arbeit die verschiedenen Verzahnungsmöglichkeiten von Familienstiftung, Familienunternehmen und Familie, speziell hinsichtlich der Wahrung des Familienunternehmenscharakters, aufgezeigt. Im Anschluss daran stehen die Möglichkeiten in Bezug auf den Einsatz des Stifters und seiner Familie auf Stiftung- und Unternehmensebene im Fokus der Untersuchung. Es werden ferner die diesbezüglichen Möglichkeiten, aber auch – mit Blick auf die sog. Stiftungsautonomie – Grenzen der Einflusssicherung in der Familienstiftung zum Zwecke der Wahrung des Familienunternehmenscharakters untersucht. Teil 5 widmet sich abschließend in gebotener Kürze den gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten auf Ebene des Familienunternehmens zur Sicherung des Gesellschaftereinflusses der Familienstiftung.
Die Arbeit schließt im sechsten und letzten Teil mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse sowie einer Schlussbetrachtung samt Ausblick.
2 Vgl. Stiftung Familienunternehmen, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, S. 2, wobei dort ein eigenständiger Familienunternehmensbegriff und Gruppen von Familienunternehmen (vgl. dazu a. a. O., S. 3 f., 51 ff.) zugrunde gelegt worden sind; vgl. auch Sanders, in: Schmidt-Kessel, German National Reports, S. 461 („roughly 90 % of German businesses could be qualified as family businesses“); v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 („die meisten deutschen Unternehmen sind Familienunternehmen“); europaweit sollen ca. 70 %–80 % aller Unternehmen im Familienbesitz sein, so Kalss, in: Vogt/Fleischer/Kalss, Recht der Familiengesellschaften, S. 1 (3); auch weltweit betrachtet sind Familienunternehmen „die vorherrschende Organisationsform“, so Fleischer, GmbHR 2021, 113 m. N.; ebenso Ramadani et al., Entrepreneurial Family Businesses, S. 4 („approximately 90 % of all businesses worldwide are family businesses“). Alle nachfolgenden Internetquellen wurden letztmalig am 15.11.2024 abgerufen.
3 Vgl. Stiftung Familienunternehmen, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, S. 6.
4 Vgl. Hennerkes/Kirchdörfer, Die Familie und ihr Unternehmen, S. 43 f.; vgl. auch BVerfGE 138, 136 Rn. 138, 161 ff.; D. Reuter, in: Bumke/Röthel, Autonomie im Recht, S. 118 (139), nach dem „die Unternehmenslandschaft in keinem der betroffenen [EU-] Länder auch nur annähernd so sehr durch Familienunternehmen geprägt ist wie in Deutschland“; allg. dazu Stiftung Familienunternehmen, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, passim.
5 v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118; v. Rechenberg/Thies/Wiechers, HdB Familienunternehmen, S. 5; 82 % der deutschen Gesamtbevölkerung sehen dies auch so, PwC, PM v. 16.8.2019, BB 2019, 2026.
6 Schiffer/Schiffer/Pruns, Die Stiftung in der Beraterpraxis, § 11 Rn. 1.
7 Kühne/Rehm, NZG 2013, 561; MHdB GesR 9/Hippeli, § 13 Rn. 10; Wiese/Wiese, Unternehmensnachfolge, Rn. 1.3.
8 Dazu → Teil 2 B.
9 Vgl. schon Lehleiter, Die Familienstiftung, S. 17.
10 Zur Nachfolgeproblematik → Teil 2 B II 3.
11 Zur hohen Bedeutung der Kautelarpraxis besonders für das Gesellschaftsrecht s. Fleischer, RabelsZ 82 (2018), 239 (253 ff.); speziell bzgl. Familienunternehmen vgl. auch Bong, Gesellschaftsrechtliche Wirkungen einer Familienverfassung, S. 30 ff. („typusprägende Kautelarpraxis“).
12 Allg. sind Familienunternehmen, insbesondere aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit und Heterogenität, „eine Herausforderung an die Gestaltungspraxis“, so konstatierend K. Schmidt, in: Tröger/Wilhelmi, Rechtsfragen der Familiengesellschaften, S. 37 (51); ihm zustimmend MHdB GesR 7/Holler, § 75 Rn. 5; zugleich gelten Familienunternehmen aber „als solche (unabhängig von deren Größe) und die damit verbundenen Probleme als beliebtes Thema der Kautelarjurisprudenz“, so Ulmer, ZIP 2010, 549 (550 dortige Fn. 10); vgl. auch Wälzholz, in: Röthel/K. Schmidt, Strategie und Führung in Familienunternehmen, S. 34.
13 Näher zur Rechtsberatung in Familienunternehmen, insb. zu diesbezüglichen Interessenkonflikten etwa H. P. Westermann, FS Krieger, S. 1087 ff.; H. P. Westermann, FS Hennerkes, S. 21 ff.; Hartz, FamU 1971/72, S. 13 (26 ff.); s. a. Staake, RFamU 2022, 193 (194), der auf die notwendige Bezugnahme inter- und auch intradisziplinärer Aspekte hinweist.
14 Diese ist im hiesigen Kontext als Vehikel der Unternehmensnachfolge bei Familienunternehmen weniger geeignet, s. zu den Gründen näher → Teil 4 A III 2.
15 Zum Begriff → Teil 4 A II 2.
16 Dies meint „das Bestreben der Kautelarpraxis bzw. der Unternehmensinhaber, durch die Wahl der Unternehmensform und die Ausgestaltung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen bestandsgefährdende Einflüsse möglichst dauerhaft auszuschalten und in ihrem Sinne langfristig auf eine Unternehmenspolitik hinzuwirken“, so K. Schmidt, Kolloquium für Dieter Reuter, S. 9 (10) im Anschluss an D. Reuter, Perpetuierung von Unternehmen, S. 15; D. Reuter folgend auch Michalski, Perpetuierung von Unternehmen, S. 3 f.
17 Vgl. etwa Theuffel-Werhahn, RFamU 2022, 67; Schewe/Hermes, RFamU 2022, 158; Oppel, FS 75 Jahre StB-Verband, S. 537 (538); Rawert, ZGR 2018, 835 (837); Fleisch, S&S RS 04/2018, 1 (2); Spiegelberger, ErbStB 2005, 43 (44); Binz, Handelsblatt v. 27.09.2021, Nr. 186, S. 26 („Geheimwaffe“).
18 Franke/Draheim, VfS 2015, 1 (3, 6); Block et al., Journal of Family Business Strategy 2020, S. 1 (8); Hosseini-Görge, Foundation owned firms, S. 59; Mühlbauer, Stiftungsverbundene Unternehmen und Agency-Theorie, S. 46; Neumann, Die reine Unterhaltstiftung, S. 200; vgl. MHdB GesR 5/Gummert, § 81 Rn. 39; Hippeli, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 121 (129); Fleischer, ZIP 2022, 2045. – Allein zugunsten des Leseflusses wird nachfolgend das generische Maskulinum verwendet.
19 Zur Kontextualisierung als Aufgabe der Rechtswissenschaft grdl. Lepsius, JZ 2019, 793; dies bezogen auf die rechtswissenschaftliche Familienunternehmensforschung betonend Fleischer, NZG 2022, 1371 („Die vordringliche rechtswissenschaftliche Aufgabe besteht also weniger in einer dogmatischen Abstraktionsleistung, sondern vielmehr in einer sachverhaltssensiblen Kontextualisierung“).
20 Diesen Aspekt speziell im Rahmen einer Stiftungsgestaltung – soweit ersichtlich – anreißend: aus juristischer Sicht Lange, in: Lange/Windthorst, Sicherung des Familieneinflusses, S. 95; Block et al./Jeschke, Die Familienstiftung, S. 25; Klinkner/Buß/Ens, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 141 (147); (mit Fokus auf die Rolle eines Stiftungsbeirats) v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118; s. a. knapp König, Nachlassplanung, S. 95 f.; Hippeli, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 121 (130 f.); Fleisch, S&S RS 04/2018, 1 (7); Fleischer, ZIP 2022, 2045 (2054); eingehender jedoch aus betriebswirtschaftlicher Sicht Fleschutz, Die Stiftung als Nachfolgeinstrument, S. 331 ff.
21 Z. B. v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 (1119); MHdB GesR 7/Holler, § 75 Rn. 15.
22 Z. B. Hennerkes/May, NJW 1988, 2761; Sanders, NZG 2017, 961 (968).
23 Vgl. Sudhoff/Wälzholz, Familienunternehmen, § 2 Rn. 7; Hennerkes/Kirchdörfer, Die Familie und ihr Unternehmen, S. 140; Jendritzky, Die korporative Gruppenbildung, S. 62; Michalski, Perpetuierung von Unternehmen, S. 4; Zellweger, Managing the Family Business, S. 22; Koropp/Grichnik, WiSt 2007, 295 (300); May, ZfB-Special Issue 2/2009, 113 (118); Weninger, ZUS 2012, 40; Fleischer, ZIP 2023, 2385 (2393); treffend Baus, FS Hennerkes, S. 3 (11) („Ganz oben steht fast immer der Erhalt des Familienunternehmens“); Jakob/Richter, Stiftung und Familie, S. 101 (103) („Perpetuierung als Ziel“); D. Reuter, Perpetuierung von Unternehmen, S. 76 („tragendes Handlungsmotiv“); auch der Governance-Kodex für Familienunternehmen 2004 zielte primär noch auf die Sicherung des Familieneinflusses auf die Unternehmensführung ab, s. Weller, ZGR 2012, 386 (396 f., dortige Fn. 79).
24 Grdl. zur Perpetuierung von Unternehmen, insb. Familienunternehmen, einerseits (kritisch) D. Reuter, Perpetuierung von Unternehmen; D. Reuter, in: Bumke/Röthel, Autonomie im Recht, S. 118 (135 ff.); Dutta, in: Bochmann et al., Werte in Familienunternehmen, S. 9 (11 f.) spricht sich freilich „gegen eine Vermögensperpetuierung […] allgemein und in Familienunternehmen […]“ aus; kritisch wohl auch Bochmann/Weig, RFamU 2022, 539 (548); andererseits (offener) Michalski, Perpetuierung von Unternehmen; H. Westermann, FS Bartholomeyczik, S. 395 (403 ff.); Kalss/Dauner-Lieb, GesRZ 2018, 261 (277 und passim).
25 Vgl. etwa v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 (1119); Pauli, ZEV 2012, 461 (462); Fleschutz, Die Stiftung als Nachfolgeinstrument, S. 331; Hippeli, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 121 (130 f.); Klinkner/Buß/Ens, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 141 (149); Höfner-Byok, Die Stiftung & Co. KG, S. 137; Kronke, Stiftungstypus, S. 226; Reimann, FS Otte, S. 285 (288); Schwarz, ZSt 2004, 101 (102); Schnitger, ZEV 2001, 104 (105); zur Relevanz der Sicherung des Familieneinflusses im Rahmen einer Stiftungskonstruktion → Teil 2 B.
26 Vgl. Köhler, FS D. Ziegler, S. 357.
27 Dazu Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1953, §§ 66 f. am Beispiel von Brett-, Karten-, Ball- und Kampfspielen: „Wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen. Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort ‚Familienähnlichkeit‘; denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen [...]“, zitiert nach Fleischer, ZIP 2022, 2045 (2054) (dortige Fn. 158).
28 Fleischer, ZIP 2022, 2045. Aus betriebswissenschaftlicher Sicht auch Hosseini/Jarchow, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 37 mit dem Titel „Familien- und Stiftungsunternehmen – same, same but different“.
29 Dutta, in: Grziwotz, Erbrecht und Vermögenssicherung, S. 71 (77); R. Werner, NWB-EV 2019, 271 (273); vgl. auch Lange, in: Lange/Windthorst, Sicherung des Familieneinflusses, S. 95 (112); Felden/Hack/Hoon, Management von Familienunternehmen, S. 178; Hippeli, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 121 (129); MHdB GesR 5/Jakob, § 119 Rn. 86; A. Schulte, Stifter und Stiftung, S. 18; Schütte, Transparente und intransparente Stiftungen, S. 32, 187; Block et al./Jeschke, Die Familienstiftung, S. 25 (31); Gierhake, Vermögensnachfolge und Vermögensschutz, S. 70; v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 (1124).
30 Vgl. B. Müller, Die privatnützige Stiftung zwischen Staatsaufsicht und Deregulierung, S. 30; Hosseini-Görge, Foundation owned firms, S. 40; Bergschneider/Theuffel-Werhahn, FamVermR, Rn. 11.8; Sorg, Die Familienstiftung, S. 175; Berndt/Götz/Berndt, Stiftung und Unternehmen, Rn. 1721 a. E.
31 IfD Allensbach, Stiftungsunternehmen in Deutschland, 2012, S. 19 f.; vgl. dazu auch Bruttel/Probst/Schweinsberg, FuS 2012, 226 (228).
32 Damit sind Unternehmen gemeint, bei denen die Stiftung eine Kapitalbeteiligung von mindestens 25 % am Unternehmen hält. Somit sind allein sog. Beteiligungsträgerstiftungen erfasst, vgl. IfD Allensbach, Stiftungsunternehmen in Deutschland, 2012, S. 9.
33 So Block et al./Jeschke, Die Familienstiftung, S. 25; vgl. auch Schütte, Transparente und intransparente Stiftungen, S. 443 mit Hinweis auf die „fehlende Aufklärung über die Ausgestaltungsmöglichkeiten der deutschen Privatstiftung“ betreffend die Einflussmöglichkeiten des Stifters und auch der Destinatäre. Hierzu → Teil 5.
34 Vgl. Gollan, ErbR 2018, 305 (306); vgl. auch Burgard, npoR 2024, 181 (182), nach dem die Stiftungsbehörden „den Stifter mit mehr oder weniger sanftem Druck ungewöhnliche, d. h. vom Standard abweichende, Gestaltungen“ nicht selten ausreden würden.
35 Vgl. etwa Richter/Richter, Stiftungsrecht, § 10 Rn. 183; Wiese/Meyer-Sandberg, Unternehmensnachfolge, Rn. 13.29; Scherer/R.-M. Hübner, Unternehmensnachfolge, § 6 Rn. 94; May/Bartels/Bartels, Nachfolge in Familienunternehmen, S. 92; Sudhoff/Wälzholz, Familienunternehmen, § 3 Rn. 69; Schauhoff, FS Spiegelberger, S. 1341 (1343 f.); Schlecht & Partner/Taylor Wessing/Wigand, Unternehmensnachfolge, S. 443 (444 f.); Schulte/Schulte, ErbR 2018, 422 (430); Kraus/Mehren, Ubg 2017, 665 (668); Kracht, GStB 2007, 296; R. Werner, ZEV 2006, 539 (541); weitergehender Meinecke, Stiftungen, S. 174, nach dem für eine dauerhafte Institutionalisierung der Familieneinfluss gänzlich begrenzt werden müsse (!); s. a. May/Bartels/Strick/Wrede, Nachfolge in Familienunternehmen, S. 185 (188) („[nach] der vielfach vorherrschenden Meinung, primäres Ziel von Stiftungen sei es, die Familie vom Unternehmen fernzuhalten“).
36 Zu den Motiven näher → Teil 3 A.
37 Wie hier etwa Brösztl, FS W. Sigle, S. 3 (15), wonach in diesen Fällen „der Charakter als Familienunternehmen meistens verloren“ ginge; ebenso v. Rechenberg/Thies/Wiechers/v. Rechenberg, HdB Familienunternehmen, S. 34, sofern sich der „Wille der Familie“ nicht wenigstens mittelbar über die Familienstiftung im Familienunternehmen perpetuiere; ähnlich v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 (1120); Block et al./Jeschke, Die Familienstiftung, S. 25 (31); Hosseini/Jarchow, in: Achleitner et al., Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis, S. 37 (47); wohl auch MHdB GesR 9/Hippeli, § 13 Rn. 2.
38 S/B/K/G/W/Kormann, Familienunternehmen, Kap. 1 Rn. 105; dies sei vielen Familienunternehmern resp. Stiftern vorher nicht in Gänze bewusst, vgl. Lange, in: Lange/Windthorst, Sicherung des Familieneinflusses, S. 95 (100); Schiffer, NJW 2006, 2528; in Anlehnung an die sog. Börsenreife bei der AG (dazu Selent, Unternehmensführung, S. 53 ff.) wird daher auch bei Errichtung einer Stiftung eine sog. „Stiftungsreife“ seitens des Stifters gefordert, grdl. dazu Schiffer/Schiffer, Die Stiftung in der Beraterpraxis, § 14 Rn. 31 ff., 50 ff.
39 BeckOGK/Jakob/Picht/Kopp, 1.9.2024, BGB § 83 Rn. 10.
40 Näher besonders → Teil 4 D I 2 c. und → Teil 5 B I.
41 § 80 Abs. 1 S. 1 BGB; zum Stiftungsbegriff näher → Teil 4 A I.
42 Eing. zur Emanzipation → Teil 5 B I; zur Anerkennung → Teil 3 C I 2.
43 Vgl. Gierhake, Vermögensnachfolge und Vermögensschutz, S. 70.
44 Vgl. May, Erfolgsmodell Familienunternehmen, passim; v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 („Erfolgsmodell Familienunternehmen“); Markworth, NZG 2021, 100 (110) („Erfolgsmodell der unternehmenstragenden Stiftung“).
45 Explizit v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 (1120); Habersack/P. Horváth/Kirchdörfer, „Stiftungsunternehmen bringen Eigentum und Verantwortung zusammen“, F.A.Z. v. 19.03.2021, Nr. 66, S. 16.
46 Als Destinatäre werden die Begünstigten einer Stiftung bezeichnet, näher zu diesen → Teil 4 G.
47 König, Nachlassplanung, S. 96 m. w. N.
48 Dazu → Teil 2 B 3 und Teil 4 A.
49 Vgl. Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, Kap. 1 Rn. 62; v. Oertzen, BB 2019, 2647 (2654); v. Oertzen/Reich, DStR 2017, 1118 (1124); Koropp/Grichnik, WiSt 2007, 295 (301); zur Stiftungssatzung → Teil 4 D.
50 Ebenso Ihle, RNotZ 2009, 557 (571); Schwarz, BB 2001, 2381 (2385); Block et al./Jeschke, Die Familienstiftung, S. 25 (29); vgl. auch Burgard, in: Die Stiftung – Jahreshefte zum Stiftungswesen, 3. Jahrgang, S. 31 (33); Pauli, in: Die Stiftung – Jahreshefte zum Stiftungswesen, 3. Jahrgang, S. 159 (173).
51 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes v. 16.7.2021, BGBl. I 2021, S. 2947, in Kraft m. W. v. 1.7.2023. Das Gesetz baut auf den Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts, BT-Drs. 19/28173 v. 31.3.2021 und BR-Drs. 143/21 v. 12.2.2021, der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, BT-Drs 19/30938 v. 22.6.2021 sowie abschließend auf den Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, BT-Drucks 19/31118 v. 23.6.2021 auf. Zum im Jahr 2013 begonnenen Reformüberlegungen und dem anschließenden Gesetzgebungsprozess statt anderer nur Hüttemann/Rawert, ZIP 2021, Beilage zu Heft 33, S3 ff.; BoKoStiftR/Bartodziej, Teil 1.1 Rn. 31 ff.
52 Hierzu etwa Hüttemann/Rawert, ZIP 2021, Beilage zu Heft 33, S3; Bisle, NWB 2021, 2285; Oppel, NWB-EV 2021, 122; Schauer/Stallmann, NWB-EV 2021, 290; Burgard, GmbHR 2021, R244; Gollan, npoR 2021, 277; Ponath/Tolksdorf, ZEV 2021, 605; Pruns, ZErb 2021, 301; R. Werner, ErbR 2021, 482; Lorenz/Mehren, DStR 2021, 1774; Orth, MDR 2021, 1225 (Teil 1) und 1304 (Teil 2); Schauhoff/Mehren, NJW 2021, 2993; Breyer, FuS 2022, 18; Klein-Wiele/Wurmthaler, FuS-Sonderausgabe 2023, 48; Demuth, NWB-EV 2022, 259; Lange, ZStV 2022, 167; Schwalm, NotBZ 2022, 81 (Teil 1) und 121 (Teil 2); Aumann, DNotZ 2022, 894; Pawlytta/Pfeiffer, ZErb 2022, 255; F. Schmitt, notar 2023, 31; Weitemeyer, JEV 2021, 54; Weitemeyer, GesRZ 2023, 237; Winkler, ZStV 2021, 121; Kalss/Kubasta, GesRZ 2021, 69 (aus österreichischer Sicht); Alvermann/Cremers, DStR 2023, 1667; Zimmermann/Raddatz, NJW 2024, 2085 Rn. 2 ff.; speziell im Kontext von uv. Stiftungen Baßler/Stöffler/Blecher, GmbHR 2021, 1125; Mehren, Ubg 2021, 541; Uhl, Ubg 2022, 551; im Kontext des Stiftungssteuerrechts analysierend und diesbezüglich eine (weitere) Reform vorschlagend Schneider/Droll, UVR 2023, 364; zu den reformierten Landesstiftungsgesetzen hier nur Orth, ZStV 2024, 3 m. w. N. in dortiger Fn. 3. Erste Kommentierungen bzw. Erläuterungen etwa bei: Burgard (Hrsg.), Stiftungsrecht; Andrick/Muscheler/Uffmann (Hrsg.), Bochumer Kommentar zum Stiftungsrecht; Henssler/Strohn/Heuel, GesR, BGB §§ 80–89; jurisPK-BGB/Otto, §§ 80–89; BeckOK BGB/Backert/J. Stürner, §§ 80–89; BeckOGK/Jakob/Uhl/Lange/G. Roth u.a., BGB §§ 80–89; Orth/Uhl, Stiftungsrechtsreform 2021; Schiffer/Pruns/Schürmann, Die Reform des Stiftungsrechts; Schauhoff/Mehren (Hrsg.), Stiftungsrecht nach der Reform; eine ausf. und strukturierte Dokumentation der Gesetzesänderungen in synoptischer Form findet sich bei Barzen, Das neue Stiftungsrecht.
53 Zu deren rechtlichen Verfassung im reformierten Stiftungsrecht eing. → Teil 4.
54 Zu den Regelungen des Stiftungsregisters → Teil 3 B I 5 b.
55 Hierzu ausf. → Teil 2 A I und II.
56 Speziell zur uv. Familienstiftung als Nachfolgeinstrument → Teil 2 A II 3 c.
57 Hierzu ausf. → Teil 2 B.
58 Hierzu samt Motivübersicht ausf. → Teil 3 A.
59 Hierzu ausf. → Teil 3 B.
60 Zu diesem Publizitätsrisiko ausf. → Teil 3 B I 5.
61 Hierzu ausf. → Teil 3 C II.
62 Hierzu ausf. → Teil 3 C I 1 c.
63 Hierzu ausf. → Teil 3 C III.
64 Hierzu ausf. → Teil 4 A I–IV.
65 Hierzu ausf. → Teil 4 B.
66 Theuffel-Werhahn, ZStV 2022, 43 (50).
67 Hierzu näher → Teil 4 IV 1 a–c.
Teil 2: Familienunternehmen und die Relevanz des Familieneinflusses
A. Typus und Charakteristika eines Familienunternehmens
Wie eingangs erwähnt, gehen die meisten unternehmensverbundenen Familienstiftungen aus Familienunternehmen resp. der Entscheidung eines Familienunternehmers hervor. Aufgrund dieser Tatsache ist deren praktische Bedeutung gerade bei Familienunternehmen enorm68 und die hier vorgenommene Kontextualisierung geboten. Um zu untersuchen, ob vermittels einer unternehmensverbundenen Familienstiftung ein Familienunternehmen als ebensolches fortgeführt werden kann, bedarf es zunächst der Erörterung, was ein Familienunternehmen ist bzw. was es auszeichnet.69 Im Folgenden wird daher auf den Typus des Familienunternehmens näher eingegangen, um zum einen später die mit einer unternehmensverbundenen Familienstiftung verfolgten Motive sowie etwaige damit einhergehende Risiken70 angemessen einordnen zu können. Zum anderen ist dies von Bedeutung, um im Rahmen der Gestaltungsaspekte betreffend die unternehmensverbundene Familienstiftung auf die Relevanz des Familienunternehmenscharakters hinreichend rekurrieren zu können.
Es werden dabei die Besonderheiten eines Familienunternehmens aufgezeigt, die einem Unternehmen den Charakter eines Familienunternehmens erst verleihen.71 Gewisse Merkmale werden nämlich bei Familienunternehmen in praxi eher virulent als bei Nicht-Familienunternehmen. An geeigneter Stelle wird dabei bereits auch auf die Rolle einer unternehmensverbundenen Familienstiftung im Familienunternehmen eingegangen. Denn: Im hiesigen Kontext gilt es, die Besonderheiten und damit den Charakter des Familienunternehmens auch bei Integration einer unternehmensverbundenen Familienstiftung zu wahren.
I. Der Typus „Familienunternehmen“
Das Interesse an Familienunternehmen ist sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft steigend, insbesondere deren Behandlung im rechtlichen Kontext nimmt stetig zu.72 Ein kodifiziertes Recht für bzw. der Familienunternehmen73, das die Besonderheiten dieses Unternehmenstypus74 berücksichtigt, gibt es trotz der herausragenden gesamtwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bedeutung von Familienunternehmen bisher jedoch nicht.75 Daher wird aktuell – wieder76 – zunehmend der Frage nachgegangen, ob es de lege ferenda eines „Sonderrechts für Familienunternehmen“ bedarf.77 De lege lata gelten für Familienunternehmen als auch für jedes andere Unternehmen – je nach Rechtsform – daher die rechtsformspezifischen Regelungen. Aus der Verbindung von Familie und Unternehmen resultieren jedoch viele spezifische Reibungspunkte, weshalb ein besonderer Abstimmungsbedarf unter Berücksichtigung intra- als auch interdisziplinärer Aspekte oftmals vonnöten ist.78
„Das“ Familienunternehmen gibt es nicht.79 Familienunternehmen treten in vielfältiger Größe und verschiedenster Organisations-80 als auch Rechtsform81 (Personenhandelsgesellschaften, [börsennotierte] Kapitalgesellschaften, Mischformen, Stiftungsformen und sogar europäische Gesellschaftsformen) in Erscheinung.82 Überwiegend firmieren sie jedoch aufgrund des geringen Gründungsaufwands und der erhöhten rechtlichen Gestaltungsfreiheit, insbesondere hinsichtlich der Gestaltung personalisierter Regelungen zwecks Erhaltung der Familienbindung und des Familiencharakters, als GmbH oder GmbH & Co. KG.83 Vor allem wegen der Satzungsstrenge des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG, die der Gestaltungsfreiheit Grenzen setzt, kommt hingegen selten84 eine AG als Rechtsform in Betracht.85 Wegen der persönlichen Haftung der Komplementäre86 wird eine OHG oder (reine) KG87 lediglich als sog. Holding-Gesellschaft gewählt.88 Größere Familienunternehmen wählen aber auch speziellere Rechtsformen wie die SE, die KGaA oder auch die SE & Co. KGaA.89
Die Wahrung und Sicherung des Familieneinflusses verbunden mit der Möglichkeit, durch statutarische Regelungen auf die Unternehmensleitung generationsübergreifend Einfluss zu nehmen oder zumindest diese zu kontrollieren, sind bei der (individuellen) Wahl der Rechtsform eines Familienunternehmens dabei, neben der Berücksichtigung seiner typusprägenden Charakteristika90, tragende Entscheidungskriterien.91
Eine pauschale Gleichstellung92 von Familienunternehmen mit kleinen und mittleren/mittelständischen Unternehmen (sog. KMU93) oder dem Mittelstand94 ist zu kurz gegriffen.95 Denn ein Unternehmen, das nicht unter dem Begriff der KMU oder des Mittelstands fällt, kann dennoch die Eigenschaften eines Familienunternehmens haben (etwa BMW, Dr. Oetker, Haniel, Henkel, Merck).96 Größe, Umsatz oder Rechtsform des Unternehmens sind für die Zuordnung zum Unternehmenstypus Familienunternehmen irrelevant.97 Vielmehr ist der beherrschende Einfluss mind. einer Unternehmerfamilie auf das Familienunternehmen für die Qualifizierung als Familienunternehmen maßgeblich.98 Eine trennscharfe Abgrenzung ist freilich schwerlich möglich.99
Obgleich in der Lebenswirklichkeit wohl ein jeder intuitiv in der Lage sein wird, ein Familienunternehmen zu benennen (z. B. Dr. Oetker, Hipp, Haniel, Deichmann, Fielmann, Miele u. v. m.)100, ist es im Besonderen aufgrund des in der Praxis mannigfaltigen Vorkommens aber nicht verwunderlich, dass bis heute keine einheitliche101, gar gesetzliche102 Definition des Begriffs Familienunternehmen bzw. Familiengesellschaft103 existiert.104
Gerade die „Mannigfaltigkeit der Familienunternehmen“ macht eine eindeutige Begriffsbestimmung schwierig.105 Die Rechtsprechung106 verwendet den Begriff des Familienunternehmens bzw. Familiengesellschaft zwar gelegentlich, erläutert oder definiert107 diesen aber nicht, wozu sie auch nicht zwingend veranlasst ist, da es sich dabei nicht um einen Gesetzesbegriff108, sondern vielmehr „um einen aus der tatsächlichen Anschauung gewonnenen Begriff“109 handelt. Insofern kann man – wie bereits in der betriebswirtschaftlichen Literatur konstatiert – auch in der Rechtswissenschaft von einem sog. „Family Business Definition Problem“110 ausgehen.
Da eine abstrakt-generelle Definition fehlt bzw. allein nicht ausreichend ist, um alle Erscheinungsformen von Familienunternehmen zu erfassen, handelt es sich beim Begriff des Familienunternehmens um einen offenen Typusbegriff, der nur anhand von diversen, besonderen Merkmalen111 beschrieben werden kann.112 Diese Merkmale müssen zwar nicht in ihrer Gesamtheit vorliegen, damit ein Unternehmen auch als Familienunternehmen anzusehen ist; freilich wird ein Familienunternehmen in der Regel sämtliche oder viele dieser Charakteristika aufweisen.113 Als Typusbegriff ist der Begriff des Familienunternehmens auch nicht in Stein gemeißelt, sondern offen für gesellschaftliche Veränderung und Fortentwicklung. Ein Typusbegriff kann aber im Laufe der Zeit fest umrissene und sogar gesetzliche Konturen gewinnen.114 Der Begriff Familienunternehmen und in Abgrenzung zu diesem derjenige der anonymen Publikumsgesellschaft115 haben insoweit gemein, als sie einen real existierenden Gesellschaftstyp beschreiben, der sich anhand der jeweiligen Gesellschaft- und Gesellschafterstruktur kennzeichnet, aber unabhängig von einer bestimmten Rechtsform anzutreffen ist.116 Die normative Erfassung ist aber auch bei Anerkennung, dass es sich beim Begriff Familienunternehmen um einen Typusbegriff handelt, nicht einfach zu bewältigen, da sich ein Familienunternehmen gerade durch ein inneres, verbindendes Wertesystem und die subjektiven Einstellungen der (Familien-)Akteure auszeichnet, sodass eine große Heterogenität von Familienunternehmen vorzuweisen ist. Bei der typologischen Erfassung des Familienunternehmens kann aber an die für diese typischen Gesellschaftsverträge angeknüpft werden, die Klauseln enthalten, die gerade auf das langfristige, generationenübergreifende Interesse am Bestand des Unternehmens unter Wahrung des Familieneinflusses gerichtet und daher bei Familienunternehmen typisch sind.117 Auf diese den Typus Familienunternehmen auszeichnenden Charakteristika wird im Einzelnen noch an anderer Stelle eingegangen.118
Prosaisch gesprochen, versteht man im Allgemeinen unter einem Familienunternehmen ein Unternehmen unter Familieneinfluss.119 Allen gängigen Definitionsversuchen sind dabei vornehmlich zwei Bestandsmerkmale gemein. Dies sind zum einen die familiäre Verbundenheit unter den Gesellschaftern und zum anderen der maßgebende120 Einfluss der Familie im Unternehmen.121
1. Familiäre Verbundenheit
Ein Familienunternehmen ist als ein Unternehmen zu verstehen, dessen nervus rerum und zugleich wichtigstes Differenzierungskriterium der familiäre Bezug ist. Hinsichtlich der Erforderlichkeit des Merkmals der familiären Verbundenheit besteht daher weitgehend Einigkeit.122
Was unter familiärer Verbundenheit resp. Familie rechtlich genau zu verstehen ist, wird dabei in der Literatur oft – mit Blick auf eine fehlende gesetzliche Definition123 und das uneinheitliche (Rechts-)Verständnis des sich stark dem gesellschaftlichen Wandel124 unterliegenden Begriffs „Familie“125 – nicht näher erörtert.126 Daher verwundert es nicht, dass die Familie bzw. ihre konkrete Zusammensetzung innerhalb der Familienunternehmensforschung gemeinhin als vernachlässigte Größe gilt.127 Jedenfalls von einer Begrenzung auf die sog. Kernfamilie128 ist abzusehen.129 Dies wäre aufgrund der in der heutigen Lebenswirklichkeit verschiedensten Zusammensetzungen von Familien130 auch nicht zeitgemäß.
Der Kreis der zur Familie zählenden Mitglieder ist vielmehr – in Anlehnung an § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 DrittelbG i. V. m. § 15 Abs. 1 Nr. 2 bis 8, Abs. 2 AO – weit zu verstehen. Eine familiäre Verbundenheit der Gesellschafter ist daher jedenfalls aufgrund Verwandtschaft (§ 1589 BGB), Schwägerschaft (§ 1590 BGB) oder Ehe (§§ 1303 ff. BGB) zu bejahen.131 Im Übrigen steht es den Familiengesellschaftern aber auch frei, in Bezug auf die Besetzung von Gremien oder Übertragung von Gesellschaftsanteilen, etwa im Gesellschaftsvertrag132 oder in einer sog. Familienverfassung133 näher zu bestimmen, wer zur „Familie“ gehört und wer als familienfremd angesehen werden soll (z. B. hinsichtlich angeheirateten Personen oder eingetragenen Lebenspartnern).134
Zu beachten ist, dass auch dann von einem Familienunternehmen auszugehen ist, wenn nicht nur eine135, sondern mehrere136 Familien137 oder auch familienfremde Dritte (jedenfalls als Minderheitsgesellschafter) am Unternehmen beteiligt sind.138 Das Verständnis eines Familienunternehmens als familiäre „wholly owned company“ wird heutzutage weit überwiegend abgelehnt.139
Details
- Seiten
- 858
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631934319
- ISBN (ePUB)
- 9783631934326
- ISBN (Hardcover)
- 9783631931332
- DOI
- 10.3726/b22707
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (April)
- Schlagworte
- Familienunternehmenscharakter Familieneinfluss unternehmensverbundene Stiftung Stifterfreiheit Stiftungsrechtsreform Unternehmensnachfolge Stiftungsrecht Familienstiftung Familienunternehmen
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 858 S., 6 farb. Abb., 1 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG