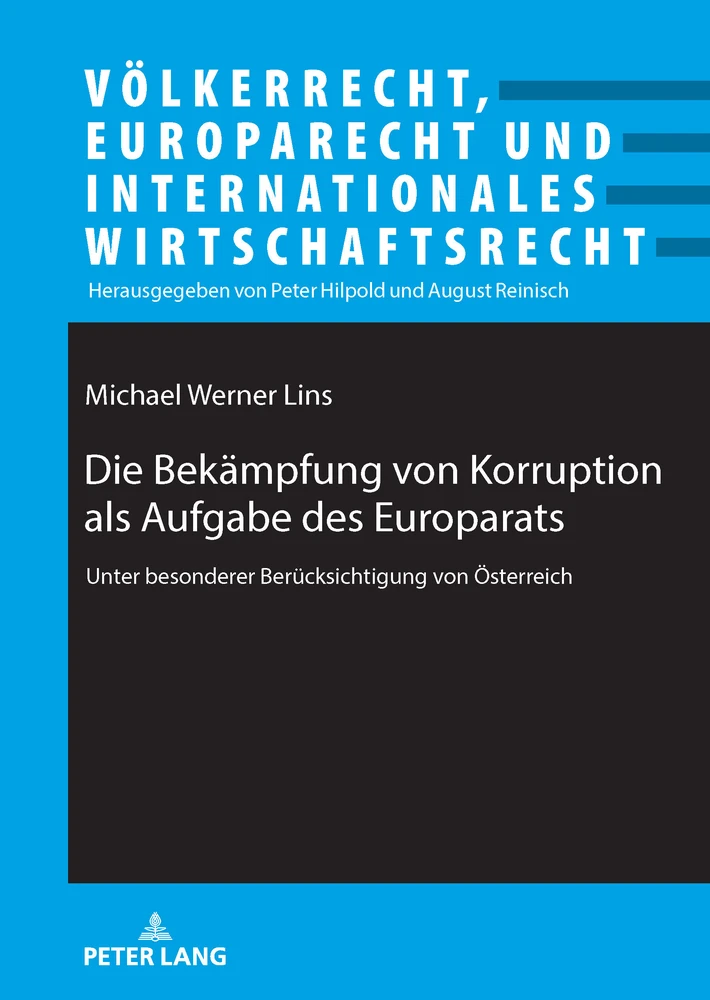Die Bekämpfung von Korruption als Aufgabe des Europarats
unter besonderer Berücksichtigung von Österreich
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Schmutztitel
- Völkerrecht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Epigraph
- Abbildung
- 1. Einleitung
- Das Phänomen
- 2. Der Begriff Korruption
- 2.1 Begriffsherkunft
- 2.2 Wissenschaftliche Definitionen
- 2.2.1 Bedeutung von Definitionen in der Wissenschaft
- 2.2.2 Definitionen in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen
- 2.2.2.1 Definitionsansatz aus der Perspektive der Wirtschaftswissenschaften
- 2.2.2.2 Definitionsansatz aus der Perspektive der Politikwissenschaften
- 2.2.2.3 Definitionsansatz aus der Perspektive der Soziologie
- 2.2.2.4 Definitionsansatz aus der Perspektive der Rechtswissenschaften
- 2.3 Der Begriff Korruption aus der Perspektive der österreichischen Rechtsordnung
- 2.4 Der Begriff Korruption aus der internationalen Perspektive
- 2.4.1 Transparency International (TI)
- 2.4.2 Vereinte Nationen (UNO)
- 2.4.3 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
- 2.4.4 Europäische Union (EU)
- 2.5 Fazit
- 3. Das Phänomen Korruption
- 3.1 Modelle der Korruption
- 3.1.1.1 Das Prinzipal-Agenten-Klienten-Modell
- 3.1.1.2 Das Renten-Allokation-Modell
- 3.2 Erscheinungsformen der Korruption
- 3.2.1 Grand Corruption and Petty Corruption
- 3.2.2 Aktive und passive Korruption
- 3.2.3 Situative, strukturelle und systematische Korruption
- 3.2.4 Korrupte Handlungen
- 3.2.4.1 Bestechung
- 3.2.4.2 Ermessensmissbrauch
- 3.2.4.3 Patronage, Vetternwirtschaft, Klientelismus
- 3.2.4.4 Illegale Parteifinanzierung
- 3.3 Auswirkungen von Korruption
- 3.3.1 Negative Auswirkungen von Korruption
- 3.3.1.1 Fehlsteuerung i. Z. m. öffentlichen Ressourcen
- 3.3.1.2 Politische Steuerungseinbußen
- 3.3.1.3 Schädigung der Demokratie und des Rechtsstaats
- 3.3.1.4 Verzerrung des politischen Wettbewerbs
- 3.3.2 Positive Auswirkungen von Korruption
- Der Europarat
- 4. Grundlagen des Europarats
- 4.1 Die Europaidee als Ausgangspunkt
- 4.1.1 Ursprung der Europaidee
- 4.1.2 Zwei Theorien: Europaidee und die Souveränität der Nationalstaaten
- 4.1.3 Wiederentdeckung der Europaidee in der Zwischenkriegszeit
- 4.1.3.1 Paneuropabewegung
- 4.1.3.2 Briand-Denkschrift 1930
- 4.1.4 Europaidee in der Nachkriegszeit
- 4.2 Werdegang des Europarats
- 4.2.1 Der Urkonflikt: Staatliche Souveränität oder überstaatliche Föderation
- 4.2.2 Der Europakongress
- 4.2.3 Der Brüsseler Fünfmächtepakt
- 4.2.4 Der 5. Mai 1949 – Gründungskonferenz
- 5. Darstellung des Europarats
- 5.1 Aufgaben und Prinzipien des Europarats
- 5.1.1 Einleitung
- 5.1.2 Die Grundprinzipien und Tätigkeitsfelder des Europarats
- 5.1.2.1 Die Grundprinzipien des Europarats
- 5.1.2.2 Die Aufgabengebiete des Europarats
- 5.1.3 Der Zusammenschluss der europäischen Staaten
- 5.1.3.1 Mitgliedschaft
- 5.1.3.2 Assoziierte Mitgliedschaft
- 5.1.3.3 Beobachterstaaten
- 5.1.3.4 Sondergaststaaten
- 5.1.3.5 Beendigung der Mitgliedschaft
- 5.2 Die Organe des Europarats
- 5.2.1 Das Ministerkomitee
- 5.2.1.1 Zusammensetzung des Ministerkomitees
- 5.2.1.2 Das rechtliche Instrumentarium des Ministerkomitees
- 5.2.2 Die Parlamentarische Versammlung
- 5.2.2.1 Zusammensetzung der Parlamentarischen Versammlung
- 5.2.2.2 Das rechtliche Instrumentarium der Parlamentarischen Versammlung
- 5.2.3 Das Sekretariat
- 5.2.3.1 Zusammensetzung des Sekretariats
- 5.2.3.2 Aufgaben des Sekretariats
- 5.3 Der Europarat als Hüter der Menschenrechte
- Korruptionsbekämpfung: Europarat
- 6. Schlüsselmomente der Antikorruptionspolitik des Europarats
- 6.1 19. Fachministerkonferenz der europäischen Justizminister
- 6.2 Errichtung der Multidisciplinary Group on Corruption (GMC)
- 6.3 Aktionsprogramm gegen Korruption 1996 und die 21. Fachministerkonferenz der europäischen Justizminister
- 6.3.1 Aktionsprogramm gegen Korruption
- 6.3.2 21. Fachministerkonferenz der europäischen Justizminister
- 6.4 Zweites Gipfeltreffen in Straßburg
- 6.5 Die weiteren Schritte ab 1997
- 6.5.1 Die zwanzig Leitprinzipien im Kampf gegen Korruption
- 6.5.2 Schaffung der GRECO
- 6.5.2.1 Annahme durch das Ministerkomitee
- 6.5.2.2 Exkurs: Erweitertes Teilabkommen
- 6.5.2.3 Gründung der GRECO
- 6.5.3 Straf- und Zivilrechtsübereinkommen über Korruption
- 6.5.3.1 Das Strafrechtsübereinkommen über Korruption
- 6.5.3.2 Das Zivilrechtsübereinkommen über Korruption
- 6.5.4 Weitere Entwicklungen seit 2000
- 6.5.4.1 Empfehlung zu Verhaltenskodizes für Amtsträger
- 6.5.4.2 Empfehlung zu gemeinsamen Regeln gegen Korruption bei der Finanzierung politischer Parteien und Wahlkampagnen
- 7. Group of States against Corruption (GRECO)
- 7.1 Einleitung
- 7.1.1 Schaffung eines Überwachungsmechanismus
- 7.1.2 Schaffung der GRECO
- 7.2 Allgemeines
- 7.2.1 Ziele und Aufgaben
- 7.2.2 GSG und GGO
- 7.2.2.1 Die GSG
- 7.2.2.2 Änderung der Satzung der GRECO
- 7.2.2.3 Erlass einer Geschäftsordnung und Änderung
- 7.2.3 Sitz
- 7.2.4 Arbeitssprachen der GRECO
- 7.2.5 Vermögen und Finanzhaushalt
- 7.2.6 Jährlicher Tätigkeitsbericht
- 7.3 Beteiligte der GRECO
- 7.3.1 Mitgliedschaft der Staaten
- 7.3.1.1 Aufnahmeverfahren
- 7.3.1.2 Mitgliedstaaten
- 7.3.2 Mitgliedschaft der EU
- 7.3.2.1 Kooperation: Der Europarat und die EU
- 7.3.2.2 Aufnahmeverfahren
- 7.3.2.3 Beobachterstatus der EU
- 7.3.3 Weitere Beteiligte
- 7.3.3.1 Weitere Satzungsbeteiligte
- 7.3.3.2 Beteiligte mit Beobachterstatus
- 7.3.3.3 Weitere Beteiligte in der GRECO
- 7.3.4 Vertretung der Beteiligten
- 7.3.4.1 Allgemeines
- 7.3.4.2 Rechte der Vertreter in der GRECO
- 7.3.4.3 Vorrechte und Befreiungen gemäß Art. 6 Abs. 3 GSG
- 7.3.5 Austritt aus der GRECO
- 7.3.6 Verschwiegenheitsverpflichtungen
- 7.4 Organe | Einrichtungen
- 7.4.1 Plenarversammlung
- 7.4.1.1 Kompetenzen
- 7.4.1.2 Plenarversammlungen und Arbeitsgruppen
- 7.4.1.3 Ablauf der Sitzungen
- 7.4.1.4 Abstimmung und Beschlussfassung
- 7.4.1.5 Beschlussprotokoll und Liste gefasster Beschlüsse
- 7.4.2 Satzungsausschuss
- 7.4.3 Präsidium
- 7.4.3.1 Wahl und Zusammensetzung
- 7.4.3.2 Aufgaben des Präsidiums
- 7.4.3.3 Präsident und Vizepräsident
- 7.4.3.4 Gegenwärtige Zusammensetzung des Präsidiums
- 7.4.4 Sekretariat
- 7.5 Evaluierungsverfahren
- 7.5.1 Zweck und Rechtsgrundlage
- 7.5.2 Eingeleitete Evaluierungsverfahren
- 7.5.3 Aufbau eines Evaluierungsverfahrens
- 7.5.3.1 Allgemeine Ausführungen zum Aufbau
- 7.5.3.2 Strukturelle Darstellung
- 7.5.4 Vorbereitungsphase
- 7.5.4.1 Zu evaluierende Bestimmungen | Evaluierungsfrist | Fragebögen
- 7.5.4.2 Evaluierungsteams
- 7.5.5 Deklarationsphase
- 7.5.6 Überprüfungsphase
- 7.5.6.1 Auswertung der Fragebögen | Einholung zusätzlicher Informationen
- 7.5.6.2 Länderbesuche
- 7.5.7 Evaluierungsberichtsphase
- 7.5.7.1 Aufbau eines Evaluierungsberichts
- 7.5.7.2 Erstellung des Evaluierungsberichtsentwurfs | Stellungnahme
- 7.5.7.3 Annahme des Evaluierungsberichts in der Plenarversammlung
- 7.5.7.4 Vertraulichkeit der Evaluierungsberichte
- 7.5.8 (Erste) Evaluierungsberichtkontrollphase
- 7.5.8.1 Der Zwischenbericht
- 7.5.8.2 Das Kontrollteam
- 7.5.8.3 Erstellung eines Umsetzungsberichtes
- 7.5.8.4 Erörterung und Annahme des Umsetzungsberichts
- 7.5.9 Zweite Evaluierungsberichtskontrollphase
- 7.5.10 Sanktionsphase
- 7.5.10.1 Die Grundsätze der Sanktionsphase
- 7.5.10.2 Die Sanktionen
- 7.5.10.3 Öffentliche Erklärung gemäß Art. 16 GSG i. V. m. Art. 33 GGO
- 7.5.11 Ad-hoc-Verfahren
- 7.5.11.1 Voraussetzungen
- 7.5.11.2 Verfahren
- 7.5.11.3 Eingeleitete Ad-hoc-Verfahren
- 7.5.12 Veröffentlichungen
- 8. Die primären Instrumente des Antikorruptionsregimes
- 8.1 Einteilung der primären Instrumente
- 8.1.1 Die Guiding-Instrumente
- 8.1.2 Die Völkerrechtsverträge
- 8.1.3 Die Empfehlungen des Ministerkomitees
- 8.2 Zwanzig Leitprinzipien gegen Korruption
- 8.2.1 Allgemeines
- 8.2.2 Die zwanzig Leitprinzipien
- 8.2.2.1 Leitprinzipien zu den Themen Sicherstellung und Gewährleistung
- 8.2.2.2 Leitprinzipien zu den Themen Förderung und Unterstützung
- 8.2.2.3 Leitprinzipien hinsichtlich sonstiger Maßnahmen
- 8.3 Das Strafrechtsübereinkommen über Korruption (StÜK)
- 8.3.1 Zweck
- 8.3.2 Aufbau
- 8.3.3 Unterzeichnung | Vertragsstaaten
- 8.3.4 Inhalt des StÜK
- 8.3.4.1 Definitionen (Art. 1 StÜK)
- 8.3.4.2 Öffentliche Bestechung und Bestechlichkeit (Art. 2 bis 6 StÜK)
- 8.3.4.3 Private Bestechung und Bestechlichkeit (Art. 7 und 8 StÜK)
- 8.3.4.4 Internationale Bestechung und Bestechlichkeit (Art. 9 bis 11 StÜK)
- 8.3.4.5 Missbräuchliche Einflussnahme (Art. 12 StÜK)
- 8.3.4.6 Geldwäscherei: Erträge aus den Korruptionsdelikten (Art. 13 StÜK)
- 8.3.4.7 Zuwiderhandlungen gegen Buchführungsvorschriften (Art. 14 StÜK)
- 8.3.4.8 Umzusetzende Maßnahmen i. Z. m. N. P. und J. P. (Art. 15, 16, 18, 22 StÜK)
- 8.3.4.9 Institutionell umzusetzende Maßnahmen (Art. 17, 19–23 StÜK)
- 8.3.4.10 Überwachung des Übereinkommens (Art. 24 StÜK)
- 8.3.4.11 Internationale strafrechtliche Zusammenarbeit im Rahmen des StÜK (Art. 25 bis 31 StÜK)
- 8.3.4.12 Schlussbestimmungen zum Übereinkommen (Art. 32 bis 42 StÜK)
- 8.4 Das Zusatzprotokoll zum Strafrechtsübereinkommen über Korruption (ZP-StÜK)
- 8.4.1 Zweck
- 8.4.1.1 Zusatzprotokolle
- 8.4.1.2 Zweck des Zusatzprotokolls
- 8.4.2 Aufbau
- 8.4.3 Unterzeichnung / Vertragsstaaten
- 8.4.4 Inhalt des Zusatzprotokolls
- 8.4.4.1 Begriffsbestimmungen (Art. 1 ZP-StÜK)
- 8.4.4.2 Bestechung und Bestechlichkeit i. Z. m. Schiedsrichtern und Schöffen aus dem In- und Ausland (Art. 2 bis 6 ZP-StÜK)
- 8.4.4.3 Überwachung und Schlussbestimmungen des Zusatzprotokolls (Art. 7 bis 14 ZP-StÜK)
- 8.5 Das Zivilrechtsübereinkommen über Korruption (ZrÜK)
- 8.5.1 Zweck
- 8.5.2 Aufbau
- 8.5.3 Unterzeichnung | Vertragsstaaten
- 8.5.4 Inhalt des Übereinkommens
- 8.5.4.1 Zweck des Übereinkommens (Art. 1 ZrÜK)
- 8.5.4.2 Legaldefinition (Art. 2 ZrÜK)
- 8.5.4.3 Schadenersatz (Art. 3 ZrÜK)
- 8.5.4.4 Voraussetzungen des Schadenersatzes (Art. 4 ZrÜK)
- 8.5.4.5 Amts- bzw. Staatshaftung (Art. 5 ZrÜK)
- 8.5.4.6 Mitverschulden des Klägers (Art. 6 ZrÜK)
- 8.5.4.7 Verjährung von Schadenersatzansprüchen (Art. 7 ZrÜK)
- 8.5.4.8 Nichtigkeit | Bekämpfbarkeit von Vertragsbestimmungen (Art. 8 ZrÜK)
- 8.5.4.9 Schutz von Beschäftigten (Art. 10 ZrÜK)
- 8.5.4.10 Rechnungslegung und Abschlussprüfung (Art. 10 ZrÜK)
- 8.5.4.11 Beweise und einstweilige Maßnahmen (Art. 11 und 12 ZrÜK)
- 8.5.4.12 Internationale vertragsstaatliche Zusammenarbeit (Art. 13 ZrÜK)
- 8.5.4.13 Überwachung (Art. 14 ZrÜK)
- 8.5.4.14 Schlussbestimmungen zum Übereinkommen (Art. 15 bis Art. 23 ZrÜK)
- 8.6 Empfehlung zu Verhaltenskodizes für Amtsträger
- 8.6.1 Allgemeines zu Verhaltenskodizes
- 8.6.2 Empfehlung R(2000)10
- 8.6.2.1 Zweck
- 8.6.3 Anhang zur Empfehlung R(2000)10: Musterkodex für Amtsträger
- 8.6.3.1 Allgemeines zum Musterkodex
- 8.6.3.2 Auslegung und Anwendung (Art. 1 MK)
- 8.6.3.3 Auslegung und Anwendung (Art. 2 MK)
- 8.6.3.4 Zweck (Art. 3 MK)
- 8.6.3.5 Allgemeine Grundsätze (Art. 4 bis Art. 11 MK)
- 8.6.3.6 Meldepflichten (Art. 12 MK)
- 8.6.3.7 Interessenkonflikt und Abgabe einer Interessenerklärung (Art. 13 und 14 MK)
- 8.6.3.8 Unvereinbare externe Interessen (Art. 15 MK)
- 8.6.3.9 Politische/Öffentliche Tätigkeit (Art. 16 MK)
- 8.6.3.10 Schutz der Privatsphäre (Art. 17 MK)
- 8.6.3.11 Geschenke (Art. 18 MK)
- 8.6.3.12 Reaktion auf missbräuchliche Angebote (Art. 19 MK)
- 8.6.3.13 Beeinflussung durch Andere (Art. 20 MK)
- 8.6.3.14 Missbrauch der Amtsstellung (Art. 21 MK)
- 8.6.3.15 Behördeninformationen (Art. 22 MK)
- 8.6.3.16 Grundsätze bei der Verwendung öffentlicher Mittel (Art. 23 MK)
- 8.6.3.17 Integritätsüberprüfungen (Art. 24 MK)
- 8.6.3.18 Aufsicht (Art. 25 MK)
- 8.6.3.19 Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst und Behandlung ehemaliger Amtsträger (Art. 26 und 27 MK)
- 8.6.3.20 Beachtung der Bestimmungen und Sanktionen (Art. 28 MK)
- 8.7 Empfehlung zu gemeinsamen Regeln gegen Korruption bei der Finanzierung politischer Parteien und Wahlkampagnen
- 8.7.1 Korruption in Wahlverfahren
- 8.7.2 Empfehlung Rec(2003)4
- 8.7.2.1 Zweck
- 8.7.3 Anhang zur Empfehlung Rec(2003)4: Gemeinsame Regeln gegen Korruption bei der Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkampagnen
- 8.7.3.1 Allgemeines zum Anhang
- 8.7.3.2 Öffentliche und private Unterstützung von politischen Parteien (Art. 1 RFPW)
- 8.7.3.3 Definition einer an eine politische Partei gerichtete Spende (Art. 2 RFPW)
- 8.7.3.4 Allgemeine Prinzipien i. Z. m. Spenden (Art. 3 RFPW)
- 8.7.3.5 Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden (Art. 4 RFPW)
- 8.7.3.6 Weitere Maßnahmen i. Z. m. J. P. als Spender (Art. 5 RFPW)
- 8.7.3.7 Mit einer politischen Partei verbundene Einrichtungen als Spender (Art. 6 RFPW)
- 8.7.3.8 Ausländische Spende (Art. 7 RFPW)
- 8.7.3.9 Finanzierung von Wahlkandidaten und gewählten Vertretern (Art. 8 RFPW)
- 8.7.3.10 Höchstgrenzen für Ausgaben politischer Parteien/Kandidaten politischer Wahlen und Aufzeichnung von Ausgaben (Art. 9 und 10 RFPW)
- 8.7.3.11 Buchführung (Art. 11 bis 13 RFPW)
- 8.7.3.12 Unabhängiges Überwachungsorgan (Art. 14 RFPW)
- 8.7.3.13 Aus- und Weiterbildung des Personals (Art. 15 RFPW)
- 8.7.3.14 Sanktionen (Art. 16 RFPW)
- Republik Österreich
- 9. Völkerrecht und österreichisches nationales Recht
- 9.1 Allgemeines
- 9.2 Die österreichischen Bestimmungen
- 9.2.1 Art. 9 Abs. 1 B-VG
- 9.2.2 Völkerrechtsverträge
- 9.2.2.1 Kategorisierung der Antikorruptionsrechtsinstrumente
- 9.2.2.2 Völkerrechtsverträge im B-VG
- 9.2.3 Das StÜK, ZP-StÜK und das ZrÜK
- 10. Antikorruption in Österreich
- 10.1 Die zentralen Antikorruptionsbehörden in Österreich
- 10.1.1 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK)
- 10.1.2 Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA)
- 10.1.3 Koordinationsgremium zur Korruptionsbekämpfung (KGKB)
- 10.1.4 Rechnungshof und Volksanwaltschaft
- 10.1.4.1 Rechnungshof
- 10.1.4.2 Volksanwaltschaft
- 10.2 Die strafrechtlichen Antikorruptionsbestimmungen
- 10.2.1 Der Begriff Korruption im österreichischen Strafrecht
- 10.2.1.1 StGB ab 1945
- 10.2.1.2 Antikorruptionsgesetze und KorrStrÄG 2009
- 10.2.1.3 KorrStrÄG 2012
- 10.2.2 Die Bestimmungen des Antikorruptionsstrafrechts
- 10.2.2.1 Territoriale Geltung des österreichischen Antikorruptionsstrafrechts
- 10.2.2.2 Einteilung der österreichischen Antikorruptionsstrafrechtsbestimmungen
- 10.2.2.3 § 302 StGB: Missbrauch der Amtsgewalt
- 10.2.2.4 §§ 304–306 StGB: Bestechlichkeit | Vorteilsannahme | Vorteilsannahme zur Beeinflussung
- 10.2.2.5 §§ 307–307b StGB: Bestechung | Vorteilszuwendung | Vorteilszuwendung zur Beeinflussung
- 10.2.2.6 § 308 StGB: Verbotene Intervention
- 10.2.2.7 § 309 StGB: Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten bzw. Beauftragten
- 10.2.2.8 § 310 StGB: Verletzung des Amtsgeheimnisses
- 10.2.2.9 § 311 StGB: Falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt
- 10.2.2.10 § 153 StGB: Untreue
- 10.2.2.11 § 153a StGB: Geschenkannahme durch Machthaber
- 10.2.2.12 § 153b StGB: Förderungsmissbrauch
- 10.2.2.13 § 168b: Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren
- 10.2.2.14 §§ 168f und 168g StGB: Ausgabenseitiger Betrug bzw. Missbräuchliche Verwendung von Mitteln und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU
- 10.2.2.15 § 313 StGB: Strafbare Handlung unter Ausnützung einer Amtsstellung
- 11. Mängel und Reformbedarf in Österreich unter Berücksichtigung der fünften Evaluierungsrunde
- 11.1 Einleitung
- 11.2 Allgemeines zum Evaluierungsbericht der fünften Evaluierungsrunde
- 11.2.1 Einleitung und Gegenstand der Evaluierungsrunde
- 11.2.2 Das Evaluierungsteam
- 11.2.3 Länderbesuch des Evaluierungsteams
- 11.2.4 Übermittlung des Evaluierungsberichts an Österreich
- 11.3 Schwachstellen des nationalen Antikorruptionssystems, Kritik und Empfehlungen unter Berücksichtigung der Ausführungen im fünften Evaluierungsbericht
- 11.3.1 Übersicht über die Empfehlungen der GRECO
- 11.3.2 Unzureichende Rechtsgrundlage der Generalsekretäre und Kabinettsmitarbeiter
- 11.3.3 Mangelhafte Antikorruptionsstrategie und unzureichendes Risikomanagement der Strafverfolgungsbehörden
- 11.3.3.1 Allgemeines zur NAKS
- 11.3.3.2 Lückenhafte NAKS
- 11.3.3.3 Risikomanagement der Kriminalpolizei und des BAK
- 11.3.4 Verhaltenskodizes
- 11.3.5 Transparenzbestimmungen
- 11.3.5.1 Verhältnis Korruption und Transparenz
- 11.3.5.2 Aktuelle Lage in Österreich | Art. 20 Abs. 4 B-VG
- 11.3.5.3 Novellierung zur Stärkung von Transparenz
- 11.3.5.4 Förderung von Transparenz im Gesetzgebungsprozess
- 11.3.5.5 Förderung von Transparenz im Gesetzgebungsprozess: Lobbying
- 11.3.5.6 Förderung von Transparenz i. Z. m. Spenden und Sponsoring bei Ermittlungs- sowie Exekutivbediensteten
- 11.3.6 Interessenkonflikte
- 11.3.6.1 Interessenkonflikte
- 11.3.6.2 Interessenkonflikte i. Z. m. Nebentätigkeiten
- 11.3.6.3 Interessenkonflikte i. Z. m. unzureichender Cooling-off-Phase
- 11.3.6.4 Interessenkonflikte bei Ermittlungs- und Exekutivbedienstete
- 11.3.7 Unzureichende Offenlegung von Vermögensverhältnissen
- 11.3.8 Mangelnde Unabhängigkeit der judiziellen Gewalt
- 11.3.8.1 Einflussnahme auf die von den Strafverfolgungsbehörden zu beurteilenden Ermittlungsergebnisse
- 11.3.8.2 Berichtpflichten und Bindung an Weisungen
- 11.3.8.3 Einführung einer Generalstaatsanwaltschaft
- 11.3.8.4 Reform der Volksanwaltschaft
- 11.3.8.5 Richterbestellung im Rahmen eines judiziellen Selbstverwaltungskörpers
- 11.3.9 Einflussfaktor Parteizugehörigkeit auf berufliche Karrieren
- 11.3.10 Whistleblower in der Strafverfolgung
- 11.3.10.1 Allgemeines zu Whistleblowern
- 11.3.10.2 Whistleblowerschutz in Österreich laut GRECO
- 11.3.10.3 HSchG
- 11.3.10.4 Schlussfolgerung
- 11.3.11 Mangelndes Bekenntnis zur Stärkung des Antikorruptionsregimes
- 11.3.11.1 Legistische Modifikation hinsichtlich der Ermittlungshandlung der Sicherstellung
- 11.3.11.2 Vorrang der Amtshilfe gegenüber der Sicherstellung
- 11.3.11.3 Mangelnde Kooperationsbereitschaft
- Schlussbemerkung
- 12. Korruption
- 12.1 Ursprünge von Korruption
- 12.1.1 Früheste Erwähnungen
- 12.1.2 Die Entwicklung unseres Korruptionsverständnisses
- 12.2 Die Definition von Korruption
- 12.2.1 Unterschiedliche Definitionsansätze
- 12.2.1.1 Historische Interpretation
- 12.2.1.2 Vergleichende Analyse der Definitionen mehrerer wissenschaftlicher Fachdisziplinen
- 12.2.2 Definitionsfindung auf internationaler Ebene
- 12.2.2.1 Korruptionsbekämpfung wird zur internationalen Angelegenheit
- 12.2.2.2 Definitionen des Europarats
- 12.2.2.3 Definition von TI
- 12.2.3 Fazit
- 12.3 Folgen von Korruption
- 13. Der Europarat und Korruptionsbekämpfung
- 13.1 Entstehung, Aufbau, Bedeutung des Europarats
- 13.1.1 Die Europaidee und die Entstehung des Europarats
- 13.1.2 Arbeitsweise und Organisation des Europarats
- 13.1.2.1 Zweck und Grundprinzipien (Wertetrias)
- 13.1.2.2 Teilnahmeformen
- 13.1.2.3 Organe des Europarats
- 13.2 Korruptionsbekämpfung als Agenda des Europarats
- 13.2.1 Entwicklung
- 13.3 Antikorruptionsinstrumente
- 13.3.1 Leitprinzipien
- 13.3.2 Empfehlungen des Ministerkomitees
- 13.3.2.1 Allgemeines zu Empfehlungen
- 13.3.2.2 Empfehlung betreffend MK
- 13.3.2.3 Empfehlung betreffend die Finanzierung politischer Parteien und Wahlkämpfen
- 13.3.3 Völkerrechtsverträge
- 13.3.3.1 Allgemeines zu Völkerrechtsverträgen
- 13.3.3.2 StÜK und ZP-StÜK
- 13.3.3.3 ZrÜK
- 13.4 GRECO | Überwachungsregime
- 13.4.1 GRECO
- 13.4.1.1 Einleitung
- 13.4.1.2 Gründung, Zweck, Rechtsgrundlage und Mitglieder
- 13.4.1.3 Organe
- 13.4.2 Evaluierungsverfahren
- 13.4.2.1 Erfordernis effektiver Überwachungsmaßnahmen
- 13.4.2.2 Darstellung des Evaluierungsverfahrens
- 13.4.2.3 Effektivität des Evaluierungsverfahrens | Vergleich mit anderen Überwachungsregimen
- 13.4.3 Das österreichische Antikorruptionsregime
- 13.4.3.1 Der Umgang mit dem Völkerrecht in der österreichischen Rechtsordnung
- 13.4.3.2 Die zentralen Antikorruptionsbehörden in Österreich
- 13.4.3.3 Mängel im österreichischen Antikorruptionsregime
- 13.4.3.4 Unzureichende Verwirklichung des Transparenzgebots
- 13.4.3.5 Schwach ausgeprägte Maßnahmen zur Verhütung von Interessenkonflikten
- 13.4.3.6 Reformbedarf i. Z. m. der Gewaltenteilung
- 13.4.3.7 Mangelhafte NAKS
- 13.4.3.8 Fazit: Gravierende Mängel, Verbesserungsbemühungen und der Einfluss des Europarats
- 13.5 Abschließender Appell
- Literaturverzeichnis
- Literatur
- Rechtsprechung
- Rechtsdokumente
- Online-Ressourcen
- Völkerrecht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht
Völkerrecht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht
Herausgegeben von Peter Hilpold und August Reinisch
Band 32
Für meine Oma!
Erika Dür
Inhaltsverzeichnis
Korruptionsbekämpfung: Europarat
6. Schlüsselmomente der Antikorruptionspolitik des Europarats
7. Group of States against Corruption (GRECO)
8. Die primären Instrumente des Antikorruptionsregimes
8.3 Das Strafrechtsübereinkommen über Korruption (StÜK)
-
8.3.4.2 Öffentliche Bestechung und Bestechlichkeit (Art. 2 bis 6 StÜK)
8.3.4.3 Private Bestechung und Bestechlichkeit (Art. 7 und 8 StÜK)
8.3.4.4 Internationale Bestechung und Bestechlichkeit (Art. 9 bis 11 StÜK)
8.3.4.6 Geldwäscherei: Erträge aus den Korruptionsdelikten (Art. 13 StÜK)
8.3.4.7 Zuwiderhandlungen gegen Buchführungsvorschriften (Art. 14 StÜK)
8.3.4.8 Umzusetzende Maßnahmen i. Z. m. N. P. und J. P. (Art. 15, 16, 18, 22 StÜK)
8.3.4.9 Institutionell umzusetzende Maßnahmen (Art. 17, 19–23 StÜK)
8.3.4.11 Internationale strafrechtliche Zusammenarbeit im Rahmen des StÜK (Art. 25 bis 31 StÜK)
8.3.4.12 Schlussbestimmungen zum Übereinkommen (Art. 32 bis 42 StÜK)
8.4 Das Zusatzprotokoll zum Strafrechtsübereinkommen über Korruption (ZP-StÜK)
Details
- Seiten
- 572
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631936948
- ISBN (ePUB)
- 9783631936955
- ISBN (Hardcover)
- 9783631936689
- DOI
- 10.3726/b22848
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (Oktober)
- Schlagworte
- GRECO Völkerrecht Korruptionsprävention Korruptionsbekämpfung Österreich Korruption Europarat Überwachungsmechanismus Reformvorschläge Rechtsvergleich Internationale Organisationen Überwachung Rechtsstaatlichkeit Zivilrecht Strafrecht
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 572 S. 4 s/w Abb., 12 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG