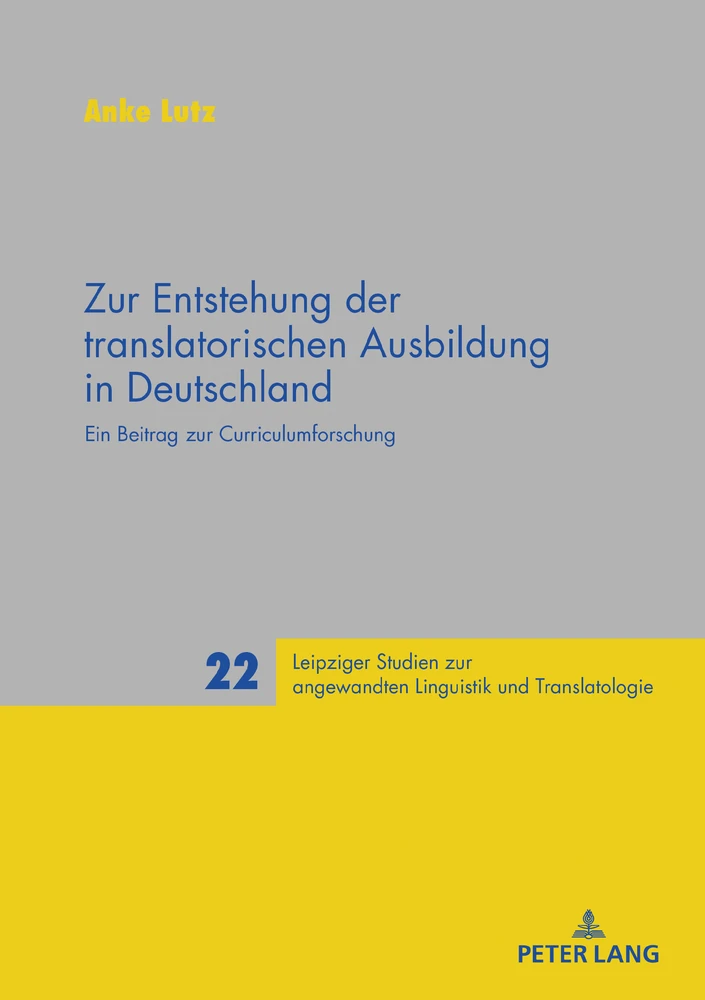Zur Entstehung der translatorischen Ausbildung in Deutschland
Ein Beitrag zur Curriculumforschung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Umschlag
- Schmutztitel
- Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Vorwort
- Widmung
- D - Anke!
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Themenfindung, Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Methode
- 1.3 Archivalien
- 1.4 Forschungsstand
- 2 Hauptteil
- Hintergrund
- 2.1 Geschichtlicher Kontext
- 2.1.1 Entwicklungen in der Philologie (1807–1939)
- 2.1.1.1 Einleitung
- 2.1.1.2 Philologie als Altertumswissenschaft
- 2.1.1.3 Neuphilologie nach altphilologischem Zuschnitt
- 2.1.1.4 Quousque tandem – Wie lange denn noch?
- 2.1.1.5 Die Orientalistik und das Seminar für Orientalische Sprachen
- 2.1.1.6 Spurensuche zur Dimension Ausland
- 2.1.1.7 Kulturkunde
- 2.1.1.8 Neuphilologie als Auslandswissenschaft
- 2.1.1.9 Humaniora und Realia
- 2.1.2 Entwicklungen in Außenpolitik und Weltwirtschaft
- 2.1.2.1 Einleitung
- 2.1.2.2 Diplomatische Beziehungen motivieren Gründung des SOS
- 2.1.2.3 Exkurs: Koloniale Ambitionen beeinflussen Curriculum am SOS
- 2.1.2.4 Außenhandelsbeziehungen legen Basis für DI-Gründungen
- 2.1.2.5 Exkurs: Zum Konferenzwesen des Völkerbundes
- 2.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- Skizzen zur Entstehung der translatorischen Ausbildung: Entwicklungslinie A
- 2.2 Avantgarde der translatorischen Ausbildung in Deutschland
- 2.2.1 Einleitung
- 2.2.2 Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin – Wurzeln der translatorischen Ausbildung
- 2.2.2.1 Die Gründung des Seminars für Orientalische Sprachen (1887)
- 2.2.2.2 Das 25-jährige Jubiläum des Seminars für Orientalische Sprachen (1912)
- 2.2.2.3 Zur curricularen Entwicklung am Seminar für Orientalische Sprachen (1887–1912)
- 2.2.2.4 Nomen non est omen – Kritik am Namen des Seminars für Orientalische Sprachen
- 2.2.3 Der Streit über eine Deutsche Auslandshochschule (1913–1928)
- 2.2.3.1 Der Hintergrund einer langjährigen Reformdebatte (1908–1912)
- 2.2.3.2 Der Auftakt einer langjährigen Reformdebatte (1913–1914)
- 2.2.3.3 Das nationenwissenschaftliche Studium – Innenleben einer Deutschen Auslandshochschule
- 2.2.3.3.1 Die Reform des diplomatischen und konsularischen Dienstes – Ausgangspunkt für eine Bildungsreform
- 2.2.3.3.2 Die Methode des nationenwissenschaftlichen Studiums
- 2.2.3.3.3 Der institutionelle Rahmen für das nationenwissenschaftliche Studium
- 2.2.3.4 Der Erste Weltkrieg als Wegbereiter für die Völkerverständigung
- 2.2.3.5 Die Fortsetzung der Reformdebatte im Ersten Weltkrieg (1916)
- 2.2.3.6 Die Denkschrift über die Förderung der Auslandsstudien (1917)
- 2.2.3.7 Die Umsetzung der Forderungen aus der Denkschrift (1917–1920)
- 2.2.3.8 Ein Vorschlag zur Organisation der Deutschen Auslandshochschule (1920)
- 2.2.3.9 Die Reformdebatte vor dem veränderten politischen Hintergrund (1920–1923)
- 2.2.3.10 Die Denkschrift über die Reform des Seminars für Orientalische Sprachen in Berlin (1923)
- 2.2.3.11 Die Reaktionen und Gegenreaktionen auf die Reformpläne (1923–1924)
- 2.2.3.12 Das Ende der Reformdebatte (1924–1928)
- 2.2.3.13 Die Akteure im Streit über die Deutsche Auslandshochschule
- 2.2.3.13.1 Anton Palme
- 2.2.3.13.2 Georg Kampffmeyer
- 2.2.3.13.3 Eduard Sachau
- 2.2.3.13.4 Eugen Mittwoch
- 2.2.4 Die Ausland-Hochschule an der Universität Berlin
- 2.2.4.1 Zur Existenz der Ausland-Hochschule (1936–1939)
- 2.2.4.2 Zum Curriculum der Ausland-Hochschule
- 2.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2.2.5.1 Die ersten 25 Jahre des SOS (1887–1912)
- 2.2.5.2 Hintergrund der Reformdebatte (1908/1912–1914)
- 2.2.5.3 Das 25-jährige Jubiläum des SOS – Beginn der SOS-Reformdebatte (1912)
- 2.2.5.4 Das nationenwissenschaftliche Studium (1914)
- 2.2.5.5 Der Erste Weltkrieg als Wegbereiter für die Völkerverständigung (1915)
- 2.2.5.6 Dezentralisierung der Auslandsstudien (1916/1917)
- 2.2.5.7 Demontage eines entstehenden Wissenschaftsfachs (1920–1928)
- 2.2.5.8 Die Ausland-Hochschule (1936–1939)
- 2.3 Von Dragomanen und Translatoren – Konturen eines entstehenden Berufsbildes
- 2.3.1 Einleitung
- 2.3.2 Die Dragomane
- 2.3.3 Die Translatoren
- 2.3.4 Die Profilbildung des entstehenden Berufsbildes – Ein Beispiel
- 2.3.5 Paul Gautier – Bildhauer des Übersetzer- und Dolmetscherberufs
- 2.3.6 Zusammenfassung der Ergebnisse
- Skizzen zur Entstehung der translatorischen Ausbildung: Entwicklungslinie B
- 2.4 Handelshochschulen – Geburtsstätten der translatorischen Ausbildung
- 2.4.1 Einleitung
- 2.4.2 Die Handelshochschulbewegung in Deutschland (1897–1914)
- 2.4.3 Die Handelshochschulstandorte mit Dolmetscher-Instituten
- 2.4.3.1 Zur Geschichte der Handelshochschule Leipzig (1898–1945)
- 2.4.3.2 Zur Geschichte der Handelshochschule Mannheim (1907–1933)
- 2.4.4 Die internationale Dimension des kaufmännischen Bildungswesens (1899–1914)
- 2.4.4.1 Die Etablierung internationaler Foren zur Förderung des kaufmännischen Bildungswesens
- 2.4.4.2 Die Internationalen Sprach- und Wirtschaftskurse
- 2.4.4.2.1 Lausanne (1907)
- 2.4.4.2.2 Mannheim (1908)
- 2.4.4.2.3 Le Havre (1909)
- 2.4.4.2.4 Wien (1910)
- 2.4.4.2.5 London (1911)
- 2.4.4.2.6 Antwerpen (1912)
- 2.4.4.2.7 Budapest (1913)
- 2.4.4.2.8 Barcelona (1914)
- 2.4.4.2.9 Resümee der Internationalen Sprach- und Wirtschaftskurse
- 2.4.5 Die Position der Handelshochschulen in der Diskussion über die Deutsche Auslandshochschule (1913–1917)
- 2.4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2.5 Zum Fremdsprachenunterricht und zur Sprachforschung im kaufmännischen Bildungswesen (12. Jh.–1938)
- 2.5.1 Einleitung
- 2.5.2 Fremdsprachen als integraler Bestandteil der kaufmännischen Ausbildung (12.–19. Jh.)
- 2.5.3 Zum Fremdsprachenunterricht im kaufmännischen Bildungswesen (1898–1914)
- 2.5.3.1 Grundzüge der Entwicklungen
- 2.5.3.2 Bausteine des Fremdsprachenunterrichts
- 2.5.3.3 Handelskorrespondenzunterricht
- 2.5.4 Zum Fremdsprachenunterricht im kaufmännischen Bildungswesen (1920–1930)
- 2.5.4.1 Fachsprachliches Potenzial
- 2.5.4.2 Methodik des Fremdsprachenunterrichts und Zielgruppen
- 2.5.4.3 Resümee
- 2.5.5 Zum Fremdsprachenunterricht im kaufmännischen Bildungswesen (1928–1938)
- 2.5.5.1 Internationaler Kongress in Amsterdam (1929)
- 2.5.5.2 Internationaler Kongress in London (1932)
- 2.5.5.3 Internationaler Kongress in Prag (1935)
- 2.5.5.4 Exkurs: Erkenntnisse zum Sprachdienstleistungsmarkt (1928 und 1935)
- 2.5.5.5 Internationaler Kongress in Berlin (1938)
- 2.5.6 Zur Sprachforschung an Handelshochschulen
- 2.5.6.1 Kampagne für einen neuen Forschungszweig – Zur Wirtschafts-Linguistik (1932)
- 2.5.6.1.1 Bedarf an Institutionen für die neue Forschungsdisziplin
- 2.5.6.1.2 Bedarf an Fachwörterbüchern
- 2.5.6.1.3 Exkurs: Verknüpfung von Sprach- und Wirtschaftsgeschichte – Ein Beispiel
- 2.5.6.1.4 Zur Fachzeitschrift De Spiegel van Handel en Wandel
- 2.5.6.1.5 Ewald E. J. Messing – unermüdlicher Kämpfer für die Wirtschaftslinguistik
- 2.5.6.2 Versuch einer wirtschaftslinguistischen Studie – Krejčís Werk (1932)
- 2.5.6.2.1 Sprachgeschichtliche Untersuchungen zur deutschen Handelssprache
- 2.5.6.2.2 Wirtschaftssprachliche Untersuchungen
- 2.5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2.5.7.1 Fremdsprachen im kaufmännischen Bildungswesen – Ein geschichtlicher Überblick
- 2.5.7.1.1 Vom 12. bis zum 19. Jahrhundert
- 2.5.7.1.2 Die Jahre von 1898 bis 1914
- 2.5.7.1.3 Die Jahre von 1920 bis 1930
- 2.5.7.2 Die internationale Dimension des kaufmännischen Bildungswesens (1928–1938)
- 2.5.7.2.1 Der Internationale Kongress in Amsterdam (1929)
- 2.5.7.2.2 Der Internationale Kongress in London (1932)
- 2.5.7.2.3 Der Internationale Kongress in Prag (1935)
- 2.5.7.2.4 Der Internationale Kongress in Berlin (1938)
- 2.5.7.3 Erste Profilbildung in der Fachsprachenforschung
- 2.5.7.3.1 Bedarf an einer Forschungsinfrastruktur
- 2.5.7.3.2 Bedarf an wissenschaftlich fundiertem Arbeitsmaterial für den Sprachdienstleistungsmarkt
- 2.5.7.4 Wirtschaftslinguistische Studien – Ein Beispiel
- 2.5.7.4.1 Zur Sprachgeschichte der deutschen Handelssprache
- 2.5.7.4.2 Zur Wirtschaftssprache
- Skizzen zur Entstehung der translatorischen Ausbildung: Entwicklungslinien A und B: Curriculare Konzeption der Studiengänge der Dolmetscher-Institute
- 2.6 Die translatorische Ausbildung an der Handelshochschule Mannheim (1928–1933)
- 2.6.1 Einleitung – Ein institutioneller Rahmen für die translatorische Ausbildung
- 2.6.2 Das erste Konzept zur Ausbildung von Dolmetschern auf Hochschulniveau (1928)
- 2.6.3 Die Denkschrift zur Gründung des Dolmetscher-Instituts
- 2.6.3.1 Marktsituation der Dolmetscher (Ende 1920er)
- 2.6.3.2 Standort Mannheim
- 2.6.3.3 Anforderungen an Dolmetscher
- 2.6.3.4 Ziele der Dolmetscherausbildung
- 2.6.3.5 Methoden der Dolmetscherausbildung
- 2.6.3.6 Zulassung zum Studium
- 2.6.3.7 Bedeutung des Dolmetscher-Instituts
- 2.6.3.8 Weitere Informationen aus der Denkschrift
- 2.6.3.9 Resümee der Denkschrift
- 2.6.4 Die Einweihung des Dolmetscher-Instituts (Juli 1930)
- 2.6.5 Die Prüfungsordnungen
- 2.6.6 Die Gründer des Dolmetscher-Instituts
- 2.6.6.1 Charles Glauser
- 2.6.6.2 Curt Gutkind
- 2.6.6.3 Das Gespann Glauser/Gutkind
- 2.6.7 Der Standortwechsel des Dolmetscher-Instituts (1933)
- 2.6.8 Das universitäre Dolmetscher-Institut (1934)
- 2.6.9 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2.7 Die translatorische Ausbildung in Leipzig (1927–1957)
- 2.7.1 Einleitung
- 2.7.2 Die Jahre von 1927 bis 1946
- 2.7.2.1 Der Fremdsprachenunterricht an der Handelshochschule Leipzig
- 2.7.2.2 Die Inhaber der Lehrstühle für Fremdsprachen
- 2.7.2.2.1 Alexander Snyckers – Der Gründer des Dolmetscher-Instituts
- 2.7.2.2.2 Leo von Hibler
- 2.7.2.3 Das geplante Curriculum – Vorbote der translatorischen Ausbildung
- 2.7.3 Die Jahre von 1937 bis 1947
- 2.7.3.1 Die Denkschrift zur Gründung des Dolmetscher-Instituts
- 2.7.3.1.1 Ziele und Rahmenbedingungen
- 2.7.3.1.2 Aufgaben des geplanten Dolmetscher-Instituts
- 2.7.3.1.3 Mitgliedschaft
- 2.7.3.1.4 Prüfungsordnungen
- 2.7.3.2 Die Genehmigung der Prüfungsordnungen
- 2.7.3.3 Das Dolmetscher-Institut im Zweiten Weltkrieg
- 2.7.4 Die Jahre von 1943 bis 1957
- 2.7.4.1 Die Fremdsprachenschule der Stadt Leipzig
- 2.7.4.2 Die Fachrichtung Dolmetscher am Pädagogischen Institut LeipZig
- 2.7.4.3 Das Dolmetscher-Institut an der Karl-Marx-Universität Leipzig
- 2.7.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2.8 Die translatorische Ausbildung in der französischen Besatzungszone (1946–1949)
- 2.8.1 Einleitung – Weltoffenheit in der Provinz
- 2.8.2 Das Dolmetscher-Institut in Germersheim
- 2.8.2.1 Zum historischen Hintergrund
- 2.8.2.2 Die Gründung des Dolmetscher-Instituts in Germersheim (1947)
- 2.8.2.3 Die Angliederung des Dolmetscher-Instituts an die Universität Mainz (1949)
- 2.8.2.4 Die Gründer des Dolmetscher-Instituts
- 2.8.2.4.1 Raymond Schmittlein
- 2.8.2.4.2 Edmund Schramm
- 2.8.3 Das Dolmetscher-Institut in Saarbrücken
- 2.8.3.1 Zum historischen Hintergrund
- 2.8.3.2 Die Gründung der Universität des Saarlandes
- 2.8.3.3 Die Gründung des Dolmetscher-Instituts in Saarbrücken (1948)
- 2.8.3.4 Die Gründer des Dolmetscher-Instituts
- 2.8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3 Schlussbetrachtung und Ausblick
- Zur Entstehung der translatorischen Ausbildung – Ein Bild kommt zum Vorschein
- 3.1 Fokussierungen zur Entstehung der translatorischen Ausbildung
- 3.1.1 Periodisierung
- 3.1.2 Zur Philologie
- 3.1.3 Entwicklungslinien
- 3.1.4 Motivationskräfte und Institutionalisierung
- 3.1.5 Entstehungsphasen
- 3.1.6 Phasen und Typen des Berufsprofils von Dolmetschern und Übersetzern
- 3.1.7 Zur Marktsituation (1880er–1940er Jahre)
- 3.1.8 Zum Bedarf
- 3.1.9 Zur Zielgruppe der translatorischen Ausbildung – Exkurs zum Terminus Dolmetscher
- 3.1.10 Zur Rolle des Staates (1880er–1920er Jahre)
- 3.1.11 Institutionelle Metamorphose der translatorischen Ausbildung (1887–1945)
- 3.1.12 Zur internationalen Dimension des kaufmännischen Bildungswesens
- 3.1.13 Zum Gedanken der Völkerverständigung
- 3.1.14 Zum Studium des Auslandes
- 3.1.15 Zum nationenwissenschaftlichen Studium
- 3.1.16 Zur Wirtschaftslinguistik als frühe Form der Fachsprachenforschung
- 3.1.16.1 Sprache und Sache als Einheit – Ein Selbstverständnis im fremdsprachlichen Unterricht im deutschen Handelsschulwesen bis 1840
- 3.1.16.2 Erstes Aufkeimen wirtschaftssprachlicher Forschungen in Deutschland bis 1914
- 3.1.16.3 Gründung von Forschungseinrichtungen zur Wirtschaftssprache in Deutschland zwischen den Weltkriegen
- 3.1.16.4 Wirtschaftslinguistik – internationales und interdisziplinäres Forschungsfach
- 3.1.16.5 Wirtschaftslinguistik in der Forschung nach 1945
- 3.1.17 Zum Networking in einer entstehenden Branche
- 3.1.18 Zu Fachwörterbüchern
- 3.1.19 Zur Allgemeinbildung
- 3.1.20 Zur Gegenwartssprache
- 3.1.21 Zur Verwendung von Zeitungstexten
- 3.1.22 Zur Rolle der Muttersprache
- 3.1.23 Vom curricularen Zwei-Komponenten-Modell zum Drei-Komponenten-Modell
- 3.1.24 Zum Dolmetschen und Übersetzen
- 3.1.25 Zum kulturellen Verständnis (Kultur- und Sachkunde)
- 3.1.25.1 Entwicklungsstufe 1 (Linie B): Realsprachmethode
- 3.1.25.2 Entwicklungsstufe 2 (Linie A): Von der lapidaren Studienkonzeption am SOS zur nationenwissenschaftlichen Methode (1887–1914)
- 3.1.25.3 Zur Terminusentwicklung: Vom Studium des Auslandes zur Kulturkunde
- 3.1.25.4 Entwicklungsstufe 3 (Linie A und B): Kulturkunde (Zwischen den Weltkriegen)
- 3.1.25.5 Entwicklungsstufe 4 (Linie B): Zur Entstehung der curricularen Komponenten Kulturkunde und Sachkunde
- 3.1.26 Vom Ergänzungsstudium zum Hauptfachstudium
- 3.2 Thesenkanon
- Thesengruppe 1: Allgemeines zur Entstehung der translatorischen Ausbildung
- Thesengruppe 2: Institutionen- und Methodenbildung
- Thesengruppe 3: Studium des Auslandes und Völkerverständigung
- Thesengruppe 4: Fachgebundenes Sprachstudium an Handelshochschulen
- Thesengruppe 5: Curriculum
- Thesengruppe 6: Berufsprofil
- 3.3 Fachgeschichte mit Zukunft? – Ein Ausblick
- 4 Verzeichnisse
- 4.1 Literaturangaben
- 4.1.1 Printmedien
- 4.1.2 Denkschriften
- 4.1.3 Archivalische Quellen
- 4.1.3.1 Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde
- 4.1.3.2 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem
- 4.1.3.3 Landesarchiv Saarbrücken
- 4.1.3.4 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin
- 4.1.3.5 Privatarchiv Snyckers
- 4.1.3.6 Privatarchiv Thiel
- 4.1.3.7 Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden
- 4.1.3.8 Stadtarchiv Leipzig
- 4.1.3.9 Stadtarchiv Rotterdam
- 4.1.3.10 Universitätsarchiv Bonn
- 4.1.3.11 Universitätsarchiv Heidelberg
- 4.1.3.12 Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin
- 4.1.3.13 Universitätsarchiv Leipzig
- 4.1.3.14 Universitätsarchiv Mannheim
- 4.1.3.15 Universitätsarchiv des Saarlandes
- 4.1.4 Vorlesungsverzeichnisse
- 4.1.5 Internetquellen
- 4.2 Bildnachweise
- 4.3 Abbildungen
- 4.4 Tabellarische Übersichten
- 4.5 Abkürzungen
- 4.6 Personen- und Sachregister
Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie
Herausgegeben von Peter A. Schmitt
Band 22
In der vorliegenden Arbeit wird für Personen- und Berufsbezeichnungen die männliche Form verwendet. Dies dient zum einen bei der gegebenen Textverdichtung der Leserlichkeit und dem Textverständnis und zum anderen dem wissenschaftlichen Grundsatz, historische Dokumente und ihre Inhalte nicht zu verfälschen. Die männliche Form gilt im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.
Aus Liebe zur Fremdsprache den vergessenen Vätern der translatorischen Ausbildung
D-Anke!
Das Schöne an meinem Dissertationsprojekt war nicht nur die Entdeckung der verborgenen Fachgeschichte der Translatologie, sondern auch die damit in Verbindung stehende Begegnung mit Menschen in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Zu den hervorzuhebenden Personen der Vergangenheit gehören Charles Glauser und Alexander Snyckers, die Gründer der ersten Dolmetscher-Institute in Deutschland, sowie Anton Palme und Ewald E. J. Messing, die beide zu ersten Methodenbildungen im Fach beigetragen haben. Zu diesem Kreis gehört auch Paul Gautier, der das Profil des Dolmetscher- und Übersetzerberufs als erster Leiter des Sprachendienstes im Auswärtigen Amt maßgeblich prägte.
Archivmaterial, das wissenschaftliche Werk dieser Personen und auch Gespräche mit Familienangehörigen einiger dieser Personen erlaubten mir unerwartete persönliche Begegnungen. Für die Bereitschaft, mir neben berufsbezogenen auch familiäre Einblicke ins Leben von Alexander Snyckers und Paul Gautier zu gewähren, danke ich Frau Anke Snyckers (Ehefrau eines Enkels von Alexander Snyckers) bzw. Frau Ursula Thiel (Nichte von Paul Gautier). Ihre Erlaubnis, Dokumente aus den Akten ihrer Familienarchive für meine Dissertation sowie Informationen aus unseren Gesprächen zu verwenden, haben das Bild der Entstehung der translatorischen Ausbildung abgerundet.
Jedes Projekt braucht vor allem eine Chance entstehen zu dürfen. Eine solche bekam ich von Herrn Prof. Dr. Peter A. Schmitt. Ich danke ihm in herzlicher Verbundenheit, dass er mich auf meiner Reise zu translatologischem Neuland begleitete, er offen dafür war, dass der ursprünglich geplante Themenfokus meiner Dissertation verlagert wurde, und er mir bei der Gestaltung meiner Dissertation freie Hand ließ. Dass er mir in den Jahren, in denen mein Dissertationsprojekt ruhte, die Treue gehalten hat, rechne ich ihm hoch an.
Herrn Prof. Dr. Carsten Sinner danke ich herzlich, dass er sich trotz des Umfangs meiner Dissertation bereit erklärte, als Gutachter zu fungieren. Auch für seine Unterstützung im Promotionsverfahren bin ich ihm aufrichtig verbunden.
Ein Geschenk waren auch die Begegnungen mit Herrn Prof. Dr. Hans Göschel und Herrn Prof. Dr. Eberhard Fleischmann, bei denen ich mich herzlich bedanke. Mit ihnen zusammen sind bei Archivarbeiten im Rahmen des 110. Jahrestages der Gründung der Handelshochschule Leipzig bzw. im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der translatorischen universitären Ausbildung in Leipzig Beiträge entstanden, die mein Dissertationsprojekt förderten. Über diese Publikationsmöglichkeiten habe ich mich sehr gefreut. Die angenehme Zusammenarbeit bleibt mir in guter Erinnerung.
Mein Dissertationsprojekt ging mit diversen Forschungsaufenthalten einher, die mich in verschiedene Archive und Bibliotheken führten. Hinzu kamen unzählige Anfragen bei diversen Behörden und Ämtern. Durch die Bemühungen vieler Personen, die an dieser Stelle nicht namentlich erwähnt werden, nahm mein Dissertationsprojekt immer mehr Gestalt an. Ich möchte diesen Personen daher von Herzen meinen Dank aussprechen, dass sie mir wohlwollend und hilfsbereit begegneten. Frau Petra Hesse und Frau Sandy Muhl vom Universitätsarchiv Leipzig, Herrn Dr. Wolfang Müller vom Universitätsarchiv des Saarlandes sowie Frau Petra Loeffler von der Universitätsbibliothek Leipzig und Frau Bett ina Keiber von der Stadtbibliothek Ulm möchte ich allerdings namentlich hervorheben.
Herrn Hans-Arno Mielsch danke ich für seinen Rat bei der Erstellung einer Datenbank für die statistische Auswertung curricularer Studien.
In der Endphase meines Dissertationsprojekts zog ich einen Mediengestalter hinzu. Für die angenehme Zusammenarbeit im gesamten Layoutprozess danke ich Herrn Jörg Adrion.
In liebevoller Verbundenheit möchte ich mich bei Frau Katja Fliedner, meiner Freundin aus der Schulzeit in Ulm, dafür bedanken, dass ich mich bei meinen unzähligen Aufenthalten in Leipzig, die im Rahmen meines Dissertationsprojekts notwendig waren, in ihrem Refugium in der Gott schedstraße zuhause fühlen durfte. Besonderer Dank gilt Frau Beke Schoustra, meiner Freundin aus der Studienzeit an der Universität Heidelberg, für die Übertragung der Texte aus dem Stadtarchiv Rott erdam vom Niederländischen ins Deutsche. Ohne sie wäre mir der Blick auf diesen Teil der Geschichte der translatorischen Ausbildung versperrt geblieben.
Frau Astrid Keller, meiner Freundin aus der Heidelberger Studienzeit, danke ich herzlich für das gründliche Lektorat vor der Drucklegung.
Für die fachkundige Begleitung im Publikationsprozess bedanke ich mich bei Herrn Michael Rücker, Lektor im Peter-Lang-Verlag. Über die Aufnahme meiner Arbeit in die Reihe Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie freue ich mich sehr.
In der Planungsphase meines Dissertationsprojekts wandte ich mich an diverse interne und externe Sprachendienste, vor allem in der Finanzwirtschaft , um praxisrelevantes Textmaterial zu sammeln. Dieses sollte für Untersuchungen zur Erstellung eines curricularen Konzeptes dienen. Aufgrund der Ergiebigkeit des Materials zur historischen Perspektive des ursprünglichen Th emas kam es zu keiner Auswertung des gesammelten Textmaterials. Ich möchte den Personen, die Texte zur Verfügung stellten, herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen danken. Mit ihrer Bereitschaft , Texte für wissenschaft liche Zwecke herauszugeben, haben sie ihr Interesse an bedarfsgerechten curricularen Anpassungen der translatorischen Ausbildung gezeigt. Ich hoffe, man sieht es mir nach, dass das Material im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zum Tragen kam.
Diese Zeilen des Dankes sind nicht vollständig, ohne an meine Eltern Erika und Willi Lutz zu erinnern. Ich bin dankbar für alles Gute, das ich von ihnen erfahren durft e, denn es bleibt. So wie auch sie in mir und mit mir verbunden bleiben.
Ulm, den 2. Januar 2024
Inhaltsverzeichnis
-
Skizzen zur Entstehung der translatorischen Ausbildung Entwicklungslinie A
2.2 Avantgarde der translatorischen Ausbildung in Deutschland
2.2.2 Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin – Wurzeln der translatorischen Ausbildung
2.2.2.1 Die Gründung des Seminars für Orientalische Sprachen (1887)
2.2.2.2 Das 25-jährige Jubiläum des Seminars für Orientalische Sprachen (1912)
2.2.2.3 Zur curricularen Entwicklung am Seminar für Orientalische Sprachen (1887–1912)
2.2.2.4 Nomen non est omen – Kritik am Namen des Seminars für Orientalische Sprachen
2.2.3 Der Streit über eine Deutsche Auslandshochschule (1913–1928)
2.2.3.1 Der Hintergrund einer langjährigen Reformdebatte (1908–1912)
2.2.3.2 Der Auftakt einer langjährigen Reformdebatte (1913–1914)
2.2.3.3 Das nationenwissenschaftliche Studium – Innenleben einer Deutschen Auslandshochschule
2.2.3.4 Der Erste Weltkrieg als Wegbereiter für die Völkerverständigung
2.2.3.5 Die Fortsetzung der Reformdebatte im Ersten Weltkrieg (1916)
2.2.3.6 Die Denkschrift über die Förderung der Auslandsstudien (1917)
2.2.3.7 Die Umsetzung der Forderungen aus der Denkschrift (1917–1920)
2.2.3.8 Ein Vorschlag zur Organisation der Deutschen Auslandshochschule (1920)
2.2.3.9 Die Reformdebatte vor dem veränderten politischen Hintergrund (1920–1923)
2.2.3.10 Die Denkschrift über die Reform des Seminars für Orientalische Sprachen in Berlin (1923)
2.2.3.11 Die Reaktionen und Gegenreaktionen auf die Reformpläne (1923–1924)
2.2.3.13 Die Akteure im Streit über die Deutsche Auslandshochschule
2.3 Von Dragomanen und Translatoren – Konturen eines entstehenden Berufsbildes
Skizzen zur Entstehung der translatorischen Ausbildung Entwicklungslinie B
2.4 Handelshochschulen – Geburtsstätten der translatorischen Ausbildung
-
2.5.2 Fremdsprachen als integraler Bestandteil der kaufmännischen Ausbildung (12.–19. Jh.)
2.5.3 Zum Fremdsprachenunterricht im kaufmännischen Bildungswesen (1898–1914)
2.5.4 Zum Fremdsprachenunterricht im kaufmännischen Bildungswesen (1920–1930)
2.5.5 Zum Fremdsprachenunterricht im kaufmännischen Bildungswesen (1928–1938)
2.5.6 Zur Sprachforschung an Handelshochschulen
2.5.6.1 Kampagne für einen neuen Forschungszweig – Zur Wirtschafts-Linguistik (1932)
2.5.6.2 Versuch einer wirtschaftslinguistischen Studie – Krejčís Werk (1932)
-
2.6 Die translatorische Ausbildung an der Handelshochschule Mannheim (1928–1933)
2.8 Die translatorische Ausbildung in der französischen Besatzungszone (1946–1949)
3 Schlussbetrachtung und Ausblick
Zur Entstehung der translatorischen Ausbildung – Ein Bild kommt zum Vorschein
3.1 Fokussierungen zur Entstehung der translatorischen Ausbildung
3.1.6 Phasen und Typen des Berufsprofils von Dolmetschern und Übersetzern
3.1.9 Zur Zielgruppe der translatorischen Ausbildung – Exkurs zum Terminus Dolmetscher
3.1.11 Institutionelle Metamorphose der translatorischen Ausbildung (1887–1945)
3.1.12 Zur internationalen Dimension des kaufmännischen Bildungswesens
3.1.16 Zur Wirtschaftslinguistik als frühe Form der Fachsprachenforschung
3.1.23 Vom curricularen Zwei-Komponenten-Modell zum Drei-Komponenten-Modell
Details
- Pages
- 846
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631937259
- ISBN (ePUB)
- 9783631937266
- ISBN (Hardcover)
- 9783631937242
- DOI
- 10.3726/b23097
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (July)
- Keywords
- Translatorische Curriculumforschung Fachgeschichte Translatologie Translationsdidaktik Translatologie Fachsprachenforschung Wirtschaftslinguistik Kulturelles Verständnis Nationenwissenschaft Handelshochschulen Dolmetscher-Institute Fremdsprachenunterricht
- Published
- Peter Lang – Berlin · Bruxelles · Chennai · Lausanne · New York · Oxford, 2025. 846 S., 18 Abb., 16 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG