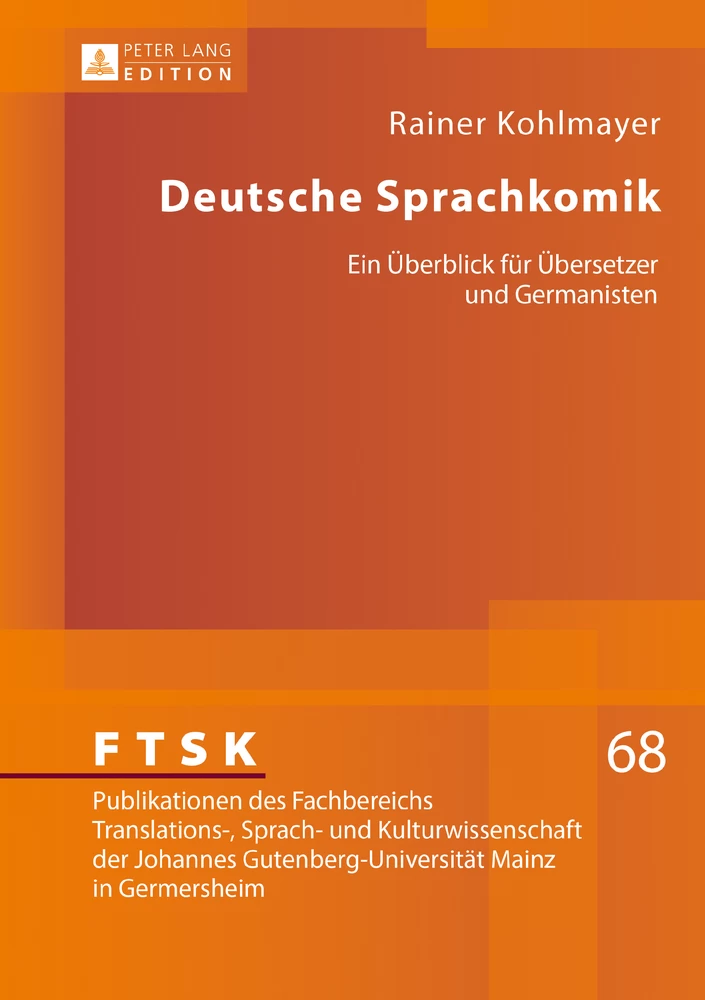Deutsche Sprachkomik
Ein Überblick für Übersetzer und Germanisten
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autoren-/Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Teil Einführung
- 1. Kapitel. Merkmale des Komischen im Überblick
- 2. Kapitel. Humorkompetenz als Ziel
- II. Teil Komik in deutscher Sprache und Kultur
- 3. Kapitel. Zum Komikpotential der hochdeutschen Sprache
- 3.1 Pun und Kalauer
- 3.2 Homonymenfurcht und -flucht im Deutschen
- 3.3 Stabilität der deutschen Wörter und Morpheme
- 3.3.1 Silben- und Morphemstruktur, Wortlänge
- 3.3.2 Knacklaut und Wortverschleifung
- 3.3.3 Fugenzeichen
- 3.3.4 Auslautverhärtung und ‚s‘-Laut
- 3.3.5 Eindeutigkeit als Ideal
- 4. Kapitel. Komikpotential unterhalb der Schriftsprache
- 4.1 Dialekte, Mundarten
- 4.2 Umgangssprache
- 4.3 Sprachmischung, Ethno-Comedy
- 4.4 Kindersprache und Sprachfehler
- 4.5 Paronomasie und spielerische Sprachverwendung
- 5. Kapitel. Muttersprachenpathos und Komödientradition
- 6. Kapitel. Arbeitsethos contra Komik
- 7. Kapitel. Zur Tradition des autoritären Staates in Deutschland
- III. Teil Höhepunkte deutscher Sprachkomik
- 8. Kapitel. Die deutsche Komiktradition im Überblick
- 8.1 Reineke Fuchs
- 8.2 Till Eulenspiegel
- 8.3 Heinrich Wittenwiler: Der Ring
- 8.4 Die Schildbürger
- 8.5 Gottfried August Bürger: Münchhausen
- 8.6 Heinrich Heine und Georg Büchner
- 8.7 Heinrich Hoffmann: Der Struwwelpeter
- 8.8 Wilhelm Busch
- 8.9 Johann Nepomuk Nestroy
- 8.10 Deutsches Kabarett
- 8.11 NS-Kritik in der Übersetzung: Ernst Sander
- 8.12 Loriot und Robert Gernhardt
- IV. Teil Komiktheorien im Überblick
- 9. Kapitel. Lachen und Komik als universale Phänomene
- 9.1 Evolutionäre Erklärungen des Lachens
- 9.2 Lachen als Kommunikation
- 9.3 Universalität des Komischen
- 10. Kapitel. Funktionale und strukturelle Komiktheorien
- 10.1 Die Münchhausiade der Abstraktion
- 10.2 Überlegenheitstheorie
- 10.3 Entlastungstheorie
- 10.4 Inkongruenztheorie
- 11. Kapitel. Lebensphilosophische Theorie: Henri Bergson
- 12. Kapitel. Psychoanalytische Theorie: Sigmund Freud
- 13. Kapitel. Soziologische Theorie: Anton C. Zijderveld
- 14. Kapitel. Linguistische Theorie: Raskin und Attardo
- 14.1 Script und Rahmen
- 14.2 Scriptüberlappung und Überlisten der Rezipienten
- 14.3 Raskins / Attardos Musterwitz
- 14.4 Kritische Anmerkungen
- V. Teil Sprachkomik (üb)ersetzen
- 15. Kapitel. Kommentierte Beispiele aus der Praxis der Komik(üb)ersetzung
- 15.1 Ein Wortspiel in Oscar Wildes An Ideal Husband
- 15.1.1 Voraussetzungen der literarischen Übersetzung
- 15.1.2 Voraussetzungen der Wildeschen Sprachkomik
- 15.1.3 Analyse des Originals
- 15.1.4 Übersetzung und Kommentar
- 15.2 Ronnie Barker: Doctor Spooner Revisited
- 15.2.1 Analyse des Originals
- 15.2.2 Übersetzungsprobleme
- 15.2.3 Übersetzung / Bearbeitung und Kommentar
- 15.3 Molière: Les femmes savantes / Die gelehrten Frauen
- 15.3.1 Zur Sprachkomik im Original
- 15.3.2 Übersetzungsprobleme
- 15.3.3 Übersetzung und Kommentar
- 15.4 Michael Flanders / Donald Swann: Edwardian Song
- 15.4.1 Inhalt tabu, Sprache brillant
- 15.4.2 Analyse des Originals
- 15.4.3 Übersetzungsprobleme
- 15.4.4 Übersetzung und Kommentar
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Das vorliegende Buch geht auf eine Vorlesung zurück, die ich in Germersheim mehrmals vor deutschen und ausländischen Studierenden der Germanistik und Übersetzungswissenschaft gehalten habe. Das merkt man dem Text hoffentlich noch an – im eher persönlichen Ton, in der Suche nach Verständlichkeit, in der Außenperspektive, in den vielen Beispielen, die das Interesse des jungen Publikums zu erhalten versuchten.
Soweit ich sehe, gibt es auf dem Büchermarkt keinen vergleichbaren Überblick über die deutsche Sprache und Kultur unter dem Aspekt der Komik und ihrer Übersetzung. Aber ich habe natürlich sehr viel aus der Lektüre anderer Forscher gelernt, wie das Literaturverzeichnis andeutet. Bei vielen literarischen Quellen zitiere ich – dem studentischen Budget zuliebe – lieber aus den erschwinglichen Ausgaben der Reclam UB.
Im Grunde kann kein Lehrer seinen Studenten etwas Besseres beibringen als die Lust zum Selberdenken und Selbermachen. In der Zeit der Modularisierung und Digitalisierung sind die wissenschaftlichen Tugenden der Kritik und der Fantasie vielleicht etwas in den Hintergrund geraten. Von Fröhlicher Wissenschaft ganz zu schweigen. Wenn Wissenschaftler die Komik mit terminologischem Purismus und in germanistischer Forschungsberichtsprosa in Angriff nehmen, vergeht den Lesern das Lachen. Ein kleiner Vorteil des Buches ist vielleicht, dass ich an der Uni zahlreiche Komödien übersetzt und inszeniert habe, die inzwischen an vielen deutschsprachigen Bühnen gespielt wurden. Mein Buch möchte jedenfalls Lust machen auf die deutsche Komiktradition und auf das Nachdenken darüber. Nach dem Lesen des Buches sollten die Leserinnen und Leser das Phänomen Komik besser verstehen und gelernt haben, wie eine Übersetzung komischer Texte gelingen kann.
Mein Buch will in das Thema einführen, einen historischen und theoretischen Überblick verschaffen und auch das Übersetzen komischer Texte demonstrieren. Es wendet sich zwar in erster Linie an Studierende, aber ich glaube, dass auch Germanistische Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland manche Anregung finden können, ganz abgesehen von der Übersetzerzunft, der ich mich praktisch und theoretisch zugehörig fühle. Beim Literaturübersetzen entstehen schöne synergetische Effekte, wenn Theorie und Praxis Hand in Hand gehen, was derzeit selten ist, weil Theoretiker selten zu Fuß gehen (Kohlmayer 2014a).
– Die beiden Einführungs-Kapitel geben einen Überblick über die Merkmale des Komischen und erläutern das Ziel des Buches: Humorkompetenz. ← 11 | 12 →
– Im zweiten Teil werden das Komik-Potential der deutschen Sprache und die Komikbereitschaft der deutschen Kultur untersucht.
– Der dritte Teil gibt einen Überblick über die deutsche Komiktradition vom Mittelalter bis in die Gegenwart.
– Im vierten Teil werden die wichtigsten Komiktheorien unserer Zeit vorgestellt und kritisiert.
– Im fünften Teil werden vier schwierige Beispiele der Übersetzung von Komik selbstkritisch besprochen, wobei ich auf meine eigene Praxis und mein Nachdenken darüber zurückgreifen kann.
Ich gebe gerne zu, dass das Beste an meinem Buch die Beispiele sind. Es gibt wahrscheinlich kein anderes Thema der Germanistik und der Übersetzungswissenschaft, bei dem die ideale rhetorische Mischung aus docere und delectare, aus Unterricht und Spaß an der Sache so gut gelingen kann. Ich denke mit Vergnügen an meine Komik-Seminare in Germersheim zurück, aber ich erinnere mich auch noch gerne an das Oberseminar über Minneparodien im Späten Mittelalter an der Uni in Mainz, wo ich bei Walter Johannes Schröder schmunzelnd und übersetzend erfuhr, dass komische Texte ein wunderbares Mittel sind, um tief in eine Sprache und Kultur einzutauchen.
Ich danke meiner philosophischen Kollegin Dr. Annett Jubara für die kritische Lektüre der vorletzten Fassung des Buches und Professor Dr. Klaus Pörtl für die Aufnahme in die FTSK-Reihe. Und ich würde mich über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge aus aller Welt freuen.
Rainer Kohlmayer, Lauterbourg, Ende August 2017
www.rainer-kohlmayer.de
Abstract: Chapter 1 lists up and describes the main characteristics of verbal humour. Chapter 2 goes on to define the meaning of humour competence, the teaching and acquisition of which is the declared aim of this book.
1. Kapitel. Merkmale des Komischen im Überblick
Abstract: The introductory chapter discusses the semiotic minimum of a humorous event: somebody produces humour for somebody else in a given situation. The German translators of Shakespeare (Wieland, Schlegel) were the first scholars to discover the incompatibilities of humour between languages and cultures. Eleven characteristics of verbal humour are listed up and described.
Wenn ich mir zu Beginn der Vorlesung eine rote Clownsnase aufgesetzt hätte, dann hätten manche gesagt, das sei komisch, ich sähe komisch aus; andere hätten mich für bescheuert erklärt; andere wären vielleicht davongelaufen. Als DER SPIEGEL Nr. 8 vom 19. Februar 1996 wieder einmal die beliebte Frage stellte „Wie komisch sind die Deutschen?“, verpasste er auf dem Titelbild etwa zwei Dutzend bekannten deutschen Gesichtern (von Goethe über Bismarck und Hitler bis zu Grass und Reich-Ranicki) dieselbe rote Pappnase, was durchaus amüsant, ja komisch wirkte. Welche Elemente sind also an einem solchen komischen Event beteiligt?
– Es gibt einmal ein Produkt, ein Objekt, das als komisch angesehen werden kann; es gibt folglich auch einen Komikproduzenten;
– es gibt zweitens einen oder mehrere Rezipienten, die etwas als komisch ansehen und deshalb schmunzeln oder lachen;
– es gibt drittens ein Medium, einen Kontext, eine Situation, in der das komische Phänomen auftaucht.
Zur Komik gehören also mindestens drei Voraussetzungen: etwas Komisches (als Anlass oder Auslöser), ein Komik-Rezipient (als Zuschauer, Hörer oder Leser), ein Kontext (als durch Ort und Zeit usw. bestimmte Situation). Schematisch kann man das auf eine Minimalformel bringen:
P produziert Komik für R in der Situation S.
Wir können also an verschiedenen Punkten ansetzen, um über Komik zu sprechen:
Details
- Pages
- 210
- Publication Year
- 2017
- ISBN (Hardcover)
- 9783631738436
- ISBN (PDF)
- 9783631738467
- ISBN (ePUB)
- 9783631738474
- ISBN (MOBI)
- 9783631738481
- DOI
- 10.3726/b12542
- Language
- German
- Publication date
- 2018 (May)
- Keywords
- Humorkompetenz Literaturübersetzungen Anarchismus Satire Komiktheorien Theater
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 210 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG