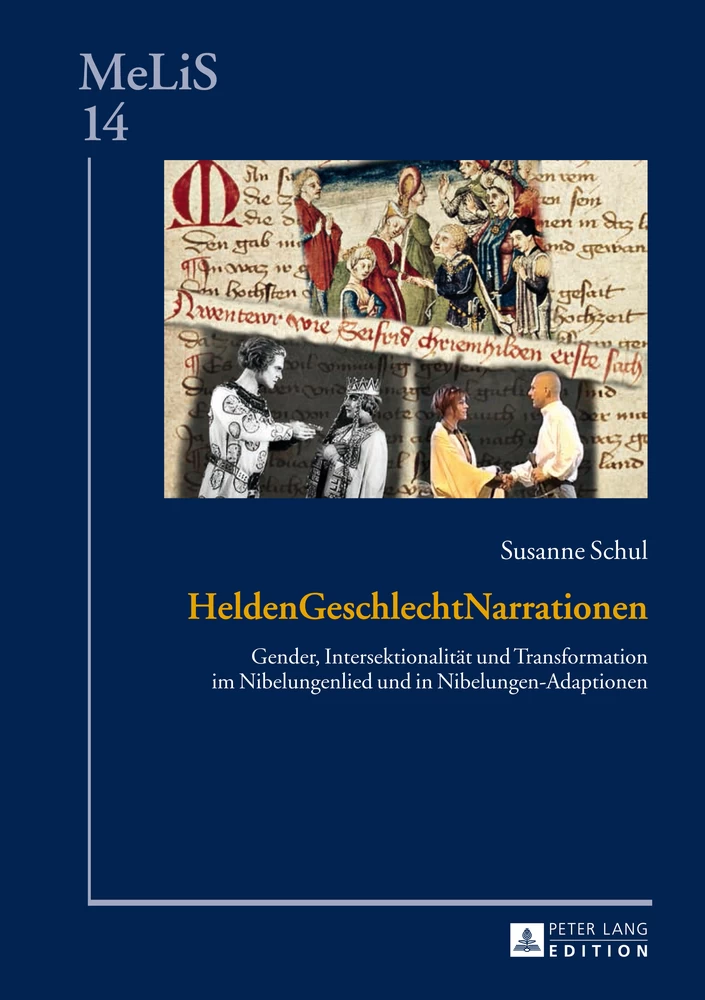HeldenGeschlechtNarrationen
Gender, Intersektionalität und Transformation im Nibelungenlied und in Nibelungen-Adaptionen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: HeldenGeschlechtNarrationen
- 1.1 Vorhaben und Vorgehen
- 1.2 Forschungsstand
- 2. Genderfokus: Eine medienkomparative Analyse von ‚Geschlecht‘, Intersektionalität und Narration
- 2.1 Genderkonstruktionen: Theoretische Perspektivierung
- 2.2 Gendernarrationen: Methodische Vorgehensweise
- 2.3 Gendertransformationen: Kulturhistorische Ausrichtung
- 3. Gendertranspositionen: Mediale Vermittlungsformen im Nibelungenlied und in Nibelungen-Adaptionen
- 3.1 Vom Wieder- und Weitererzählen im mittelalterlichen Text: Das Nibelungenlied und Die Klage
- 3.2 Der Dolmetscher des Nibelungen-Epos? Friedrich Hebbels Die Nibelungen
- 3.3 Schwarz-weiß-(Ge)Sehen (werden): Fritz Langs Die Nibelungen
- 3.4 Theaterfernsehen – Fernsehtheater: Moritz Rinkes Die Nibelungen
- 4. Gendervarianzen: Mittelalterliche und neuzeitliche Gendernarrationen im Vergleich
- 4.1 âne mâzen schoene so was ir edel lîp: Schönheitspreis und Statusbestimmung ambivalenter Weiblichkeit
- 4.1.1 Inter- und Intragenderrelationen der narrativen Verkörperung ‚schöner‘ Weiblichkeit
- 4.1.2 ‚Fremdes Begehren‘ − Der Tausch begehrenswerter Weiblichkeit als männliche Bündnisstrategie
- 4.2 von küener recken striten muget ir nu wunder hoeren sagen: Narrative Konstruktionen männlicher Heldenhaftigkeit
- 4.2.1 Heldenverkörperung als Differenzmuster ‚ungleicher‘ Männlichkeit
- 4.2.2 Normtransgressive Männlichkeit in metadiegetischen Gendernarrationen
- 4.3 Waz half sîn grôziu sterke unt ouch sîn grôziu kraft: (Re-)Präsentationen genderspezifischer Gewaltnarrative
- 4.3.1 Substitution männlicher Stärke zur Regulierung weiblicher Überlegenheit und weibliche Sprachgewalt im Intragenderkonflikt
- 4.3.2 Gewalt-Eskalationen – Be- und Verurteilung weiblicher Gewalttätigkeit
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
- 6.1 Abkürzungen
- 6.2 Handbücher, Kommentare, Lexika, Bibliographien, Wörterbücher
- 6.3 Primärliteratur, Primärmedien und zeitgenössische Quellentexte
- 6.4 Sekundärliteratur
- Reihenübersicht
← 8 | 9 → 1 Einleitung: HeldenGeschlechtNarrationen
Für wunder sol manz immer sagen
daz sô vil helede wart erslagen
von eines wîbes zorne.1
In der vorliegenden Untersuchung werden kulturhistorisch differente Bearbeitungen des Nibelungen-Stoffs vom Mittelalter bis zur Gegenwart einander vergleichend gegenübergestellt, um eine Verhältnisbestimmung von gender und Narration zu präzisieren.2 Hierbei stehen die Fragen im Zentrum, wie sich erstens gender- und medienspezifische Herstellungsund Darstellungsprozesse gegenseitig beeinflussen, welche Bedeutungen dabei zweitens intersektionale Differenzmarkierungen erhalten und welche Transformationen sich drittens im diachronen Vergleich der Bearbeitungen abzeichnen. Die Konstruktion der Geschlechterentwürfe wird im Folgenden in einem Interdependenzverhältnis zu ihrer jeweiligen medialen Darstellungsform betrachtet, da diese nicht nur gesellschaftliche Vorstellungen davon repräsentiert und reflektiert, was unter Weiblichkeit und Männlichkeit in einem bestimmten kulturhistorischen Kontext verstanden wurde, sondern diese stattdessen in einem fiktionalen Möglichkeitsraum auch selbst produziert. Da sich hierbei die Gestaltungs- und Herstellungsformen von ‚Geschlecht‘ und Narration überlagern, bietet eine Verbindung beider Ansätze eine produktive Perspektive, um die Nibelungenlied-Bearbeitungen vergleichend zu betrachten.3
Der Titel HeldenGeschlechtNarrationen ist dabei mehrdeutig angelegt, denn er eröffnet unterschiedliche Lesarten. Diese verweisen zum einen auf die Vielfältigkeit des Untersuchungsgegenstands und beziehen zum anderen die Überkreuzung der Analyseebenen ein.4 Bezug nehmend auf die bekannte Prologstrophe des Nibelungenliedes5 und auf das vorangestellte Zitat aus der Klage sollen einführend einige dieser Deutungsebenen aufgerufen ← 9 | 10 → werden. Die erste Lesart bezieht sich auf das Heldengeschlecht,6 das in der Prologstrophe der Nibelungenlied-Handschriften A und C als gattungsdeterminierende Bezugsgruppe heldenepischer Narration hervorgehoben wird. Es umfasst als generationenübergreifender Verband eine Reihe prädestinierter Handlungsträger (helden lobebaeren7), deren außergewöhnliche Taten berichtenswert erscheinen. Diese sind in einen narrativen Prozess eingebunden (von küener recken strîten muget ir nu wunder hoeren sagen8), also in eine Heldengeschlecht-Narration, die dazu beiträgt, ihre Tatkraft im Kampf zu markieren und sie durch deren narrative Wiederholung in ihrer machtvollen Dominanz immer wieder hervorzubringen und zu bestätigen. Die Rezeptionserwartungen, die sich demzufolge mit Heldengeschlecht-Narrationen verbinden, knüpfen sich in der Regel an eine gattungsbestimmende Mentalität männlicher Gewaltfähigkeit.9 Diese zunächst eindeutig erscheinende Erwartungshaltung, die sich an die Gattung Heldenepos bindet, stellt jedoch sowohl der epische Text wiederholt in Frage als auch seine neuzeitlichen Bearbeitungen.10 Denn wie das einführende Zitat der Klage bereits verdeutlicht, sind es eben nicht die siegreich kämpfenden, männlichen Helden, die als das Außerordentliche dieser Helden-Narration in den Vordergrund treten, sondern eines wîbes zorne11 wird als der Auslöser einer Konfliktkonstellation in den Blick genommen, der den Untergang eben jener Helden heraufbeschwört.12 Von dieser normabweichenden weiblichen Handlungsfähigkeit, so der epische Erzähler der Klage, wird in Zukunft immer wieder berichtet werden: Für wunder sol manz immer sagen.13 Mit dieser zweiten Lesart rückt für die folgende Analyse der Nibelungenlied-Bearbeitungen die Frage ins Zentrum, wer denn nun eigentlich die Helden sind, von deren außergewöhnlichen Taten die Geschlecht(er)narration berichtet. Der Nibelungen-Stoff eröffnet nämlich, wie das Zitat zeigt, in diesem Zusammenhang Spielräume für eine mehrdeutige Konstruktion von Heldenhaftigkeit. Es erfolgt somit keine einseitige Bestätigung heldenepischer Motivensembles, sondern es werden Krisensituationen entworfen, in denen typisierte Darstellungsmuster durch normabweichende Geschlechterkonstellationen im fiktionalen Experimentierraum brüchig werden. Die Überlagerung unterschiedlicher Deutungsdimensionen von Helden, Geschlecht und Narrationen stellen in ihrer dritten Lesart somit den Bezug zu der hier vorliegenden medienkomparativen und diachronen Analyse her und sind wiederholt auf ihre jeweilige Ausgestaltung hin zu prüfen: Denn erstens lässt sich Heldenhaftigkeit als hyperbolisches und normüberschreitendes Verhalten nicht nur bei männlichen, sondern auch bei weiblichen Figuren feststellen, ← 10 | 11 → zweitens bezieht sich Geschlecht14 als eine grundlegend relevante Differenzkategorie sowohl auf soziale und kulturhistorische Kontexte als auch auf mediale Konstruktionen und drittens umfassen Narrationen15 differente mediale Herstellungsprozesse, die sich auf spezifische Weise mit eben jenen Geschlechterkonstruktionen verbinden. Diese Ambivalenz der narrativen Produktionen bestimmt nicht nur die mittelalterliche Rezeption,16 sondern auch die neuzeitlichen Nibelungenlied-Bearbeitungen,17 die die mehrdeutigen HeldenGeschlechtNarrationen aufgreifen, weitererzählen und ihnen aktualisierende Bedeutungen verleihen.18
Ob sich ein Vergleich zweier oder mehrerer Gegenstände, in diesem Fall der unterschiedlichen Nibelungenlied-Bearbeitungen über die Jahrhunderte hinweg, als anregend und vor allem als aussagekräftig erweist, hängt, so Peter V. Zima, von der gezielten Auswahl und der Verortung der Vergleichsparameter in einem gemeinsamen Diskurszusammenhang ab. Auf diese Weise greift ein Vergleich erst über den Rahmen pauschalisierender, binärer Wertungsstrukturen hinaus und ermöglicht eine kritische Analyse wiederkehrender Muster und Motive oder aber ihrer Transformationen. Zima sieht hierin das kreative Potential eines Vergleichs, der dann auch „ganz verschiedene Dinge“19 zu analysieren vermag:
Wir kennen alle den Einwand: ‚Das kann man nicht vergleichen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge‘. In solchen Fällen könnte die Antwort lauten: Gerade weil es sich um verschiedene Erscheinungen handelt, sollen sie verglichen werden, denn Identisches zu vergleichen, ist sinnlos. Ebenso sinnlos ist ein Vergleich zweier inkommensurabler Größen, die voneinander nicht abweichen können, weil sie sich nicht berühren.20
← 11 | 12 → Die Auswahl der medialen Nibelungenlied-Bearbeitungen bezieht sich dementsprechend auf die von Zima aufgerufenen Kriterien komparativer Untersuchungen, nämlich darauf „verschiedene Erscheinungen“21 zueinander ins Verhältnis zu setzen, die aber durch bestimmte Berührungspunkte miteinander verbunden sind. Die Problematik der Auswahl liegt in diesem Zusammenhang allerdings in der Vielfalt der produktiven Bearbeitungen des Nibelungen-Stoffs, da besonders seit der Wiederentdeckung der drei Haupthandschriften im späten 18. Jahrhundert nicht nur ein reges Forschungs-, sondern ein mindestens ebenso reges produktives Rezeptionsinteresse einsetzt, das in unterschiedlichsten medialen Ausprägung bis in die Gegenwart zu beobachten ist.22 Die Fülle der Möglichkeiten einer vergleichenden Gegenüberstellung spiegelt sich bspw. in den mehr als dreißig Dramatisierungen des Nibelungen-Stoffs wider, die allein das 19. Jahrhundert verzeichnet. Die Auswahl der Bearbeitungen folgt aus diesem Grund zwei Kriterien: Zum einen mussten die neuzeitlichen Bearbeitung einen deutlichen inhaltlich-handlungsbezogenen Bezug zum mittelhochdeutschen Epos aufweisen, das den Ausgangspunkt der vorliegenden mediävistisch ausgerichteten Analyse bildet. Dieses Kriterium trifft allerdings bereits auf eine ganze Reihe der Dramatisierungen des 19. Jahrhunderts wie der filmischen und theatralen Adaptionen des 20. und 21. Jahrhunderts nicht zu, da sich diese in der Regel vor allem an der nordischen Sagenüberlieferung des Nibelungen-Stoffs orientieren, der im beträchtlichen Maß vom mittelhochdeutschen Epos abweicht.23 Eine eindeutige Bezugnahme zum Nibelungenlied als ihrer jeweiligen ‚(Haupt-)Quelle‘ der Stoffadaption weisen demzufolge alle drei gewählten Bearbeitungen aus und eröffnen gleichzeitig einen weiten Spielraum für die produktive Auseinandersetzung mit diesem ‚Quellenbestand‘. Bei diesem Modell einer produktiven Mittelalterrezeption in Form eines Stofftransfers handelt es sich aber nicht um simple Formen der Übernahme, Aneignung und Übertragung, die sich in synchroner Hinsicht zwischen zwei unterschiedlichen Kultur- und Sprachräumen vollziehen. Sie stellen vielmehr in diachroner Hinsicht ein komplexes Geflecht und einen mehrdimensionalen Möglichkeitsraum von gesellschaftlichen, kulturellen und medialen Interaktionen dar, in denen Transformationen auf unterschiedlichen Ebenen eine entscheidende Rolle spielen. Für das zweite Auswahlkriterium rückt demzufolge auch die diachrone und medienkomparative Ausrichtung der vorliegenden Untersuchung in den Vordergrund, so dass die gewählten Bearbeitungen zum einen exemplarisch für den jeweiligen kulturhistorischen Kontext stehen und zum anderen die zentralen medialen Transformationen einer ‚nibelungischen‘ Rezeptionsgeschichte repräsentieren sollten.24 Dementsprechend bilden die ausgewählten Bearbeitungen sowohl eine kulturhistorische als auch eine medienspezifische Bandbreite ab. Auf diese Weise werden Peter V. Zima folgend zwar sehr „verschiedene Erscheinungen“25 des Nibelungen-Stoffs zueinander ins Verhältnis gesetzt, die Bearbeitungen erhalten ← 12 | 13 → jedoch durch den Rückbezug auf eine gemeinsame Stofftradition und durch den ausgewählten Genderfokus Berührungspunkte, an denen eine komparative Verhältnisbestimmung zielgerichtet ansetzen kann.26
Den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden die handschriftlichen Überlieferungen des mittelhochdeutschen Nibelungenliedes von ca. 1180 bis 1210 eines anonymen Dichters.27 Sie sind bereits als variantenreiche, produktive Rezeptionen eines ‚unfesten‘ Stoffreservoirs zu betrachten,28 die in mehreren, parallel existierenden Textfassungen erscheinen und zum Teil erheblich voneinander abweichen.29 In fast allen vollständigen Handschriften folgt auf das Nibelungenlied die ebenfalls anonyme Klage, die als eine kommentierende und moralisierende Rezeption und als eine ‚Fortsetzung‘ des epischen Textes betrachtet werden kann. Die Variationen der Textfassungen und die aus ihnen resultierenden differenten Darstellungsformen genderbezogener Relationierungen werden exemplarisch in die folgende Analyse einbezogen.30 Von Beginn an ist die Rezeption des Nibelungenliedes also bereits durch einen produktiven Prozess des Umdeutens begleitet, in dem der Stoff durch zeit- und kulturspezifische Bearbeitungen fortgeschrieben wird, und dieser Prozess setzt sich bis in die ← 13 | 14 → Gegenwart fort.31 Dementsprechend werden den mittelhochdeutschen Texten drei ausgewählte neuzeitliche Nibelungenlied-Bearbeitungen vergleichend gegenübergestellt, die die produktiven Tendenzen der Aktualisierung ebenfalls in ihrer je eigenen Art widerspiegeln. Zum einen der dramatische Text Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei Abteilungen von Friedrich Hebbel32 von 1860, zum anderen die Stummfilmadaption Die Nibelungen von Fritz Lang33 von 1924 und außerdem die dramatische Bearbeitung Die Nibelungen von Moritz Rinke,34 die in einer fernsehtheatralen Inszenierung der Wormser Nibelungen-Festspiele von 2002 unter der Regie von Dieter Wedel ausgestaltet wurde.35
Das Potential eines solchen Vergleichs liegt darin, dass sowohl Kontinuitäten als auch Varianzen in einer weiten Zeitspanne vom Mittelalter bis zur Gegenwart in den Blick geraten, die auf unterschiedlichen Ebenen die Transformationen hervortreten lassen. Diese können formal in unterschiedlicher Weise und strukturell auf unterschiedlichen Niveaus beschrieben und analysiert werden, so dass aus einer kulturhistorischen Perspektive heraus vielfältige Momente des Transformativen identifiziert werden können.Die vorliegende Untersuchung setzt dabei differente Darstellungsformen in dreierlei Hinsicht zueinander in Beziehung: Erstens werden die Bearbeitungen in ihrer medienspezifischen Komplexität jeweils als eigenständige Umsetzungen betrachtet, zweitens in einer komparativen Dynamik ‚dialogisch‘ aufeinander bezogen und drittens aus der Spezifik ihres historischen Kontextes heraus reflektiert.36
Gerade die neuzeitlichen und medienspezifischen Umgestaltungen, die die weiblichen und männlichen Helden des Nibelungenliedes im Verlauf ihrer Rezeptionsgeschichte erfahren haben, sind es, die die Rezeptionserwartungen der Gegenwart in Bezug auf die Geschlechterbilder nachhaltig prägen. Aus diesem Grund wird sich eine der zentralen Fragestellungen der Untersuchung darauf beziehen, welche Konstruktionen von ‚Geschlecht‘ das Mittelalter im Vergleich zur Neuzeit entwirft und wie sich die neuzeitlichen Geschlechterbilder vom 19. über das 20. hin zum 21. Jahrhundert wandeln. Die vergleichende Analyse umfasst dabei eine große Zeitspanne, die eine Einbindung der Bearbeitungen in ihren kulturhistorischen ← 14 | 15 → und medialen Kontext zur Voraussetzung für die komparative Ausrichtung macht.37 Über das Konzept der Gendernarrationen38 wendet sich die Untersuchung dabei dem Wechselverhältnis von ‚Geschlecht‘und Narration zu, das als Überlagerung von handlungsmotivischen, strukturellen und kulturhistorischen Konstruktionen verstanden wird. Der Blick richtet sich auf Überlagerungen und eine wechselseitige Beeinflussung von narrativen und genderbezogenen Dar- und Herstellungsprozessen.39 Während für die literarischen Texte eine sprachliche Verfasstheit im Zentrum steht, treten für die Film- und Fernsehadaptionen intermediale Zusammenhänge von Sprache, Text sowie Bild- und Ton-Zeichensystemen in den Fokus. Die vorliegende Arbeit wird durch ausgewähltes Bildmaterial vervollständigt, das Screenshots aus Fritz Langs Die Nibelungen und aus der fernsehtheatralen Bearbeitung von Moritz Rinkes Die Nibelungen als Einzelbildeinstellungen präsentiert, um die Visualisierungsstrategien in ihren eigenständigen narrativen Strukturen ‚sichtbar‘ zu machen. Dieses Zitierverfahren von Einzelbildern reduziert zwar die Filmsequenzen der filmischen Bearbeitungen auf einige wenige Screenshots und verdichtet das eigentlich bewegte und audiovisuell gefasste Medienkonzept dabei allein auf seine visuelle Qualität, allerdings lässt sich auf diese Weise zumindest eine filmbildliche Annäherung an das narrative Verfahren ermöglichen und setzt seine andersgearteten Strategien der genre- und medienspezifischen Genderkonstruktionen in einen engen Bezug zu den textlich gefassten Nibelungen-Adaptionen.40 Hierbei steht die Frage im Zentrum, mit welchen narrativen Variationen die medialen Bearbeitungen die Geschlechterentwürfe ausgestalten und welche kulturhistorischen Transformationen durch eine komparative Analyse ‚sichtbar‘ werden. Angesiedelt ist die vorliegende Untersuchung deshalb im Umfeld einer transgenerischen und intermedialen Forschungsausrichtung der Narratologie und richtet ihre Aufmerksamkeit auf die historische und mediale Gebundenheit differenter Stoffadaptionen.41 Die Bearbeitungen können dabeigesellschaftliche Geschlechterdiskurse als „Repräsentationen von kulturellen Regelsystemen“42 in den fiktionalen Konstruktionen ver- und bearbeiten, sie greifen allerdings auch über typisierte Geschlechternormen hinaus. Sie lassen sich demzufolge nicht auf ein Abbildungs- und Reflexionsverhältnis hin reduzieren, sondern können gesellschaftliche und kulturelle Diskurse umdeuten, abstrahieren oder konkretisieren, so dass sie eigene, ← 15 | 16 → narrationsinhärente Normen und Strukturen hervorbringen, deren Bestimmung und Gestaltung im Folgenden von besonderem Interesse ist.43
Die vorliegende Untersuchung wurde hierfür in drei Teile gegliedert, die jeweils unterschiedliche Schwerpunktsetzungen verfolgen: Das Kapitel Genderfokus (2)umfasst die theoretische, methodische und kulturwissenschaftliche Verortung der folgenden Analyse. Zuerst wird diese unter dem Stichwort Genderkonstruktionen (2.1) in die aktuellen Forschungsfragen der literatur- und medienwissenschaftlichen Gender Studies, ihre theoretischen Prämissen, Konzepte und Analysekategorien eingeordnet. Diese werden um die sozialwissenschaftlich dominierten Debatten zur Wechselwirkung unterschiedlicher Differenzkategorien erweitert. Hierfür erweist sich der aus der Soziologie stammende Ansatz der Intersektionalität als besonders geeignet, da er sich explizit mit der Frage der Überlagerung von Differenzmarkierungen auseinandersetzt.44 Besonders die methodische Prämisse einer Mehrebenenanalyse, wie sie Nina Delege und Gabriele Winker vorschlagen, wird als ein Analyseinstrument für die medienkomparative Untersuchung operationalisiert.45 Unter dem Begriff der Gendernarrationen (2.2) wird die methodische Vorgehensweise dieser medienkomparativen Analyse präzisiert und sie wird in die Forschungsausrichtung einer feministischen und genderorientierten Narratologie eingebunden. Dabei überlagern sich kulturhistorisch-theoretische und formalistisch-strukturalistische Forschungsausrichtungen, um sich der Pluralität und Historizität der medialen Vermittlungsformen der Gendernarrationen anzunähern. Der thematische Schwerpunkt der Gendertransformationen (2.3) widmet sich der kulturhistorischen Ausrichtung der Untersuchung. Die narrativen Geschlechterkonstruktionen werden in ihren kulturhistorischen Kontext eingebettet und es werden exemplarisch zeitspezifische Geschlechterdiskurse herausgegriffen, die es erlauben, wiederkehrende Muster und Motive in ihrer fiktionalen Überformung zu erkennen und zu hinterfragen.
Das Kapitel Gendertranspositionen (3) wendet sich den medialen Übertragungs- und Vermittlungsformen der jeweiligen Nibelungenlied-Bearbeitungen zu und fragt nach den spezifischen Dar- und Herstellungsformen von narrativen Geschlechterkonstruktionen, die sich aus der medialen Gebundenheit der Stoffadaptionen ergeben. Es widmet sich den Übertragungs- und Verschiebungsvorgängen, die sich mit einem Medien- und Gattungswechsel verbinden, und ordnet die Bearbeitung in ihren jeweiligen Produktions- und Rezeptionszusammenhang ein.
Das Kapitel Gendervarianzen (4)umfasst die thematisch untergliederten Einzelanalysen, die sich ausgewählten Phänomenen der fiktionalen Geschlechterkonstruktionen im Vergleich ihrer narrativen Ausgestaltung zuwenden. Im Handlungsgeschehen können Geschlechterrelationen über das interaktionstheoretische Konzept des doing gender und doing difference in den Blick genommen werden, der einer performativen Ausrichtung folgend ein ← 16 | 17 → kontinuierliches (Re-)Produzieren von Geschlechternormen im Handeln der Figuren fokussiert.46 Zum einen treten dabei normtransgressive Handlungsmuster und ihre jeweiligen Bewertungen auf Figuren- und Erzählerebene in den Fokus, zum anderen verweisen diese allerdings auch auf Vorstellungen von Regelhaftigkeit, die durch die Abweichungen erst konturiert werden.47 Hierbei werden die medialen Geschlechterkonstellationen auf die Gestaltung und Übernahme von genderspezifischen Verhaltensformen, Machtverhältnissen, Gewaltfähig- und Gewalttätigkeiten hin untersucht und die (De-)Konstruktion inter- und intrageschlechtlicher Hierarchisierung vergleichend gegenübergestellt.48
Die germanistische Forschung zum mittelhochdeutschen Nibelungenlied umfasst eine fast unüberschaubare Fülle von Untersuchungen, die sich mit unterschiedlichsten Aspekten des Werkes auseinandersetzen.49 Die fast zweihundertjährige Geschichte der literaturwissenschaftlichen Nibelungen-Forschung kann aus wissenschaftskritischer Perspektive hierbei als methodischer und motivischer ‚Spiegel‘ einer Fachhistorie gelesen werden,50 denn die über die Zeiten hinweg jeweils maßgebenden literaturwissenschaftlichen Interessen und Methoden wurden und werden immer wieder neu an den epischen Text herangetragen und auf ihre jeweilige Tragfähigkeit hin geprüft.51 Die Dichte der Untersuchungen und die Vielzahl der Fragestellungen verdeutlichen einerseits die Komplexität und Vielfältigkeit des epischen Textes und fordern andererseits eine genaue Eingrenzung der im Folgenden zu thematisierenden Gegenstände ein. Der Forschungsbericht wird sich deshalb ganz bewusst nur auf ← 17 | 18 → genderorientierte52 und medienkomparative53 Untersuchungen zum Nibelungenlied und zu den neuzeitlichen Nibelungenlied-Bearbeitungen konzentrieren, die für die folgende Analyse maßgeblich sind.
Die Frauen- und Geschlechterforschung hat auch in der mediävistischen Literaturwissenschaft ein breites Spektrum kulturwissenschaftlicher Forschungsfragen zu verzeichnen, die die Sicht auf die Literatur des Mittelalters erweitert und den interdisziplinären Austausch gefördert haben. Die genderbezogenen Analysen zum Nibelungenlied richten sich zunächst, dem Interesse der feministischen Literaturwissenschaft folgend, auf die literarische Gestaltung der Frauenfiguren,54 öffnen sich allerdings in jüngerer und jüngster Zeit bereits für Analysen von Männlichkeitskonstruktionen55 und relationalen Geschlechterbeziehungen.56 ← 18 | 19 → Einen Einblick in die spezifischen Fragestellungen der literaturwissenschaftlichen und mediävistischen Gender Studies ermöglichen die Arbeiten von Ingrid Bennewitz,57 die eine kritische Auseinandersetzung mit feministischen und genderorientierten Analysekonzepten für die mediävistische Literaturwissenschaft mit angestoßen hat. Sie bietet eine differenzierte Diskussion der Chancen einer Interpretation des Nibelungenliedes und anderer mittelhochdeutscher Texte aus frauen- und geschlechtergeschichtlicher Perspektive an und fragt nach der Anwendbarkeit gendertheoretischer Ansätze auf mittelalterliche Texte. Für das Nibelungenlied treten vor allem Analysen in den Vordergrund, die sich weiblichen Gesprächsformen, weiblichen Handlungsspielräumen in einer nach männlichen ‚Spielregeln‘ organisierten Gesellschaftsordnung oder narrativen Konzeptionen von Körper und Geschlecht zuwenden.58
Diesem Analyseschwerpunkt, der die Darstellungsformen von Körperlichkeit mittelalterlicher Texte in den Blick nimmt und enge Verbindungen zu Geschlechterrollen herstellt, widmet sich auch Monika Schausten,59 die in ihrer Studie zu Inszenierungsformen von ← 19 | 20 → Körperlichkeit, Sexualität und ‚Geschlecht‘ nach deren narrativen Funktionen im epischen Erzählen fragt. Ihrer These folgend werden die im epischen Text thematisierten politischen Machtfragen über das Motiv des Kampfs der Geschlechter literarisch vermittelt, der sowohl dem weiblichem als auch dem männlichen Körper physische Kraft zuspricht, und über diese eine Beteiligung am politischen Geschehen ermöglicht.60 Diese Lesart ergänzend und erweiternd analysiert Tilo Renz61 in seiner Dissertation das Nibelungenlied aus wissenspoetologischer Perspektive. Seine Arbeit fragt auf einer synchronen Ebene nach dem Verhältnis der Geschlechter in der nibelungischen Welt vor dem Hintergrund unterschiedlicher historisch-zeitgenössischer Wissensgebiete. Hierbei verfolgt er Korrespondenzen des literarischen Textes mit medizinischer und naturphilosophischer Fachliteratur sowie mit juristisch-normativen Schriften, die im 12. und frühen 13. Jahrhundert entstanden sind. Durch die vergleichende Betrachtung des epischen Textes mit unterschiedlichen Quellenzeugnissen und mit Hilfe von Close Readings werden Übereinstimmungen und Differenzen hinsichtlich Themen, Denkfiguren und Problemkonstellationen sowie ihrer Darstellungsmodi herausgearbeitet. Tilo Renz greift dabei die theoretischen Auseinandersetzungen mit dem Verhältnis von Literatur und Wissen für die geschlechterspezifische Untersuchung auf. Bereits in seinem Aufsatz Brünhilds Kraft wendet er sich unter Einbezug von medizinischen Diskursen den literarischen Verfahren zur Herstellung von Brünhilds Körperkraft zu, die er in einem Wechselverhältnis von Normalität und Exorbitanz in das von Thomas Laqueur beschriebene Ein-Geschlecht-Modell eingliedert und dieses bezogen auf den epischen Text modifiziert.62 Auch Jerold C. Frakes63 nimmt in seiner Analyse die Frauenfiguren im epischen Text in den Blick und wendet sich, wenn auch nicht immer präzise zwischen fiktionalen Entwürfen und seiner Konzeption einer ‚historischen Realität‘ trennend, Konzepten von Heimlichkeit, Vertraulichkeit und ‚Privatheit‘ als Kommunikationsmöglichkeit für männliche und weibliche Figuren im Nibelungenlied zu. Hierbei treten als zentrale Motivkonstellationen der nibelungischen Gesellschaft, ähnlich wie bei Ingrid Bennewitz,64 Kommunikationsformen in den Vordergrund, die männliche Solidarität in Kontrast zu weiblicher Isolation setzen.
Die geschlechtsspezifischen Handlungsspielräume, die der epische Text entwirft, sind demzufolge ein zentrales Motiv genderorientierter Analysen. Hierbei stehen in der Regel die weiblichen Protagonisten des epischen Texts im Zentrum des Interesses: Elaine Tennant65 weist in ihrer Analyse darauf hin, dass weibliche Normtransgressionen im epischen Text aus männlicher Perspektive als eine ‚absichtliche‘ Adaption männlicher Handlungskonzeptionen und als ein Eindringen in eine männliche Handlungsdomäne verstanden werden ← 20 | 21 → können, die aus diesem Grund von den männlichen Protagonisten sanktioniert werden.66 Auch Katharina Freche67 untersucht in ihrer 1999 erschienen Dissertation zu Geschlechterkonstruktionen vergleichend die Darstellungsformen weiblicher Handlungsfähigkeit im Nibelungenlied und in nordischen Stoffvarianten der Nibelungen-Sage. In ihrer Arbeit ermittelt sie die für den jeweiligen Handlungsverlauf der verschiedenen Nibelungen-Texte die konstitutiven Geschlechterdiskurse, nimmt deren Kontextualisierung durch eine soziokulturelle sowie rechtliche Einbettungen vor und fragt nach gemeinsamen Stofftraditionen bzw. nach motivischen Transformationen der nibelungischen Texte. Hierbei legt sie dementsprechend eher einen rezeptionsorientierten Schwerpunkt und einer detailorientierten Textanalyse kommt ein eher geringer Stellenwert zu. Während Maren Jönsson68 in ihrer Dissertation nun allerdings dezidiert nach genderrelatierten Erzählstrategien des Nibelungenliedes fragt, die auf eine spezifische Ordnung der Geschlechter im Epos verweisen, stehen auch in ihrer Analyse erneut die Konzeptionen von Weiblichkeit im Zentrum.69 Besonders Abweichungen vom „schablonenhaften“70, stereotypisierten Idealbild sind für sie von Bedeutung und diese Abweichungen werden in Muster von verbale und nonverbale Verhaltensformen gegliedert. Jönsson verknüpft die Konflikte im Nibelungenlied mit Konzeptionen von macht- und standespolitischen Übertretungen einer adeligen Gesellschaftsordnung71 und bezieht in ihre Untersuchungen an einigen Stellen ergänzend die Klage in ihre Argumentation ein.
Einen zentralen Untersuchungsschwerpunkt feministischer und genderorientierter Forschung nimmt Elisabeth Lienert72 mit ihren Analysen zum Interdependenzverhältnis von Geschlecht, Körper und Gewalt in mittelhochdeutschen Texten und speziell im Nibelungenlied in den Blick. Hierbei richten sich ihre Fragen zunächst auf die epischen Handlungsmöglichkeiten von kriegerischer Weiblichkeit bzw. darauf, welche Verhaltensformen und Handlungsrollen weiblichen Figuren im Kampf und Krieg in literarischen Texten zugesprochen werden, um dann spezifische Formen der Gewalt von und gegen Frauen im Nibelungenlied zu untersuchen. Hierbei kann sie sowohl textinterne als auch textübergreifende Konzepte eines männlichen Gewaltmonopols, eines spezifischen Sprechens über Gewalt, ← 21 | 22 → Rechts- sowie Ehrendiskurse nachweisen.73 Während zunächst also erneut die Weiblichkeitsentwürfe auch bei Lienert im Fokus der Untersuchungen steht, richtet sie in ihrem Aufsatz Der Körper des Kriegers ihr Interesse auf männliche Körperinszenierungen in der Nibelungenklage und somit auf einen Kampfkörper, der selbst im Tod noch ‚aussagefähig‘ erscheint. Dieser Ausrichtung folgend werden nun zunehmend auch theoretische Perspektiven der Men’s Studies in den Forschungsdiskurs um die genderbezogenen Konstellationen in nibelungischen Texten einbezogen.74 Doch während sich Petra Frank75 in ihrer online veröffentlichten Dissertation von 2004 erneut dem Zusammenhang von (weiblichem) Geschlecht und Gewalt im Nibelungenlied zuwendet und die narrativ entworfenen Handlungsspielräume der Frauen-Figuren in der epischen Textstruktur analysiert, nähert sich Robert Scheuble76 mit einer ähnlichen thematischen Fragestellung, doch bezogen auf Männlichkeit und ihre spezifische Sozialisation, dem epischen Text im Vergleich zum Parzival Wolframs von Eschenbach an. Hiermit treten auch vermehrt Fragen nach einem spezifisch heldenepischen Erzählen und dessen Verhältnis zu Kategorie ‚Geschlecht‘ in den Fokus.
Auf einen konzeptionellen Zusammenhang und das Wechselverhältnis von gender und Genre in mittelalterlicher Literatur hat bereits der Romanist Simon Gaunt77 verwiesen und festgestellt, dass im Gegensatz zum roman courtois die männliche Identität in chansons de geste nicht relational zur Weiblichkeit, sondern ‚monologisch‘, d.h. unter Ausschluss der weiblichen Figuren aus einer intrageschlechtlichen Relationierung heraus konstruiert werde. Während die Vorstellungen einer idealen Männlichkeit und deren spezifisches Verhalten im französischsprachigen Äquivalent der Heldenepik vorgeführt und erprobt werden, treten die weiblichen Figuren in ihrem Handeln hinter den männlichen Helden zurück.78 Die Forschung zur deutschsprachigen Heldenepik hat sich kritisch mit Gaunts Thesen auseinandergesetzt und versucht diese in Bezug auf die spezifische Darstellung der weiblichen Figuren im Nibelungenlied, in der Klage und Kudrun zu hinterfragen.79 Hierbei wird erneut deutlich, dass Darstellungsverfahren von Geschlecht, Sexualität und Körperinszenierungen gattungs-, typen- und diskursabhängigen Konstruktionen unterliegen, wodurch sich generalisierende Bewertungen ausschließen und narrationsspezifische, komparative, intertextuelle und intermediale Analyseverfahren notwendig macht. Neuere Arbeiten der Mediävistik ← 22 | 23 → machen dementsprechend auch deutlich, dass die Fragestellungen nach gattungsgeschichtlichen Gliederungen und Typisierungen von Geschlechterkonstruktionen auf weitere mittelalterliche Texte übertragen werden könnten und gattungs- wie narrationsspezifische Konzeptionen für die Konstruktion von ‚Geschlecht‘ stärker fokussiert werden müssten. Dieser Ausrichtung folgt auch die vorliegende Untersuchung, allerdings mit einer diachronen Ausrichtung.80
Neben den ausdrücklich genderorientierten Forschungsarbeiten zum Nibelungenlied und zur Klage sind aber natürlich auch Jan-Dirk Müllers81 Nibelungen-Studien hervorzuheben, allen voran die Spielregeln für den Untergang, die zwar keinen dezidiert genderorientierten Untersuchungsfokus besitzen, aber zur interdisziplinären Öffnung und zu einer strukturorientierten wie historisch-kritischen Lektüre des epischen Textes beigetragen haben. Im Umgang mit den strukturellen und inhaltlichen Brüchen und Leerstellen des epischen Textes hat Müller auf eine spezifisch nibelungische „Kohärenzbildung“82 hingewiesen, so dass ← 23 | 24 → diese nicht mehr als erzähltechnische ‚Defekte‘ der Narration zu betrachten,83 sondern als spezifische „Offenheit“ der Kommunikation zwischen epischem Erzähler und den jeweiligen Rezipienten zu werten sei.84 Er bezieht wissenschaftliche Nachbardisziplinen, wie die Ethnologie und Ethnographie, in seine Analysen ein und verweist auf eine zunehmende kulturwissenschaftliche Öffnung ebenso wie auf den kritischen Einbezug sozialer und kultureller Kontexte, wobei er betont, dass die literarischen Texte durch eine „eigene Ordnung symbolischen Handelns“85 geprägt seien. Er unterscheidet einem kulturanthropologischen Ansatz folgend somit „Spielregeln des Erzählten“ und Spielregeln des anthropologischen Kontextes, die sich ähneln oder auch entsprechen können, jedoch nicht müssen, da der literarische Text eigene Möglichkeitsräume erzeugt, die Müller für das Nibelungenlied zu den Spielregeln zusammenführt, die schließlich in den Untergang einer ganzen Gesellschaft führen.86
Betrachtet man wissenschaftsgeschichtlich die Forschungen zum Nibelungenlied und zur Klage, so standen zunächst einmal vor allem Fragen der Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte ebenso wie die Frage nach der Datierung und der Autorschaft in Bezug auf die unterschiedlichen Fassungen der epischen Texte im Vordergrund und diese Themen begleiten die Nibelungen-Forschung auch über die Zeiten hinweg immer wieder. So zeigt sich dieser fortdauerende Interessenschwerpunkt auch gegenwärtig erneut in der Klage-Monographie von Joachim Bumke87 jedoch nicht unter einem hierarchisierenden Schwerpunkt, sondern unter dem Fokus der Gleichwertigkeit der Fassungen B und C der Klage, die in detaillierten synoptischen Vergleichen präsentiert werden.88 Die Klage wurde und wird in der Regel aus der Perspektive des Nibelungenliedes heraus gelesen, gedeutet und bewertet und wurde in ihrer eigenständigen Ästhetik, in narrativen Strukturen und Textkonzeptionen lange am Nibelungenlied gemessen.89 Neben Joachim Bumke versuchen sich vor allem zwei weitere Monographien von Angelika Günzburger90 und Monika Deck91 an einer übergreifenden ← 24 | 25 → Analyse der Klage, während in weiteren Forschungsbeträgen vor allem Einzelbeobachtungen zu Personendarstellungen,92 Motivkomplexen,93 Narrationsstrukturen94 oder zur Erzählerrolle95 im Vordergrund stehen. Aus genderorientierter Perspektive wenden sich vor allem Ingrid Bennewitz96 und Ann-Katrin Nolte97 der Frage nach einer ‚Schuldhaftigkeit‘ im Vergleich von Nibelungenlied und Klage zu und untersuchen besonders die Transformationen in der Bewertung der Rolle Kriemhilds im Untergangsgeschehen. Im Gegenzug wendet sich bspw. Claudia Brinker-von der Heyde98 der ebenfalls transformierten männlichen Perspektive in der Klage zu und untersucht Hagens Inszenierung als der ‚Alleinschuldige‘ ← 25 | 26 → am Untergangsgeschehen. Ann-Katrin Nolte stellt in ihrer 2004 erschienen Dissertation Spielregeln der Kriemhildfigur in der Rezeption des Nibelungenliedes darüber hinaus eine vergleichende Analyse der Kriemhild-Entwürfe vor. Ihre intertextuell vergleichende Analyse bezieht sich auf die mittelalterliche Nibelungen-Rezeption in den handschriftlichen Überlieferungen der Klage,der Kudrun und des Rosengarten zu Worms und bietet einen Ausblick auf ausgewählte neuzeitliche Rezeptionsbeispiele des Nibelungenliedes im 18., 19. und 20. Jahrhundert, die sowohl Friedrich Hebbels dramatischen Kriemhildentwurf als auch Thea von Harbous Nibelungen-Roman aufgreifen.99
Die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes ist in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen Forschungsschwerpunkt innerhalb der Nibelungen-Forschung geworden.100 Literatur, Film, Musik und bildende Kunst greifen den Stoff auf, so dass sich ein vielfältiges und weit reichendes Untersuchungsgebiet eröffnet.101 Die Formationen und die Transformationen des Nibelungen-Stoffs werden aus rezeptionsorientierter Forschungsperspektive auf unterschiedlichen Ebenen analysiert, die ausgehend von der hoch- und spätmittelalterlichen Rezeption bis hin zu den produktiven Bearbeitungen des Stoffs in der Neuzeit reichen.102 Die vielfältige Ausrichtung spiegelt sich bspw. in dem 2003 erschienenen und von Joachim Heinzle, Klaus Klein und Ute Obhof herausgegebenen Sammelband Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos103, der einen Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand der Rezeptionsgeschichte zum Nibelungenlied bieten möchte.104 Vor allem Ulrich Müllers105 Beitrag ist für die vorliegende Untersuchung von zentraler Bedeutung, denn er stellt in seinem Aufsatz zu Nibelungen-Adaptionen im 19. und 20. Jahrhundert eine gelungene Übersicht zur künstlerischen Rezeption der Nibelungen dar, die sich in kurzen Abschnitten sowohl Friedrich Hebbels dramatischer Adaption, Fritz Langs Nibelungen-Film und Moritz Rinkes Inszenierung zuwendet, dem Überblickscharakter entsprechend jedoch nur einzelne Besonderheiten der medialen Bearbeitungen anreißen kann. Eine detailierte vergleichende Analyse, ← 26 | 27 → wie sie die folgende Untersuchung bietet, liegt dementsprechend noch nicht vor, sondern es gibt vor allem Arbeiten, die sich im Detail einer speziellen produktiven Rezeption widmen. Überblickt man in diesem Zusammenhang die Ausrichtung der Hebbelforschung, so ist festzustellen, dass sich zwar eine ganze Reihe feministisch ausgerichteter und zum Teil auch genderorientierter Untersuchungen finden. Diese befassen sich allerdings in erster Linie mit der ‚Frau‘ in Hebbels Werk und analysieren weibliche Werte und Rechte in seinen dramatischen Texten. Mit Blick auf die soziokulturell eingeschränkte Rolle von Frauen in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und ihrem Streben nach Eigenbestimmtheit, die sich auch in den dramatischen Texten als Genderkonstellation finden, werden die männlichen Figuren der hebbel’schen Texte aus feministischer Perspektive vor allem als Aggressoren interpretiert, die die weiblichen Figuren in ihrem Bestreben nach Freiheit einschränken.106 Erst neuere Arbeiten versuchen diesen recht einseitigen Forschungstendenzen entgegenzuwirken und aus einer vergleichenden Perspektive heraus Geschlechterrelationen und Männlichkeitsentwürfen in Hebbels dramatischen Texten nachzuspüren. Dabei bezieht sich das Analyseinteresse aber vor allem auf Friedrich Hebbels bekannte Tragödien Judith, Genoveva und Maria Magdalena, während die Nibelungen eher im Hintergrund bleiben und oft nur ergänzend in die Betrachtungen einbezogen werden.107 Zwei Arbeiten sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben, die Überlegungen zu Gechlechterrelationen und Men’s Studies aufnehmen: Alexandra Tischel108 bietet eine genderspezifische Studie mit dem Titel Tragödie der Geschlechter, die sich mit tragischen Handlungsstrukturen und ihren relationalen Dynamiken in Hebbels dramatischen Texten befasst. Diese ergeben sich, der Autorin zufolge, vor allem aus der Inszenierung von Geschlechterdifferenzen. Tischel untersucht, inwieweit die Protagonistenpaare die dem jeweiligen Geschlecht angemessenen Handlungsspielräume in den Bereichen von Sexualität, romantischer Liebe und Ehe verhandeln. Sie versteht Hebbels tragische Kollision im Beziehungsraum verschiedengeschlechtlicher Protagonisten als eine ‚typisch moderne‘ Konfliktstellung, die sich auf die Diskussion um eine ‚Frauenemanzipation‘ und das Verhältnis der Geschlechter im 19. Jahrhundert beziehe. ← 27 | 28 → Barbara Hindinger109 lenkt mit ihrer Dissertation Tragische Helden mit verletzten Seelen die Aufmerksamkeit der Hebbelforschung hingegen auf die Chancen, die sich durch den Einbezug der Forschungsfragen der Men’s Studies für die Dramenanalyse eröffnen. Ihre Untersuchung befasst sich mit der Schuldfrage in Hebbels Dramentexten und fokussiert dabei die Männlichkeitsentwürfe in ihren soziokulturell konstruierten Rollen, die in den bisherigen Untersuchungen vernachlässigt werden. Die männlichen Figuren erscheinen in Hindingers Untersuchung nicht mehr als das ‚Universale‘, von dem sich ‚das Weibliche‘ als das ‚andere Geschlecht‘ abhebe, sondern sie selbst werden als spezifisch und partikular wahrgenommen. Beide Arbeiten öffnen den Blick der Hebbelforschung zwar hin zu einer genderrelationierten Untersuchungsperspektive, doch nehmen die Geschlechterinszenierungen in Hebbels Nibelungen auch bei diesen beiden Analysen nur einen geringen Raum ein.110
Ein steigendes Interesse an einer geschlechterorientierten Hebbelforschung zeigt sich aber auch im Konferenzband des 7. Internationalen Friedrich Hebbel-Symposions mit dem Titel Das Weib im Manne zieht ihn zum Weibe; der Mann im Weibe trotzt dem Mann,111 der die neusten Tendenzen einer literaturwissenschaftlichen Geschlechterforschung aufgreift. Zentrale Fragestellungen der Gender Studies werden aufgenommen und ihre Anwendbarkeit auf die dramatischen Texte Hebbels wird überprüft. Der hierin enthaltene Beitrag von Christa Agnes Tuczay112 ist als einer der wenigen Versuche anzusehen, den epischen Text des Nibelungenliedes und seine dramatische Adaption bei Hebbel einer Genderperspektive folgend gegenüberzustellen. Tuczay konzentriert sich in der Analyse auf einen Vergleich der weiblichen Rollenkonstruktionen von Brünhild/Brunhild und Kriemhild, wobei die Untersuchung der epischen Figuren gegenüber den dramatischen Betrachtungen stark in den Hintergrund rückt.113 Auch die Arbeit von Hilmar Grundmann,114 der interdiskursive ← 28 | 29 → Verknüpfungen zwischen den ‚Geschlechtertragödien‘ in Friedrich Hebbels Leben bezogen auf seine Selbstzeugnisse, seine dramatischen Texte und seine dramentheoretischen Abhandlungen herausarbeitet, nimmt auf die Nibelungen gar nicht oder nur eingeschränkt Bezug. Friederike Raphaela Lanz115 lenkt mit ihrer Analyse zur Diskursivierung von Fremdheit und Fremde im intertextuellen Vergleich ausgewählter Dramen Grillparzers und Hebbels hingegen den Blick auch auf das ‚Phänomen der Fremde‘ in Hebbels Nibelungen.
Sowohl in der germanistischen als auch in der historischen Mediävistik zeichnet sich in der jüngeren Zeit ein zunehmendes Interesse an der Analyse filmischer Umsetzungen mittelalterlicher Stoffe und historischer Ereignisse ab, in denen auch genderbezogene Fragestellungen angestoßen werden. Die feministischen Filmwissenschaften haben dabei als Schnittstelle soziologischer und kulturwissenschaftlicher und rezeptionsorientierter Forschungsperspektiven für genderorientierte Filmanalysen zentrale Impulse gesetzt.116 Sie lenken bereits früh den Blick auf ein Zusammenspiel von gender, Genre und Medium.117 Hierzu werden exemplarisch die Arbeit von Claudia Liebrand118 zu Gender-Topographien und ihr Sammelband Hollywood hybrid herausgegriffen, die in ihrer Filmlektüre von Hollywoodproduktionen auf das Interdependenzverhältnis von gender und Genre verweisen und für eine genderspezifische Filmanalyse wichtige Anhaltspunkte liefern.119 Besonders die Konstruktionsmechanismen von Männlichkeit rücken ab den 1990er Jahren verstärkt in den Blick, die zunächst die Inszenierung des ‚Männlichen als Norm‘ betrachten und in den letzten Jahren aber vermehrt ‚abweichende‘ Männlichkeitsentwürfe in den Blick nehmen. In diesem Zusammenhang entstehen mehrere Arbeiten, welche die Visualisierungen des männlichen Körpers analysieren,120 wie die Analyse Spectacular bodies von Yvonne Tasker121 zum Hollywood-Actiongenre, oder die Untersuchungen von Siegfried Kaltenecker122 und ← 29 | 30 → Kathrin Mädler,123 die Brüchigkeiten der Männlichkeitsinszenierungen hervorgehoben haben. Während die Film Studies grundsätzlich als eine wissenschaftliche Disziplin zu betrachten sind, in der die Kategorie ‚Geschlecht‘ nahezu von Beginn an einen zentralen Stellenwert eingenommen hat,124 sind für die Untersuchungen zu den Nibelungen Fritz Langs und Thea von Harbous aber nur wenige genderorientierte Analysen entstanden. Obwohl das frühe Kino zu einem prominenten Thema der feministischen Filmwissenschaft zu zählen ist und sich dieses Interesse mit einer nun vor allem kontextorientierten Ausrichtung seit den 1990er Jahren wieder verstärkt hat,125 befassen sich nur wenige Geschlechteranalysen mit Langs Nibelungen-Adaption.126 Zur filmtechnischen und filmästhetischen Interpretation des Nibelungen-Stoffs im Stummfilm sind dagegen eine ganze Reihe von literaturwissenschaftlichen, medienwissenschaftlichen und filmkünstlerischen Analysen anzuführen, die wichtige Anhaltspunkte für eine genderfokussierte Rezeptionsanalyse des Nibelungen-Films bieten.127 Die Diskussion über die deutsch-nationale Prägung des Films und seiner politischen Ambivalenz bestimmen die frühen filmwissenschaftlichen Studien zu Fritz Langs Stummfilmen und das Interesse an diesen Motiven dauert bis heute an.128 Die Arbeiten der deutsch-französischen Filmhistorikerin Lotte Eisner129 gehören gemeinsam mit der Untersuchung von Siegfried Kracauer130 Von Caligari zu Hitler zu den bekanntesten filmhistorischen ← 30 | 31 → Studien, die beide im Exil unter den Eindrücken, Erfahrungen und Erkenntnissen des nationalsozialistischen Regimes entstanden sind. Während Lotte Eisner sich aus kunstwissenschaftlicher Perspektive in ihrer Studie Die Dämonische Leinwand besonders mit expressionistischen Darstellungsformen, Kategorien des Unheimlichen und Grotesken in einer Tradition der deutschen Romantik auseinandersetzt, befragt Siegfried Kracauer Filme aus sozialpsychologischer Perspektive auf narrative Motive und thematische Vorlieben von Angst, Aggression, Revolte und Unterwerfung als Ausdrucksformen einer autoritären Gesellschaft in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Er interpretiert ausgewählte Bildmotive der Nibelungen-Adaption als Teil rassistischer wie präfaschistischer Konzeptionen, rückt deutsch-nationale Motivkomplexe in den Vordergrund und prägt den filmwissenschaftlichen Blick auf das Weimarer Kino damit nachhaltig.131 Seine sehr einseitige Interpretation der Bildmotive wurde allerdings bereits einer eingehenden Kritik unterzogen.132 Auch Anton Kaes133 stellt in seiner kulturhistorisch ausgerichteten Untersuchung Shell Shock Cinema diese Verbindung zwischen Caligari und Hitler erneut in Frage und untersucht den Weimarer Film stattdessen als eine Verarbeitungsform des Traumas der Weltkriegserfahrung. Er nutzt Forschungsergebnisse der Psychologie, Medizin, Literatur- und Kulturwissenschaften um unter die ‚Oberfläche‘ der Filme zu gelangen und versucht spezifische „Kriegsbilder“ in den Filmen zu entschlüsseln, auch wenn das moderne Schlachtfeld als Szenerie nicht vorkommt. Klaus Kanzog134 lenkt in seinem Beitrag den Blick auf unterschiedliche Fassungen des Nibelungen-Films und untersucht die filmtechnischen Besonderheiten der Visualisierungsstrategien des Stummfilms. Laut Kanzog sind die Botschaften der Bilder nur durch die Rekonstruktion der Visualisierungsstrategien zu bestimmen, die durch drei zentrale Motive bestimmt werden: Repräsentation, Zeichen und Blicke. Diese Kategorien lassen sich, wie besonders die mediävistischen Untersuchungen von Horst Wenzel135 gezeigt ← 31 | 32 → haben, ebenso für die Kommunikationszusammenhänge im epischen Text anwenden und machen eine Vergleichbarkeit literarischer und filmischer Erzählstrategien deutlich. Auch Hans Günther Pflaum136 bietet in seiner Einführung Deutsche Stummfilmklassiker eine Übersicht zu zentralen visuellen Strategien filmischer Narration sowie zu Motivkombinationen der Nibelungen-Adaption und stellt Verbindungen zu Langs weiteren filmischen Inszenierungen her. Die kunstwissenschaftlich orientierte Bildanalyse von Angelika Breitmoser-Bock137 fragt nach der visuellen Darstellungsform sogenannter Schlüsselbilder in Fritz Langs Siegfried, die den Film in besonderer Weise repräsentieren. Hierbei nimmt sie sowohl Einzelbilder als auch Bildsequenzen in den Blick. In ihrer Detailanalyse wird deutlich, dass der Film nicht nur durch die bewegte Bildmotivik, sondern auch von seinen standbildartigen, langanhaltenden Einzelbildkompositionen geprägt ist, und sie wendet sich medienkomparativen Fragestellungen zu, indem sie die Rezeption künstlerischer Vorbilder aus bildender Kunst und Architektur in ihre Analyse einbezieht.138 Auch Lothar van Laak139 verweist in seiner Analyse zu Geschichtskonzeptionen und filmischem Mythos auf wichtige filmästhetische Erzählstrukturen. Das Verhältnis von textlich-epischem Erzählen und visuellen Strategien der Filmerzählung wird auf ihre spezifischen Strukturen hin untersucht. Christian Kiening und Cornelia Herberichs140 nehmen in ihrem Beitrag Fritz Lang: Die Nibelungen (1924) eine Analyse einzelner Szenen des Nibelungen-Films mit vergleichendem Blick auf den epischen Text vor, doch die Frage nach Genderkonstruktionen und Gendertransformationen greifen sie nicht auf. Zwei neuere Analysen setzen im Gegensatz dazu einen dezidiert genderspezifischen Schwerpunkt bei ihrer Betrachtung von Fritz Langs Nibelungen. Während Alexandra Tischel141 hierbei ihren Blick jedoch stärker auf ein Wechselverhältnis zwischen Thea von Harbous Nibelungen-Roman und dem Stummfilm richtet und besonders dessen national-deutsche Orientierung in Wechselbeziehung zu Geschlechterkonstruktionen ← 32 | 33 → untersucht, stellt Michael Mecklenburg142 in seinem Aufsatz Die Waffen der Frauen? einen Vergleich der Formen weiblicher Heldenhaftigkeit im mittelalterlichen Epos und in filmischen Nibelungen-Adaptionen an. Seine Untersuchung befasst sich mit den Konstruktionen von Weiblichkeit in textlichen und filmischen Narrationen und stellt hierbei in einer ausgewählten, vergleichenden Szenenanalyse dem mittelalterlichen Epos Fritz Langs (1924), Harald Reinls (1966/1967) und Uli Edels (2004) filmische Bearbeitungen gegenüber.143 Dieser Beitrag ist eine der wenigen genderbezogenen Untersuchungen, die eine vergleichende Detailanalyse mittelalterlicher und neuzeitlicher Stoffadaptionen ins Zentrum rücken, wobei hier erneut vor allem die Weiblichkeitsentwürfe von Interesse sind. Seine Analyse befasst sich mit den genderspezifischen Konzeptionen von heldenhaftem Handeln, mit adaptiven Formen männlicher Gewaltfähigkeit sowie deren spezifischen Umsetzungen und Bewertungen in den medialen Bearbeitungen.
Moritz Rinkes dramatische Bearbeitungen sind in den fachwissenschaftlichen Auseinandersetzungen um das Gegenwartsdrama bis jetzt nur wenig erschlossen und zu seinen Nibelungen-Adaptionen144 gibt es nur einige wenige Beiträge, die bis auf einige Ausnahmen eher einen Überblickscharakter besitzen145 oder sich exemplarischen Einzelanalysen zuwenden. Aber eine komparative Analyse, die wie die hier vorliegende Untersuchung sowohl den dramatischen Text als auch die fernsehtheatrale Bearbeitung einbezieht, wurde noch nicht vorgenommen. Besonders im Rahmen der Veröffentlichungen der Wormser Nibelungenlied-Gesellschaft finden sich jedoch auch ein paar vergleichende Analysen, die besonders Friedrich Hebbels und Moritz Rinkes dramatische Bearbeitungen in den Blick nehmen. Hierbei werden erneut vor allem die Weiblichkeitsentwürfe fokussiert, wie bspw. der Beitrag von Ulrike Schäfer146 Die Figur der Kriemhild bei Hebbel, Rinke und im Nibelungenlied zeigt. Zwei Aufsätze von Marion Bönnighausen147 und Nathanael Busch148 ordnen Moritz ← 33 | 34 → Rinkes Bearbeitung dabei in einen größeren Rezeptionszusammenhang ein und geben exemplarische Hinweise zu Figurenkonstellationen, szenischer Inszenierung, dramatischen Darstellungsformen und zum Sprachgestus. Marion Bönninghausen wendet sich in ihrer Analyse besonders den Frauenfiguren und ihren spezifischen Transformationen bei Rinke zu, die sie jedoch nicht im textanalytischen Vergleich präzisiert, sondern mit Hinweisen auf differente Figurenkonzeptionen des Nibelungenliedes darlegt. Nathanael Busch fragt nach spezifischen Inszenierungsformen des Nibelungen-Stoffs auf den „Bühnen der Gegenwart“ und stellt die Aufführung der Nibelungen von Friedrich Hebbel in der Inszenierung von Jürgen Flimm der Nibelungen-Adaption Moritz Rinkes vergleichend gegenüber. Besonders die Frage nach einer ideologischen Vereinnahmung des Stoffs als deutsches Nationalepos und die jeweiligen Reaktionen der Gegenwarts-Adaptionen auf diese Konstellation rückt er in seiner Betrachtung in den Vordergrund. Erst die jüngsten literaturwissenschaftlichen Forschungen wenden sich, wie bspw. das Moritz-Rinke-Arbeitsbuch von Kai Bremer149 mit kurzen Einführungen und einem Materialteil zeigt, nun einer Erschließung von Rinkes dramatischen Texten als Teil der deutschen Gegenwartsliteratur zu. Das Arbeitsbuch greift dabei einzelne Elemente von Rinkes dramatischen Arbeiten, wie die mehrdeutigen Figurendarstellungen, die politischen Dimensionen seiner Stücke und das wiederkehrende Motiv der utopischen Idee, kritisch auf. Diese Tendenz exemplarischer Motivanalyse findet sich auch in der interkulturellen Perspektive wieder, die die ungarische Germanistin Enikő Dácz150 an Rinkes Texte heranträgt, denn sie befasst sich in mehreren Aufsätzen und in ihrer Qualifikationsschrift mit einer vergleichenden Analyse der ungarischen und deutschen Gegenwartsrezeption der Nibelungen. Mit ihrer 2011 veröffentlichten Dissertation Alte ‚maere‘ für die deutsche und ungarische Gegenwart151verortet sie sich in einem rezeptionsästhetischen Analysezusammenhang, mit dem sie eine „Beschreibung der Kontinuitäten sowie der Brüche in der Gegenwartsrezeption“152 anstrebt. Sie kontextualisiert die beiden Autoren Moritz Rinke und János Téeys ausführlich in ihrem jeweiligen Umfeld einer neuzeitlichen Nibelungen-Rezeption. Mit der von ihr fokussierten Kategorie der ‚Wiederholung‘ wendet sie sich der Frage von Ver- und Bearbeitung spezifischer Stofftraditionen und einzelner Motive zu und bezieht hierfür auch exemplarisch das mittelhochdeutsche Epos ein. Ihre Analyse knüpft Enikő Dácz dabei ausdrücklich an den dramatischen Text Moritz Rinkes und klammert die fernsehtheatrale Bearbeitung der Aufführung bei den Wormser Festspielen ← 34 | 35 → aus. Im Gegensatz dazu bezieht sich Simone Schofer153 in ihrer vergleichenden Untersuchung von 2009 besonders auf die Inszenierung Moritz Rinkes bei den Festspielen. Sie wendet sich in ihrer online publizierten Dissertation mit dem Titel Mythos – Geschlecht – Medien – die Nibelungen; ein kulturhistorischer Vergleich einer ähnlichen thematischen Fragestellung zu, wie sie in der vorliegenden Untersuchung verfolgt wird, doch ist ihre Analyse durch ihre theoretische Ausrichtung auf dem Mythosbegriff grundsätzlich anders gewichtet.154 Sie untersucht, auf welche Weise die mittelalterliche Erzählung des Nibelungenliedes noch heute eine identitätsstiftende Relevanz besitzen kann, wie die epischen Figuren zur Projektionsfläche der Identitätsbildung eingesetzt werden und definiert diese Form einer ‚Leitbildfunktion‘ der Figuren als eine typische Eigenschaft von ‚Mythen‘.155 In ihren Untersuchungen wird allerdings nicht deutlich, welche mythischen „Leitbilder“156 und „Strukturen“157 sie in den Nibelungen-Bearbeitungen tatsächlich ausmacht und in welcher Relation diese zu ‚Geschlecht‘ und medialer Verfasstheit stehen. Sie kündigt zwar in ihrer Einleitung an, eine ‚Lücke‘ der Nibelungen-Forschung über die Verbindung der Kategorien ‚Mythos‘, ‚Geschlecht‘ und Medien schließen zu wollen, doch greifen ihre vergleichenden Analysen die aktuellen medien- und gendertheoretischen wie narratologischen Debatten nur marginal auf. Wie diese kritischen Anmerkungen ankündigt haben, sucht die hier vorliegende Arbeit im Gegensatz dazu einen anderen Weg zu gehen und die diachrone sowie medienkomparative Analyse der Genderkonstruktionen auf mehreren Ebenen zu verorten. Hierbei wird von einem Wechselverhältnis von narrativer Konstruktion und Geschlechterrepräsentation in den medialen Bearbeitungen ausgegangen, das erstens in seiner medienspezifischen Komplexität der Verfasstheit, zweites in einer komparativen Dynamik der Bearbeitungen zueinander und drittens aus der Spezifik des historischen Kontextes heraus zu untersuchen ist. Eine solche diachrone Zusammenschau der medialen Nibelungen-Rezeption in einer intersektional angelegten Mehrebenenanalyse bietet in der hier geplanten Ausrichtung und methodischen Differenzierung einen neuen Zugang im weiten Forschungsfeld der Nibelungenlied-Bearbeitungen.158 Diese Ausrichtung der Arbeit ist als ihr innovatives Potential anzusehen, denn bisher fehlen weitgehend komparative Untersuchungen, die sich diachron ← 35 | 36 → betrachteten Genderkonstruktionen unter Einbezug von medien- und kulturspezifischen sowie narratologischen Gesichtspunkten zuwenden.
_______________
1Die Klage B, 317–319 (Dass so viele Helden wegen des Hasses einer Frau erschlagen wurden, wird man für immer als etwas Unerhörtes erzählen. [Lienert, 2000]).
2Die Forschungsarbeiten, die bereits die Verbindungsfähigkeit von gender und Narration verfolgen, beziehen im Gegensatz zur vorliegenden Untersuchung in der Regel keine diachrone und/oder medienkomparative Perspektive ein. Vgl. hierzu bspw. Nünning/Nünning (2004), vgl. Nieberle/ Strowick (2006), vgl. Seier (2007) und vgl. Liebrand (2003). Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 2.2.
3Vgl. Seier/Warth, 2005, S. 96. Vgl. Babka, 2001, S. 92. Vgl. Nünning/Nünning, 2004, S. 2f.
4Vgl. zur Annäherung an eine intersektionale Mehrebenenanalyse Degele/Winker, 2007, S. 3f. Vgl. Degele/Winker, 2009, S. 18f. Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 2.1.
5Uns ist in alten maeren wunders vil geseit: / von heleden lobebaeren, von grozer arebeit, / von freude und hochgeciten, von weinen unde klagen / von küener recken striten muget ir nu wunder hoeren sagen. (Das Nibelungenlied C, 1 (Uns wird in alten Erzählungen viel Wunderbares berichtet. Von berühmten Helden, von großer Mühsal, von Freude und Festen, von Weinen und Klagen, vom Kampf tapferer Recken könnt ihr jetzt Erstaunliches hören. [Schulze, 2008]). Unterstreichungen in der Übersetzung kennzeichnen Teile, die von der Autorin ergänzt bzw. verändert wurden.
6Der Begriff des ‚Heldengeschlechts‘ bezieht sich auf kulturelle Vorstellungen und gesellschaftliche Normen von Verwandtschaftsbeziehungen, Gefolgschaftstreue und Kriegerehre, die eine spezifische Gruppendynamik und einen tragischen Wertekonflikt erzeugen. Vgl. Mecklenburg, 2002, S. 16.
7Das Nibelungenlied C, 1,2 (von berühmten Helden [Schulze 2008]).
8Das Nibelungenlied C, 1,4 (vom Kampf tapferer Recken könnt ihr jetzt Erstaunliches hören. [Schulze, 2008]).
9Vgl. Miklautsch, 2006, S. 242f.
10Vgl. Lienert, 2000, S. 135.
11Die Klage B, 319.
12Vgl. hierzu auch die 2. Strophe in den Nibelungenlied-Handschriften A und C bzw. die 1. Strophe in der Handschrift B, in der Kriemhild von Beginn an durch den epischen Erzähler für den zukünftigen Untergang vieler Helden verantwortlich gemacht wird, denn: dar umbe muosen degene vil verliesen den lîp. Das Nibelungenlied B, 1,4 (Ihretwegen mussten viele Ritter ihr Leben verlieren. [Schulze/Grosse, 2010]). Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 4.1.1.
13Die Klage B, 317.
14Der Vorteil des aus dem Englischen entlehnten Begriffs gender liegt darin, dass er im Gegensatz zu dem deutschen Begriff ‚Geschlecht‘ weniger mehrdeutig angelegt ist, denn im deutschen Sprachgebrauch kann ‚Geschlecht‘ sowohl als Terminus für Abstammungsverhältnisse (vgl. z.B. Heldengeschlecht), für biologische Bedingungen und kulturelle wie soziale Dimensionen von Geschlechtsidentität herangezogen werden. Im Folgenden werden beide Begriffe synonym verwendet, so dass der deutsche Begriff mit dem englischen Begriff gleichgesetzt wird. Vgl. hierzu Kapitel 2.1 und Kapitel 2.3.
15Vgl. hierzu Kapitel 2.2.
16Der Begriff der Rezeption ist durch sehr unterschiedliche disziplinäre Einteilungs- und Zugangsformen gekennzeichnet und häufig verbinden sich mit ihm bereits Werturteile über ein Ge- oder Misslingen der jeweiligen Rezeption (vgl. U. Müller, 1986, S. 507). Ulrich Müller unterscheidet vier idealtypische Grundformen der Mittelalterrezeption und teilt sie in „produktive, reproduktive, wissenschaftliche und politisch-ideologische“ Rezeptionstypen ein (vgl. U. Müller, 2003, S. 408). Betrachtet man diese Idealtypen in ihrer Anwendbarkeit auf rezeptionsorientierte Text- und Medienanalysen allerdings genauer, so ist hervorzuheben, dass Mischungen und Überschneidungen der einzelnen Formen eher die Regel, als die Ausnahme sind und die Trennung zwar für eine erste Perspektivierung dienlich sein kann, aber für die Analyse oft zu kurz greift.
17Vgl. U. Müller, 2003, S. 411.
18Vgl. hierzu Kapitel 3 und Kapitel 4.
19Zima, 2000, S. 16.
20Zima, 2000, S. 16.
21Zima, 2000, S. 16.
Details
- Pages
- 567
- Publication Year
- 2014
- ISBN (PDF)
- 9783653029833
- ISBN (MOBI)
- 9783653998276
- ISBN (ePUB)
- 9783653998283
- ISBN (Hardcover)
- 9783631628133
- DOI
- 10.3726/978-3-653-02983-3
- Language
- German
- Publication date
- 2014 (March)
- Keywords
- Hunnen Xanten Narratologie Nibelungenlied Intersektionalität
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 567 S., 244 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG