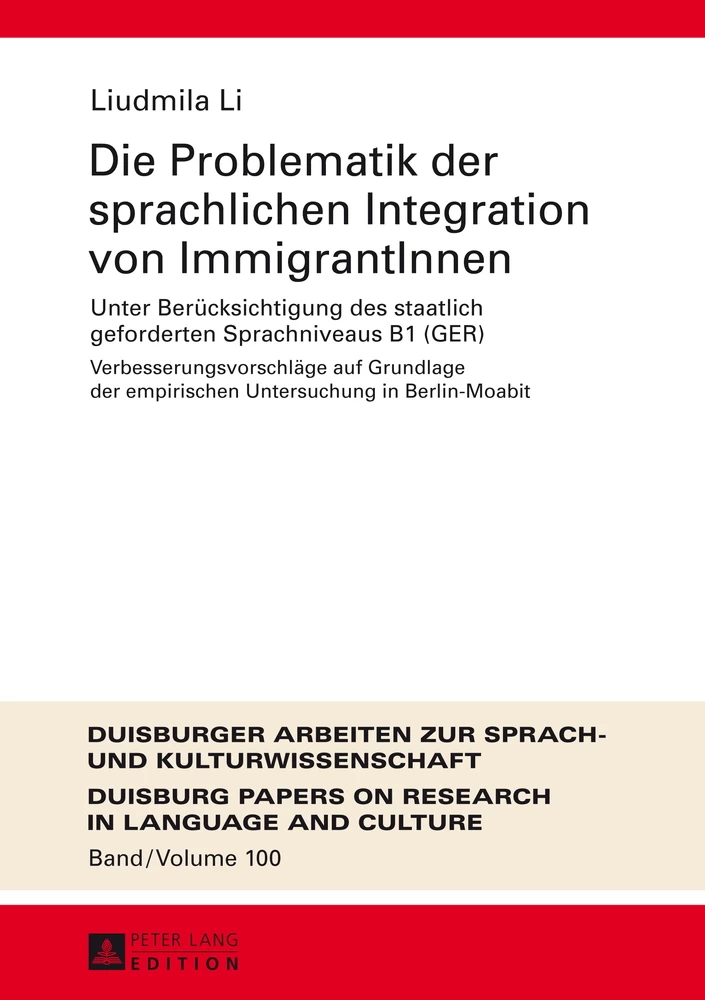Die Problematik der sprachlichen Integration von ImmigrantInnen
Unter Berücksichtigung des staatlich geforderten Sprachniveaus B1 (GER)- Verbesserungsvorschläge auf Grundlage der empirischen Untersuchung in Berlin-Moabit
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 0. Einleitung
- 0.1 Thematik und Zielstellung
- 0.2 Methodik
- 1. Migration – Ein aktuelles deutsches Phänomen
- 1.1 Begriffsbestimmungen zur Migration
- 1.2 Begriffsexplikation: Immigration
- 1.3 Migrationstypen und theoretische Erklärungsansätze
- 1.4 Zusammenfassung
- 2. Integration als gesamtgesellschaftlicher Prozess
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2 Die Dimensionen: strukturelle, kulturelle, soziale, identifikatorische Integration
- 2.3 Die zwei Phasen: Akkommodation und Akkulturation
- 2.4 Zusammenfassung und Fazit
- 3. Die strukturelle Integration von ImmigrantInnen
- 3.1 Zur Einwanderungspolitik der BRD
- 3.1.1 Aufenthaltsrecht und Zuwanderungsgesetz
- 3.1.2 Zusammenfassung
- 3.2 Arbeitsmarkt
- 3.2.1 Zur Lage der zweiten und dritten Einwanderergeneration
- 3.2.2 Hochqualifizierte als neue „Gastarbeiter“-Generation
- 3.2.3 Schlussfolgerung
- 3.3 Schule und Ausbildung
- 3.3.1 Zur Bildungssituation von Immigrantenkindern und -jugendlichen
- 3.3.2 Institutionelle Diskriminierung
- 3.3.3 Zur sprachlichen Situation von Kindern im Vorschulalter
- 3.3.4 Frühkindliche Sprachförderung
- 3.3.5 Die Rolle der Eltern für den Bildungserfolg ihrer Kinder
- 3.3.6 Berufliche Bildung
- 3.3.7 Zusammenfassung und Empfehlungen
- 3.4 Hochschulbildung
- 3.4.1 Kategorien der Studierenden
- 3.4.2 Sprachliche Zugangsvoraussetzungen
- 3.4.3 Zusammenfassung und Ausblick
- 4. Sprachliche Integration
- 4.1 Zum Stand der Sprachfähigkeit von ImmigrantInnen in Deutschland
- 4.2 Spracherwerb – Die besonderen Bedingungen für ImmigrantInnen
- 4.3 Die Staatliche Sprachförderung auf dem Niveau B1 (GER)
- 4.3.1 Das Rahmencurriculum als Instrument der staatlichen Sprachprüfung
- 4.3.1.1 Ziele und Zielgruppen
- 4.3.1.2 Methodik und Didaktik
- 4.3.2 Zusammenfassung
- 4.4 Spracherwerbsförderung mit dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
- 4.4.1 Ziele und Anliegen
- 4.4.2 Kriterien des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
- 4.4.3 Beschreibung der Niveaustufen
- 4.4.4 Vergleich der Kompetenzstufen B1, B2 und C1
- 4.4.5 Zusammenfassung und Diskussion
- 5. Soziale Integration und ihre sprachliche Dimension
- 5.1 Sprachliche und soziale Identität als Prozess
- 5.2 Identifikatorische Integration und Spracherwerb
- 5.3 Das Verhältnis von sozialer, kultureller, identifikatorischer und sprachlicher Integration am Beispiel junger ImmigrantInnen der zweiten Generation
- 5.4 Fazit
- 6. Berlin – Eine Integrationsstadt?
- 6.1 Ortsbeispiel Berlin-Moabit
- 6.1.1 Charakteristik des Bezirks
- 6.1.2 Charakteristik der Bewohner
- 6.2 Der Beusselkiez – „Ghetto“ oder „Parallelgesellschaft“?
- 6.2.1 Die Begriffe im Vergleich
- 6.2.2 Zur sozio-ökonomischen und ethnischen Situation
- 6.2.3 Schlussfolgerung
- 7. Empirische Untersuchung des Sprachniveaus in Berlin-Moabit
- 7.1 Untersuchungsdesign
- 7.1.1 Phase 1 der Befragungen: Stichprobe
- 7.1.2 Phase 2 der Befragungen: Quantitativ-qualitative Umfrage
- 7.1.3 Auswertungsdesign
- 7.2 Strukturelle Integration
- 7.2.1 Demographische Daten: Alter, Ethnische Gruppen, Aufenthaltsdauer, Staatsangehörigkeit/Einbürgerungswunsch
- 7.2.2 Bildungsniveau und beruflicher Status
- 7.2.3 Abschließende Meinung zur Staatsbürgerschaft
- 7.3 Sprachliche Integration
- 7.3.1 Deutsch- und Muttersprachenkenntnisse im Vergleich
- 7.3.2 Deutschkenntnisse und Aufenthaltsdauer
- 7.3.3 Deutschkenntnisse und Staatszugehörigkeit
- 7.3.4 Sprachliche Fähigkeiten in Deutsch und der Muttersprache im Vergleich
- 7.3.5 Sprachliche Fähigkeiten in Deutsch und Aufenthaltsdauer
- 7.3.6 Sprachliche Fähigkeiten in Deutsch und Staatszugehörigkeit
- 7.3.7 Sprachniveau und Sprachförderung
- 7.3.8 Abschließende Meinungen zur Verbesserung der sprachlichen Integration
- 7.3.9 Zum Verhältnis von Zugangsvoraussetzungen für Studierende an der Technischen Universität Berlin und sprachlicher Realität
- 7.4 Soziale und sprachliche Integration
- 7.4.1 Das soziale Umfeld und Sprachpraxis
- 7.4.2 Sprachverwendung durch Mediennutzung
- 7.4.3 Kommunikation mit deutschen Behörden
- 7.4.4 Gesamteinschätzung der Alltagskommunikation
- 7.4.5 Abschließende Meinungen zur Verbesserung der sozialen Integration
- 7.4.6 Zum Verhältnis von sozialem Engagement in der Elternarbeit und Sprachkenntnissen
- 7.5 Identifikatorische Integration
- 7.5.1 Einschätzung der Integration in Deutschland
- 7.5.2 Abschließende Meinunge zu Deutschland als multikulturelles Land
- 7.6 Schlussfolgerungen und Verbesserungsvorschläge
- 8. Resümee
- Literaturverzeichnis
- Verwendete Internet-Links
- Anhang
- Fragebogen zur strukturellen und sprachlichen Situation in Berlin-Moabit
- Fragebogen zur kulturellen und sprachlichen Situation in Berlin-Moabit
- Ergänzende offene Fragen zum Fragebogen an Mütter
- Fragebogen zur sprachlichen Situation im Universitätsalltag
- Zusammenfassung
- Danksagung
| XI →
Abb. 1: Alter der Befragten
Abb. 2: Frage „Wie lange wohnen Sie in Deutschland?“
Abb. 3: Ethnische Gruppen der Befragten
Abb. 4: Frage „Welches Bildungsniveau haben Sie erreicht?“
Abb. 5: Frage: „Welchen beruflichen Status haben Sie?“
Abb. 6: Frage: „Möchten Sie ein deutscher Staatsbürger werden?“
Abb. 7: Frage „Möchten Sie ein deutscher Staatsbürger werden?“ (Analyse der Antworten innerhalb der 6 größten ethnischen Gruppen unter der Befragten. Einbürgerungswunsch nach Ländern)
Abb. 8: Vergleichsdiagramme der Sprachkenntnisse in der Muttersprache und Deutsch allgemein
Abb. 9: Frage: „Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse allgemein ein?“ (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 10: Frage: „Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse allgemein ein?“
Abb. 11: Vergleichsdiagramm der sprachlichen Fähigkeiten in der Muttersprache und Deutsch
Abb. 12: Einschätzung der sprachlichen Fähigkeiten in Deutsch. (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 13: Frage „Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeiten in Deutsch ein?“
Abb. 14: Frage „Sind Sie mit Ihren deutschen Sprachkenntnissen zufrieden?“
Abb. 15: Frage „Würden Sie die Möglichkeit ergreifen, in kostenlosen Sprachkursen Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern?“
Abb. 16: Frage „Welche Sprachkurse haben Sie bereits besucht?“
Abb. 17: Zahl der Befragten, die der Meinung sind, dass sie für eine bessere sprachliche Integration ein höheres Sprachniveau haben sollten.
Abb. 18: Frage „Stimmen Sie dem Motto „Mit guten Sprachkenntnissen – bessere Arbeitschancen!“ zu?“
Abb. 19: Frage „Hatten Sie sprachliche Schwierigkeiten im Alltag?“
Abb. 20: Frage „Falls Sie einen Partner haben (werden), gehört er Ihrer Nationalität an?“
← XI | XII →
Abb. 21: Frage „Haben Sie deutsche Freunde/Bekannte, mit denen Sie Deutsch sprechen?“
Abb. 22: Frage „Welche Sprache sprechen Sie zu Hause?“ (Vergleichsdiagramme der ImmigrantInnen mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft)
Abb. 23: Frage „Welche Sprache sprechen Sie zu Hause?“ (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 24: Frage „Wie sehen Sie TV?“ (Vergleichsdiagramme der Befragten mit und ohne deutschen Pass)
Abb. 25: Frage „Wie sehen Sie TV?“ (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 26: Frage „In welcher Sprache lesen Sie (Zeitungen, Internet, Bücher)?“ (Vergleichsdiagramm der eingebürgerten und bislang nicht eingebürgerten befragten ImmigrantInnen)
Abb. 27: Frage „In welcher Sprache lesen Sie (Internet, Bücher, Zeitungen)?“ (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 28: Frage „Wie hören Sie Radio?“
Abb. 29: Frage „Wie hören Sie Radio?“ (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 30: Frage „Wie kommen Sie mit deutschen Behörden sprachlich zu Recht (Termine und Formulare)?“
Abb. 31: Frage „Wie kommen Sie mit deutschen Behörden sprachlich zu Recht (Termine und Formulare)?“ (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 32: Frage „Wie schätzen Sie den Anteil der deutschsprachigen Kommunikation in ihrem Leben ein?“
Abb. 33: Frage „Wie schätzen Sie den Anteil der deutschsprachigen Kommunikation in ihrem Leben ein?“ (Analyse nach der Aufenthaltsdauer der Befragten.)
Abb. 34: Frage „Wie schätzen Sie den Anteil der deutschsprachigen Kommunikation in ihrem Leben ein?“
Abb. 35: Frage „Wo fühlen Sie sich zu Hause?“
Abb. 36: Frage „Wie schätzen Sie Ihre Integration in Deutschland ein?“
Abb. 37: Frage „Würden Sie Deutschland als eine multikulturelle Gesellschaft bezeichnen?“
Details
- Seiten
- XIII, 179
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (Hardcover)
- 9783631649879
- ISBN (PDF)
- 9783653041347
- ISBN (MOBI)
- 9783653985207
- ISBN (ePUB)
- 9783653985214
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04134-7
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (Februar)
- Schlagworte
- Immigranten Integrationskurse Spracherwerb soziale Integration
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. XIV, 179 S., 37 s/w Abb., 9 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG