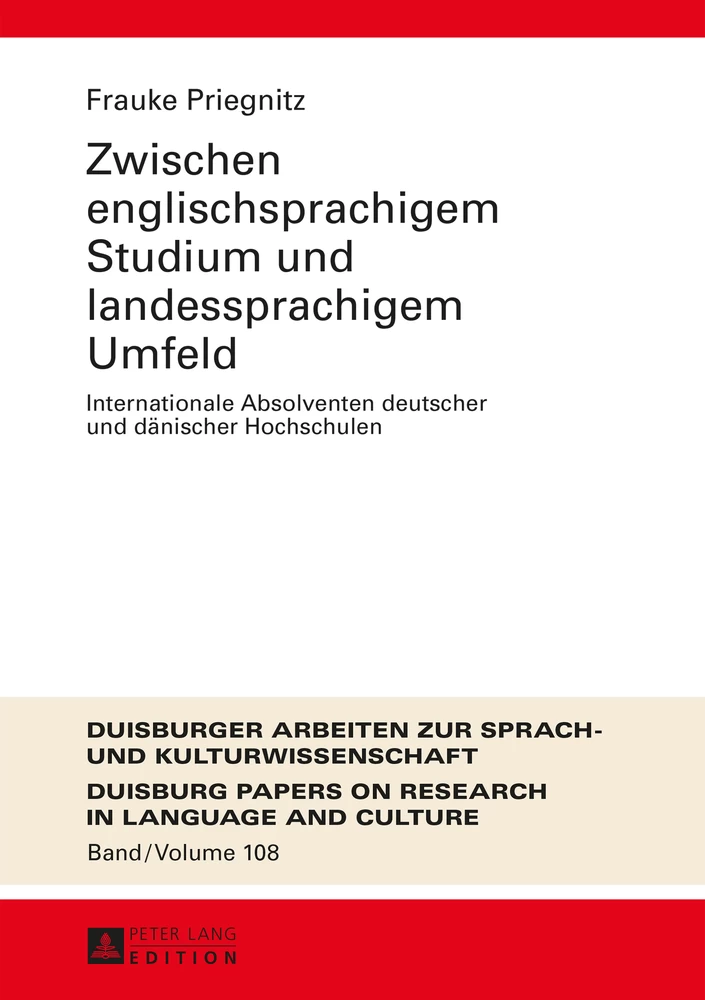Zwischen englischsprachigem Studium und landessprachigem Umfeld
Internationale Absolventen deutscher und dänischer Hochschulen
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der sprachliche Hintergrund
- 2.1. Zur Stellung der englischen, deutschen und dänischen Sprache
- 2.1.1. Englisch als Lingua Franca vs. Englisch als Identifikationssprache
- 2.1.2. Englisch, Deutsch und Dänisch als Wissenschaftssprache
- 2.2. Konsequenzen der Sprachenkonstellation für Wissenschaft und Gesellschaft
- 2.2.1. Sprachimperialismus, Sprachverbreitung und das Maximin-Prinzip
- 2.2.2. Ausbau vs. Rückgang der individuellen Mehrsprachigkeit
- 3. Die Internationalisierung der Hochschulen
- 3.1. Terminologische Grundlagen
- 3.2. Gründe für das Anwerben internationaler Studierender
- 3.3. Studierendenmobilität und die Attraktivität englischsprachiger Länder
- 3.4. Internationalisierung im Rahmen des Bologna-Prozesses
- 3.4.1. Merkmale der Beschäftigungsfähigkeit
- 3.4.2. Bologna und das Bildungsverständnis von Wilhelm von Humboldt
- 3.5. Internationale und englischsprachige Studiengänge
- 3.5.1. Internationale und englischsprachige Studiengänge in Zahlen
- 3.5.2. Zur Sprachenpolitik in internationalen Studiengängen
- 3.5.3. Herausforderungen englischsprachiger Lehre
- 3.5.3.1. Anglisierung vs. Mehrsprachigkeit an europäischen Hochschulen
- 3.5.3.2. Herausforderungen im Umgang mit Englisch und der Landessprache
- 3.5.3.3. Mangelnde Anbindung der internationalen Studierenden an das Gastland
- 3.5.3.4. Sorge um einen Statusverlust und die Vitalität der eigenen Sprache
- 3.5.3.5. Das Nicht-Internationale an internationalen Hochschulen
- 4. Zum Individuum: Sprachlernmotivation, Integration und Bindungen
- 4.1. Theoretische Grundlagen der Sprachlernmotivation und Integration
- 4.2. Motivation für das Studium in englischsprachigen Studiengängen
- 4.3. Bindungen und Verbleib im Gastland
- 4.3.1. Individuelle Motive für dauerhafte Migration: ein Push- und Pull-Faktoren-Modell
- 4.3.2. Bleiberaten internationaler Studierender
- 5. Rechtliche Rahmenbedingungen und sprachliche Anforderungen
- 5.1. Rechtsgrundlagen in Deutschland und Dänemark
- 5.2. Gegenüberstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen
- 6. Sprachbedarfe auf dem Arbeitsmarkt
- 6.1. Vermittlung der sprachlichen Anforderungen an die internationalen Absolventen
- 6.2. Zur Bedeutung von Fremdsprachen für die Unternehmen
- 6.3. Sprachverwendung bei Geschäftskontakten im Ausland
- 7. Empirischer Teil
- 7.1. Mehrmethodenansatz
- 7.2. Die Perspektive international tätiger Unternehmen
- 7.2.1. Methodologisches
- 7.2.2. Auswertung
- 7.2.2.1. Unternehmen Chemicals International
- 7.2.2.2. Unternehmen Global Real Estate
- 7.2.2.3. Unternehmen Consumer Goods International
- 7.2.2.4. Unternehmen Global Technology
- 7.2.2.5. Unternehmen Global Electron
- 7.2.3. Diskussion und Fazit
- 7.2.4. Methodologische Reflexion
- 7.3. Die Perspektive der internationalen Absolventen
- 7.3.1. Methodologisches
- 7.3.1.1. Technische Umsetzung
- 7.3.1.2. Pretests
- 7.3.1.3. Aufbau des Fragebogens
- 7.3.1.4. Teilnehmerakquise
- 7.3.1.5. Datenauswertung und Darstellung der Ergebnisse
- 7.3.2. Demographischer Hintergrund
- 7.3.3. Motivation für das englischsprachige Studium und das Sprachenlernen
- 7.3.3.1. Motive für das Auslandsstudium und Lernen des Deutschen bzw. Dänischen
- 7.3.3.2. Alternative Studienorte und Gründe für die Alternative
- 7.3.3.3. Zusammenfassung der Anfangsmotivation
- 7.3.4. Fremdsprachenlernen während des Auslandsstudiums
- 7.3.4.1. Sprachenpolitik in internationalen Studiengängen
- 7.3.4.2. Selbstgesteuertes Fremdsprachenlernen während des Studiums
- 7.3.4.3. Anglisierung vs. Mehrsprachigkeit
- 7.3.4.4. Absolvierte Sprachtests
- 7.3.4.5. Entwicklung der Deutsch-, Dänisch- und Englischkenntnisse
- 7.3.4.6. Einflussfaktoren auf den Sprachlernerfolg im Deutschen bzw. Dänischen
- 7.3.4.7. Vorteile von Kenntnissen der Landessprache
- 7.3.4.8. Zusammenfassung: Sprachenlernen während des Studiums
- 7.3.5. Bindungen an das Gastland
- 7.3.5.1. Verbleib im Gastland und alternative Zielländer
- 7.3.5.2. Stipendien und Auflagen zur Rückkehr
- 7.3.5.3. Sprachkenntnisse als Determinante für Migrationsentscheidungen
- 7.3.5.4. Einschätzung der gebliebenen Absolventen über das Leben im Gastland
- 7.3.5.5. Berufstätigkeit im Gastland und Potentiale für die Bindung von Fachkräften
- 7.3.5.6. Herausforderungen bei der Arbeitssuche und Gründe für die Abreise
- 7.3.5.7. Verbliebene Bindungen und aktueller Sprachgebrauch
- 7.3.5.8. Bindungswünsche vonseiten der Absolventen
- 7.3.5.9. Bleibeabsichten
- 7.3.5.10. Zusammenfassung zu den Bindungen internationaler Absolventen an das Gastland
- 7.3.6. Retrospektive Bewertung des Studiums
- 7.3.6.1. Zufriedenheit mit den erworbenen Sprachkenntnissen
- 7.3.6.2. Bleibewunsch bei besseren Deutsch- bzw. Dänischkenntnissen
- 7.3.6.3. Verpflichtende Deutsch- und Dänischkurse
- 7.3.6.4. Teilnahme an landessprachigen Lehrveranstaltungen
- 7.3.6.5. Kontakte, kulturelle Einblicke und Integration
- 7.3.6.6. Englisch in Studium und Beruf
- 7.3.6.7. Zusammenfassung der retrospektiven Einschätzungen
- 7.3.7. Abschließendes Fazit der Absolventen zum Lernen der Sprache des Gastlandes
- 7.3.8. Methodologische Reflexion
- 8. Fazit und Ausblick
- 8.1. Zur Notwendigkeit von Kenntnissen der Landessprache für die Bindung der Absolventen
- 8.2. Zur Bedeutung von sozialen Kontakten und Netzwerken
- 8.3. Englisch, Deutsch und Dänisch als Sprachen der Internationalisierung
- 8.4. Handlungsempfehlungen
- 8.4.1. Empfehlungen für die Hochschulen
- 8.4.2. Empfehlungen für internationale Studierende und Absolventen
- 8.4.3. Empfehlungen für Unternehmen
- 8.5. Ausblick auf weitere Forschung
- Bibliografie
- Gesetze und Verordnungen
- Verwendete Software
- Linkverzeichnis
- Anhang
← XII | XIII → Tabellenverzeichnis
Tabelle 2: Historische Entwicklung der Wissenschaftssprachen in Deutschland und Dänemark
Tabelle 5: Typen der individuellen Sozialintegration (nach Berry 1990:244f.; Esser 2006:24f.)
Tabelle 6: Übersicht über die befragten Unternehmen
Tabelle 8: Überblick über die einzelnen Forschungsfragen
Tabelle 9: Übersicht über die früheren Hochschulstandorte der teilnehmenden Absolventen
Tabelle 10: Hauptherkunftsländer der Fragebogenteilnehmer (A104)
Tabelle 11: Studienrichtung (A110)
Tabelle 12: Motive für die Wahl des Studiengangs (A135)
Tabelle 14: Aufschlüsselung der gleichermaßen bzw. bevorzugten Studienorte der Absolventen (A126)
Tabelle 15: Neu gelernte Sprachen während des Auslandsstudiums (A418_05)
← XIII | XIV → Tabelle 20: Korrelationen zwischen den Zuwächsen an Sprachkenntnissen während des Studiums und den einzelnen Sprachfördermodellen (A416a/b/c; Zuwachs_Sprachkenntnisse) (Gesamtkorpus N = 414)
Tabelle 26: Berufstätigkeit im Gastland nach Studienabschluss (A225 / A236 / A238 / A244)
Tabelle 27: Hilfreich für die Arbeitssuche im Gastland wäre… (A243; A245)
Tabelle 28: Verbindungen zum Gastland Deutschland – Alumni im Ausland (N = 199) (A224)
Tabelle 29: Verbindungen zum Gastland Dänemark – Alumni im Ausland (N = 60) (A224)
Tabelle 30: Verbindungen der Personen (DEU), die noch im Gastland sind (N = 103) (A237)
Tabelle 31: Verbindungen der Personen (DÄN), die noch im Gastland sind (N = 52) (A237)
← XIV | XV → Tabelle 35: Bleibeabsichten (A249)
Tabelle 36: Sprachkenntnisse und Bleibeabsichten (DEU) (A412 und A249)
Tabelle 37: Sprachkenntnisse und Bleibeabsichten (DÄN) (A412 und A249)
Tabelle 39: Erreichtes Sprachniveau und Zufriedenheit über den Lernerfolg (A240/247_01)
Tabelle 44: Sprachniveau und sich im Gastland sprachlich wohl fühlen (A408/410 und A240/247_22)267← XV | XVI →
← XVI | XVII → Abbildungsverzeichnis
Abbildung 3: Screenshot der Seite studyindenmark.dk – Why Denmark, vom 02.10.2012 von archive.org
Abbildung 4: Push- und Pullfaktoren der Migration
Abbildung 5: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews mit den HR-Managern
Abbildung 6: Von der anfänglichen Motivation zu einer retrospektiven Bewertung des Studiums
Abbildung 7: Sprachlernmotivation für Deutsch und Englisch (A135_5)
Abbildung 8: Sprachlernmotivation für Dänisch und Englisch (A135_5)
Abbildung 12: Motivation für ein Studium in deutscher / dänischer Sprache (A135_37)
Abbildung 13: Möglichkeiten des Einbezugs der Landessprache in einem internationalen Studiengang
← XVII | XVIII → Abbildung 17: Deutsch- bzw. Dänischkenntnisse zu Studienbeginn (A408)
Abbildung 18: Deutsch- bzw. Dänischkenntnisse bei Studienabschluss (A410)
Abbildung 23: Aktueller Aufenthaltsort der Absolventen (A118)
Details
- Seiten
- XIX, 339
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (Hardcover)
- 9783631658857
- ISBN (PDF)
- 9783653052428
- ISBN (MOBI)
- 9783653970050
- ISBN (ePUB)
- 9783653970067
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05242-8
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (März)
- Schlagworte
- Englischsprachige Studiengänge Sprachenpolitik Sprachlernmotivation internationale Studiengänge
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. XIV, 339 S., 44 Tab., 44 Graf.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG