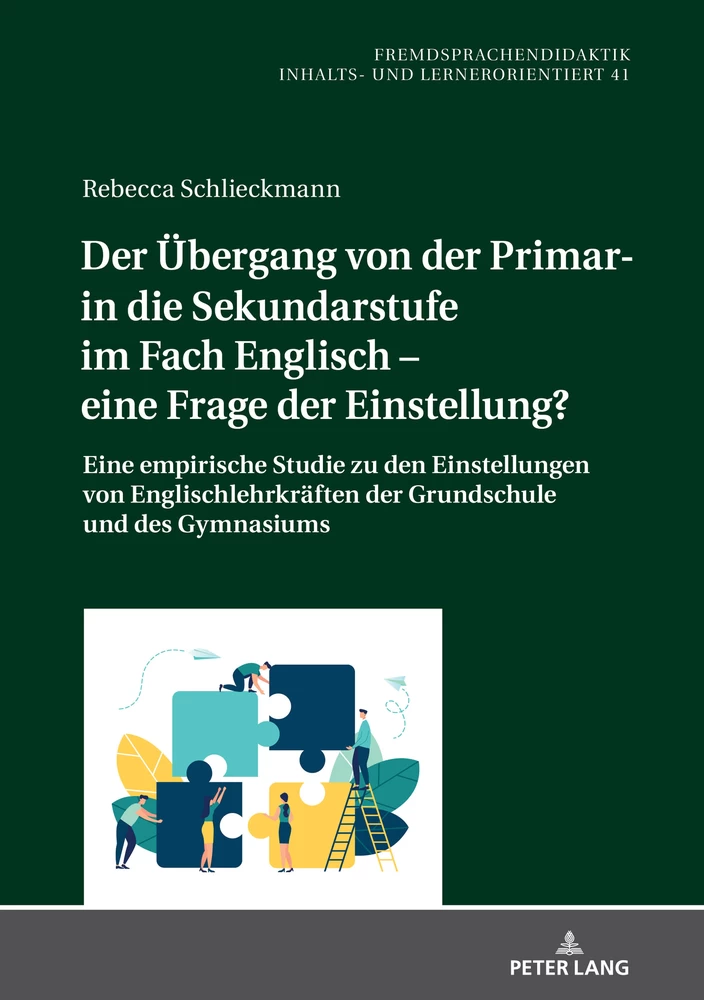Der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe im Fach Englisch – eine Frage der Einstellung?
Eine empirische Studie zu den Einstellungen von Englischlehrkräften der Grundschule und des Gymnasiums
Zusammenfassung
Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule wird noch immer als Meilenstein in der Lernbiographie von Schülerinnen und Schülern betrachtet. Seit der Einführung des Englischunterrichts im Primarstufenbereich ist die Umsetzung dessen am Übergang ein zentrales Thema für Englischlehrkräfte der Grundschulen und weiterführenden Schulen. Die Autorin greift diese Thematik auf und setzt sich mit der Frage auseinander, welche Rolle die Lehr-Lern-Einstellungen der Englischlehrkräfte bei der Gestaltung des Übergangs spielen. Im Rahmen einer interschulischen Kooperation von Englischlehrkräften setzt die Autorin Fragebögen und Leitfadeninterviews ein, um deren Einstellungen zu erfassen und Faktoren zu erheben, die eine längerfristige interschulische Kooperation begünstigen.
Diese Studie enthält zusätzliche Informationen als Anhang. Sie können hier heruntergeladen werden
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- TEIL A: THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG
- 1 Der Englischunterricht in Deutschland
- 1.1 Die Entwicklung des Englischunterrichts im deutschen Schulsystem
- 1.2 Bildungspolitische Debatte um den Startzeitpunkt des früh beginnende Englischunterrichts in NRW
- 1.3 Exkurs: Zum Zusammenhang von Unterrichtsqualität und fachfremd unterrichtenden Lehrkräften im Englischunterricht des Primarbereiches in NRW
- 1.4 Ziele des Englischunterrichts im Primarbereich in NRW
- 1.5 Ziele des Englischunterrichts der Sekundarstufe I in NRW
- 1.6 Zusammenfassung des Kapitels
- 2 Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule im Englischunterricht
- 2.1 Der Übergang als allgemeinpädagogisches Phänomen
- 2.2 Gestaltung des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule in NRW
- 2.2.1 Empirische Befunde zum Erleben des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule
- 2.2.1.1 Perspektive der Lehrkräfte hinsichtlich des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule
- 2.2.1.2 Perspektive der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule
- 2.2.1.3 Fazit: Abgeleitete Schlussfolgerungen aus den empirischen Befunden zum Übergangserleben von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern
- 2.3 Gestaltung des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule im Englischunterricht in NRW: Status quo
- 2.3.1 Didaktische Gestaltung des Englischunterrichts an Grundschulen und weiterführenden Schulen
- 2.3.2 Kontinuität im Englischunterricht am Übergang
- 2.4 Empirische Befunde zum Übergang im Englischunterricht: Perspektive der Englischlehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler
- 2.5 Zusammenfassung des Kapitels
- 3 Lehr-Lern-Einstellungen
- 3.1 Definitorische Auseinandersetzung mit Einstellungen
- 3.1.1 Entwicklung und Funktionen von Einstellungen
- 3.1.2 Veränderbarkeit von Einstellungen
- 3.2 Annäherung an das Konzept Lehr-Lern-Einstellungen
- 3.3 Dimensionen der Lehr-Lern-Einstellungen: Transmission, Konstruktivismus, Schülerorientierung und Partizipation
- 3.4 Empirische Befunde zu Lehr-Lern-Einstellungen
- 3.4.1 Prägung von Lehr-Lern-Einstellungen
- 3.4.2 Veränderbarkeit von Lehr-Lern-Einstellungen
- 3.4.3 Einfluss von Lehr-Lern-Einstellungen auf das Verhalten von Lehrkräften
- 3.5 Lehr-Lern-Einstellungen von Lehrkräften der Grundschule und des Gymnasiums
- 3.6 Lehr-Lern-Einstellungen von Englischlehrkräften in Deutschland
- 3.7 Zusammenfassung des Kapitels
- 4 Kooperation von Lehrkräften
- 4.1 Modelle der Lehrerkooperation
- 4.2 Gründe für die Lehrerkooperation
- 4.3 Lehrerkooperation am Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule
- 4.3.1 Rahmenbedingungen und rechtliche Vorgaben der Lehrerkooperation am Übergang in NRW
- 4.3.2 Gelingensfaktoren der Lehrerkooperation
- 4.3.3 Hinderungsfaktoren der Lehrerkooperation
- 4.4 Zusammenfassung des Kapitels
- TEIL B: FORSCHUNG
- 5. Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen der vorliegenden Untersuchung
- 5.1 Erkenntnisinteresse
- 5.2 Forschungsfragen
- 5.2.1 Kommentar zur Forschungsfrage 1
- 5.2.2 Kommentar zur Forschungsfrage 2
- 5.2.3 Kommentar zur Forschungsfrage 3
- 5.3 Zusammenfassung des Kapitels
- 6. Untersuchungsdesign
- 6.1 Qualitative und quantitative Erhebungsmethoden
- 6.2 Gütekriterien
- 6.3 Meine Rolle als Forscherin
- 6.4 Vorbereitung der Untersuchung
- 6.4.1 Entwicklung eines Fragebogens
- 6.4.1.1 Pilotierung der adaptierten Version des 4QTB-Fragebogens
- 6.4.1.1.1 Forschungsdesiderate der Pilotierung
- 6.4.1.1.2 Ziele und Forschungsfragen der Pilotierung
- 6.4.1.1.3 Stichprobe und Design der Pilotierung
- 6.4.1.1.4 Ergebnisse und Erkenntnisgewinn der Pilotierung
- 6.4.2 Darstellung der Fragebögen der vorliegenden Studie
- 6.4.2.1 Formale Gestaltung der Fragebögen
- 6.4.2.2 Inhaltliche Gestaltung der Fragebögen
- 6.4.3 Entwicklung eines Interviewleitfadens
- 6.4.4 Darstellung des Interviewleitfadens der vorliegenden Studie
- 6.4.5 Übersicht: Zusammenhang der Erhebungsinstrumente und der Forschungsfragen
- 6.5 Durchführung der Untersuchung
- 6.5.1 Rekrutierung und Beschreibung der Stichprobe
- 6.5.2 Ort und Zeitraum der Hauptstudie
- 6.5.3 Überblick zu den in der Hauptstudie erhobenen Interview- und Fragebogendaten
- 6.5.4 Informierte Einwilligungserklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- 6.5.5 Vertraulichkeit der Daten
- 6.5.6 Didaktisches Design der Lehrerkooperation
- 6.5.6.1 Darstellung des ersten Netzwerktreffens
- 6.5.6.2 Verlauf des zweiten Netzwerktreffens
- 6.5.6.3 Verlauf des dritten Netzwerktreffens
- 6.5.6.4 Interschulische Hospitationen der Lehrkräfte
- 6.6 Zusammenfassung des Kapitels
- 7. Datenauswertung
- 7.1 Auswertung der Fragebogendaten
- 7.1.1 Aufbereitung der Daten
- 7.1.2 Ablauf der Datenanalyse
- 7.1.3 Gütekriterien der Datenauswertung der Fragebögen
- 7.1.4 Zu erwartender Erkenntnisgewinn aus den Fragebogendaten
- 7.2 Auswertung der Interviewdaten mit der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 7.2.1 Definition der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 7.2.2 Das Kategoriensystem in der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 7.2.3 Aufbereitung der Interviewdaten
- 7.2.4 Auswahl der Software zur Durchführung der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 7.2.5 Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse in der vorliegenden Arbeit
- 7.2.5.1 Festlegung der Einheiten für die Qualitative Inhaltsanalyse
- 7.2.5.1.1 Festlegung der Auswahleinheit
- 7.2.5.1.2 Festlegung der Analyseeinheit
- 7.2.5.1.3 Festlegung der Kodiereinheiten
- 7.2.5.1.4 Festlegung der Kontexteinheit
- 7.2.6 Entwicklung des Kategoriensystems in der vorliegenden Arbeit
- 7.2.6.1 Unterscheidung Oberkategorien und Unterkategorien
- 7.2.6.2 Das Kategoriensystem im Überblick
- 7.2.6.2.1 Oberkategorie 1: Einstellung zum Englischlehren und -lernen am Gymnasium
- 7.2.6.2.2 Oberkategorie 2: Einstellung zum Englischlehren und -lernen an der Grundschule
- 7.2.6.4 Oberkategorie 3: Kooperation (Erfahrungen)
- 7.2.6.5 Oberkategorie 4: Fortgeführte Kooperation
- 7.2.6.3 Das Kategoriensystem und der zu erwartende Erkenntnisgewinn
- 7.2.7 Regeln zur Arbeit mit dem Kategoriensystem
- 7.2.8 Durchführung der Probe- und Hauptkodierungen
- 7.2.9 Arbeit mit der Interkoderin
- 7.2.10 Gütekriterien der Datenauswertung mit der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 7.3 Vertiefende Auswertung durch Fallbeschreibungen
- 7.3.1 Ablauf der Fallbeschreibungen
- 7.3.2 Zu erwartender Erkenntnisgewinn der Fallbeschreibungen
- 7.4 Zusammenfassung des Kapitels
- TEIL C: ERGEBNISDOKUMENTATION
- 8. Ergebnisse der Auswertung der Fragebogendaten
- 8.1 Ergebnisse der adaptierten 4QTB-Skala zu den Einstellungsdimensionen
- 8.2 Ergebnisse der Fragebogendaten zu Gelingensfaktoren der interschulischen Kooperation
- 8.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fragebogendaten
- 9. Interviewdaten: Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 9.1 Analyseergebnis der Oberkategorie 1
- 9.1.1 Analyseergebnis und Interpretation der Unterkategorie 1.1
- 9.1.2 Analyseergebnis und Interpretation der Unterkategorie 1.2
- 9.1.3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation der Oberkategorie 1
- 9.2 Analyseergebnis der Oberkategorie 2
- 9.2.1 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 2.1
- 9.2.2 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 2.2
- 9.2.3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation der Oberkategorie 2
- 9.3 Analyseergebnis der Oberkategorie 3
- 9.3.1 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 3.1
- 9.3.2 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 3.2
- 9.3.3 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 3.3
- 9.3.4 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 3.4
- 9.3.5 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation der Oberkategorie 3
- 9.4 Analyseergebnis der Oberkategorie 4
- 9.4.1 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 4.1
- 9.4.2 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 4.2
- 9.4.3 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 4.3
- 9.4.4 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 4.4
- 9.4.5 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 4.5
- 9.4.6 Analyseergebnis und Interpretation von Unterkategorie 4.6
- 9.4.7 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation der Oberkategorie 4
- 9.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 10. Einzelfalldarstellung der an der vorliegenden Untersuchung teilnehmenden Lehrkräfte
- 10.1 Fallbeschreibung Gym_1
- 10.2 Fallbeschreibung Gym_2
- 10.3 Fallbeschreibung Gym_3
- 10.4 Fallbeschreibung Gym_4
- 10.5 Fallbeschreibung Gym_5
- 10.6 Fallbeschreibung Gym_6
- 10.7 Fallbeschreibung Gym_7
- 10.8 Fallbeschreibung GS_1
- 10.9 Fallbeschreibung GS_2
- 10.10 Fallbeschreibung GS_3
- 10.11 Fallbeschreibung GS_4
- 10.12 Fallbeschreibung GS_5
- 10.13 Zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse der Fallbeschreibungen
- TEIL D: ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK
- 11 Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
- 11.1 Beantwortung der Forschungsfragen
- 11.1.1 Beantwortung der Forschungsfrage 1 (Einstellung zum Englischlehren und -lernen vor der Kooperation)
- 11.1.2 Beantwortung der Forschungsfrage 2 (Einstellung zum Englischlehren und -lernen nach der Kooperation)
- 11.1.3 Beantwortung der Forschungsfrage 3 (Gelingens- und Hinderungsfaktoren einer fortgeführten interschulischen Kooperation)
- 11.1.4 Zusammenfassung: Beantwortung der Forschungsfragen
- 11.2 Limitationen der vorliegenden Arbeit
- 11.2.2 Allgemeine Arbeitsbelastung der teilnehmenden Lehrkräfte
- 11.2.3 Erforschung und Veränderbarkeit von Einstellungen
- 11.2.4 Gestaltung des Forschungsdesigns und Auswahl der Erhebungsinstrumente
- 11.3 Ausblick und Implikationen
- 11.3.1 Aus- und Weiterbildung von Englischlehrkräften
- 11.3.2 Schulorganisatorische Implikationen hinsichtlich interschulischer Kooperationen
- 11.3.3 Curriculare Rahmenbedingungen
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tab. 2:Darstellung der Niveaustufen A1 und A2 des GeR
Tab. 4:Typen der Übergangserfahrungen
Tab. 5:Gegenüberstellende Darstellung der Konstrukte ‚Einstellungen‘ und ‚Wissen‘
Tab. 6:Darstellung der affektiven, kognitiven und Verhaltenskomponente von Einstellungen
Tab. 7:Entwicklung von Einstellungen nach Fishbein und Ajzen
Tab. 8:Stufenmodell des kooperativen Lehrerhandelns nach Steinert et al. (2006)
Tab. 11:Darstellung der Gütekriterien quantitativer und qualitativer Forschung
Tab. 12:Inhaltliche Darstellung der Fragebögen der vorliegenden Studie
Tab. 13:Darstellung der thematischen Blöcke der Interviewleitfäden
Tab. 14:Übersicht zum Zusammenhang von Forschungsfragen und Erhebungsinstrumenten
Tab. 16:Überblick zu den in der Hauptstudie gewonnenen Daten
Tab. 17:Ablaufplan des ersten Netzwerktreffens
Tab. 18:Darstellung der Ergebnisse der Austauschphase I des ersten Netzwerktreffens
Tab. 19:Ablaufplan des zweiten Netzwerktreffens
Tab. 20:Darstellung der drei Aufgabentypen von Bridging-Tasks
Tab. 21:Darstellung der Stationenarbeit im Rahmen des dritten Netzwerktreffens
←21 | 22→Tab. 24:Darstellung des Kategoriensystems und des zu erwartenden Erkenntnisgewinns
Tab. 27:Darstellung der Kodeverteilungen der Oberkategorie 1
Tab. 28:Darstellung der Kodeverteilungen der Oberkategorie 2
Tab. 29:Darstellung der Kodeverteilungen der Oberkategorie 3
Tab. 30:Darstellung der Kodeverteilungen der Oberkategorie 4
Tab. 31:Darstellung der Anzahlen der Kodiereinheiten der Oberkategorien 1 und 2
←22 | 23→Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:Darstellung der Leitziele des Grundschulenglischunterrichts
Abb. 3:Darstellung von kritischen Lebensereignissen nach Filipp (1995)
Abb. 6:Assimilation and accommodation of information nach Pajares (1992: 320)
Abb. 8:Stabile und dynamische Lehr-Lern-Einstellungen (nach Fives & Buehl 2012: 475)
Abb. 9:Modell der Lehrerkooperation in Anlehnung an Gräsel et al. (2006)
Details
- Seiten
- 400
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631867044
- ISBN (ePUB)
- 9783631867051
- ISBN (Hardcover)
- 9783631866931
- DOI
- 10.3726/b19036
- DOI
- 10.3726/b19585
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (März)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 400 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG