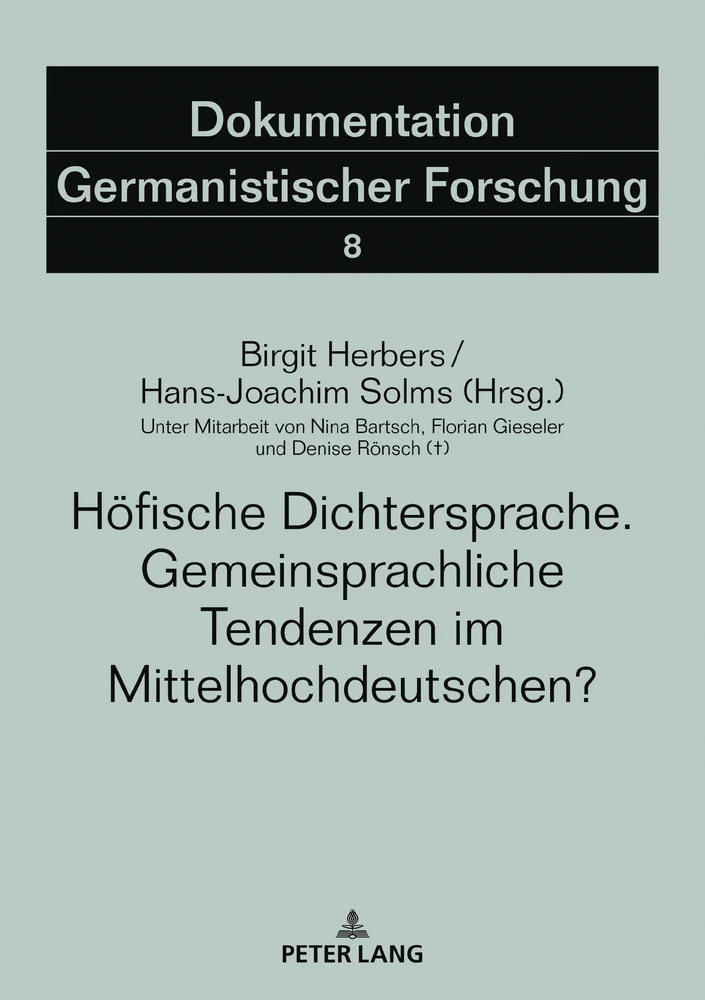Höfische Dichtersprache. Gemeinsprachliche Tendenzen im Mittelhochdeutschen?
Unter Mitarbeit von Nina Bartsch, Florian Gieseler und Denise Rönsch (†)
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Proben der alten ſchwaͤbiſchen Poeſie des Dreyzehnten Jahrhunderts (1748)
- Die Grundſaͤtze der deutſchen Sprache. Oder: Von den Beſtandtheilen derſelben und dem Redeſatze (1768)
- Was iſt Hochdeutſch? (1783)
- Ueber den Deutſchen Styl (1800)
- Der Nibelungen Lied. Anhang (1807)
- Auswahl aus den Hochdeutſchen Dichtern des dreizehnten Jahrhunderts (1820)
- Vorrede zur Deutschen Grammatik (zweite Ausgabe) (1822)
- Einleitung aus der Deutschen Grammatik (dritte Ausgabe) (1840)
- Grundriß der Geſchichte der deutſchen National-Litteratur. Dritte Periode. Von der Mitte des zwoͤlften bis gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts (1847)
- Über Wesen und Bildung der höfischen Sprache in mittelhochdeutscher Zeit (1861)
- Gab es eine mittelhochdeutsche Schriftsprache? (1873)
- Vorrede zu den Denkmälern deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII–XII Jahrhundert (1873/1892)
- Geſchichte der Neuhochdeutſchen Schriftſprache (1875)
- Zur Frage nach einer mittelhochdeutschen Schriftsprache (1886)
- Die mittelhochdeutſche Schriftſprache (1888)
- Heinrich von Veldeke und die mittelhochdeutsche Dichtersprache (1899)
- Die mittelhochdeutsche Schriftsprache (1900)
- Die mnd. schriftsprache und ihre entwicklung (1914)
- Mittelhochdeutsche Grammatik. Einleitung (1921/1979)
- Die mittelhochdeutsche Dichtersprache (1927)
- Die mittelhochdeutſche Schriftſprache (1929)
- Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300 (1932)
- Der stand des germanischen b im anlaut des bairischen und die mittelhochdeutsche schriftsprache (1933)
- Vorwort zur Frühneuhochdeutschen Grammatik I.3,2 / Einleitung zur Frühneuhochdeutschen Grammatik I.1 (1951)
- Das geschichtliche Verhältnis der Schriftsprache zu den Mundarten (1954)
- Mittlere Sprachschichten als Quellen der deutschen Hochsprache (1955)
- Der Weg zur deutschen Nationalsprache (1964)
- Das Deutsch des Hochmittelalters – Mittelhochdeutsch (und Mittelniederdeutsch) (1969)
- Mittelhochdeutsch (1970)
- Die überlieferten Sprachvarietäten (1981)
- Die mittelhochdeutsche „Dichtersprache“ im sprachgeschichtlichen Kontext (1990)
- Die ‚höfische Dichtersprache‘ (2007)
- Die Schimäre einer mittelhochdeutschen Gemeinsprache. Eine grammatikographische Studie auf der Grundlage des Bochumer Mittelhochdeutsch-Korpus (2014)
- Bibliographie
Vorwort
Die Anfänge des vorliegenden Dokumentationsbandes liegen bereits viele Jahre zurück. Die Idee dazu entstand im Zusammenhang der Arbeiten an der auf vier Bände projektierten und inzwischen in zwei Bänden vorliegenden und auf der Grundlage eines strukturierten Korpus erstellten Mittelhochdeutschen Grammatik.1 Es lag in der Natur des grammatikographischen Neuanfangs, dass stets aufs Neue der Begründungszusammenhang erläutert, die theoretische und methodische Notwendigkeit eines Neuansatzes dargelegt werden musste. Insofern gehörte die Auseinandersetzung mit der Lachmann’schen Konstruktion des ‚Normalmittelhochdeutschen‘ sowie die Thematisierung des Mittelhochdeutschen als einer nichtnormalisierten Sprachstufe ohne Existenz einer überdachenden Norm zu den breit und immer wieder diskutierten Voraussetzungen eines neuen Blicks auf das Mittelhochdeutsche. Schnell stellte sich in diesem Zusammenhang heraus, dass in der Diskussion immer wieder zum Problem der ‚mittelhochdeutschen Dichtersprache‘, einer ‚mittelhochdeutschen Gemeinsprache‘, einer ‚mittelhochdeutschen Koine‘ Stellung zu beziehen war, dass immer wieder auf einzelne der zahllosen Beiträge in dieser seit nun gut zwei Jahrhunderten geführten Diskussion zurückgegriffen werden musste. Bis weit in die 2000er Jahre hinein war diese zudem ein beliebtes Examensthema im Rahmen der damaligen Studiengänge (Magister und Staatsexamen), so dass sich die Examenskandidaten mühsam in den Forschungsdiskurs einarbeiten und auf die Suche der zentralen Beiträge zu diesem Diskurs machen mussten. Aus den benannten Zusammenhängen heraus entstand nahezu folgerichtig die Idee, eine entsprechende Dokumentation der im frühen 19. Jahrhundert eingesetzt habenden Forschungsgeschichte zu liefern.
Dass der in den frühen 2000er Jahren gefasste Plan für die nun vorliegende Dokumentation eine solche lange Zeit der Realisierung benötigen würde, war nicht absehbar und ist vielen Ursachen geschuldet. Eine wesentliche Zäsur stellte der uns alle zutiefst erschütternde und alle Lebensgewissheit in Frage stellende frühe Tod unserer jungen studentischen Mitarbeiterin und Freundin Denise Rönsch dar. Denise Rönsch hatte sich mit dem ihr eigenen Engagement und ihrer enormen Begeisterung für das Fach in die Thematik eingearbeitet, hatte Text für Text geprüft, hatte Exposés und Vorschläge für die Aufnahme oder Ablehnung von Texten angefertigt und damit Ordner um Ordner gefüllt. Als sie im August 2009 einer schweren Krankheit erlag, legten wir auch das Projekt dieses Dokumentationsbandes zur Seite und dachten kaum daran, es tatsächlich zu einem Ende zu bringen. Dass wir unser Vorhaben schließlich doch wieder aufgenommen haben, ist wesentlich dem nie erloschenen Dank an Denise Rönsch zu danken, zu deren Gedenken wir das Vorhaben keinen Torso haben werden lassen wollen. Hinzu kam, dass Nina Bartsch aus der Forschungsgruppe zur Erarbeitung der neuen Mittelhochdeutschen Grammatik (Arbeitsstelle Bochum, Prof. Dr. Klaus-Peter Wegera) dem Projekt zur Mittelhochdeutschen Grammatik eine einschlägige Dissertation vorgelegt2 hatte, so dass damit nun ein Neuansatz in der Bewertung der alten Forschungsfrage vorliegt, der es noch einmal nahelegt, die für die Germanistik so wichtige Forschungsdiskussion umfassend zu dokumentieren.
Zu danken haben wir vor allem den Autorinnen und Autoren oder ihren Erben für die bereitwillig erteilten Genehmigungen zum Wiederabdruck der Beiträge, ebenso den Verlagen Erich Schmidt Verlag, Narr Francke Attempto Verlag, Quelle & Meyer Verlag, S. Hirzel Verlag und Verlag Walter de Gruyter. Unser besonderer Dank geht an Rudolf Bentzinger und Werner Besch für die Hilfen bei der Ermittlung von Erbnachfolgen. Zu danken haben wir Nina Bartsch für ihre Zusammenstellung der Forschungsdiskussion, die in unsere Einleitung eingeflossen ist. Florian Gieseler danken wir für gewissenhafte und nachhaltige Zuarbeiten in allen Bereichen. Für die sorgfältige Transkription und Korrektur der Beiträge danken wir neben Florian Gieseler auch Charlotte Herbers und Jana Fritsch. Abschließend danken wir dem Verlag Peter Lang für die Aufnahme des Bandes in die Reihe Dokumentation Germanistischer Forschung.
1 Klein, Thomas/ Solms, Hans-Joachim/ Wegera, Klaus-Peter (Hrsg.): Mittelhochdeutsche Grammatik. Teil III. Wortbildung. Tübingen 2009; Teil II. Flexionsmorphologie. 2 Bände. Berlin/ Boston 2018.
2 Bartsch, Nina: Programmwortschatz einer höfischen Dichtersprache. hof/ hövescheit, mâze, tugent, zuht, êre und muot in den höfischen Epen um 1200. (Deutsche Sprachgeschichte, Texte und Untersuchungen 4). Frankfurt a.M. u.a. 2014.
Einleitung
1. Zur historischen Situierung
Seit dem Beginn einer akademischen Germanistik im frühen 19. Jahrhundert gehörte die Frage nach der Herausbildung und Existenz einer über den Dialekten stehenden Gemein- oder Hochsprache1 zu ihren zentralen Forschungsgegenständen. Dabei war das Interesse daran seit dem frühen 19. Jahrhundert wesentlich politisch motiviert und zielte erststellig auf die eigene Sprachwirklichkeit und also auf die sog. ‚Neuhochdeutsche Schriftsprache‘.2 Damit nahm man insbesondere den historischen Zeitraum ab Martin Luther und der Reformation in den Blick.3
Seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon (1813–1815) hatte sich die Idee eines ‚geeinten‘ Deutschland als bürgerlich-republikanisches Projekt herausgebildet und dabei insbesondere die Funktion der Sprache fokussiert. So hatte schon Justus Georg Schottel, der bedeutendste deutsche Grammatiker des 17. Jahrhunderts, erklärt, dass „die Nationalsprache zur Grundlage eines funktionierenden Staatswesens“ gehöre.4 Ganz ähnlich sahen dann im darauffolgenden 18. Jahrhundert u.a. auch der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz und der Aufklärer Christian Wolff in der „Ausbildung der dt. […] Sprache […] eine Voraussetzung für die Herausbildung einer künftigen dt. Nation“.5 Diese im 18. Jahrhundert noch als künftig erhoffte bzw. prognostizierte ‚deutsche Nation‘ sollte nun im 19. Jahrhundert zur politischen Wirklichkeit werden, nachdem sich in den napoleonischen Befreiungskriegen eine „die Einzelstaaten überspannende Öffentlichkeit“6 und ein „Nationalbewußtsein“ herausgebildet hatte, „in dem Deutschland nicht mehr als ein Gefüge von Grafschaften, Städten und Fürstentümern erschien, sondern als etwas Zusammenhängendes“.7 Jacob Grimm konstatierte, dass „in allen edlen schichten der nation [eine] anhaltende und unvergehende sehnsucht entsprungen [war] nach den gütern, die Deutschland einigen und nicht trennen […]“.8 Als Symbol für dieses ‚einige‘ und zusammenhängende ‚deutsche Vaterland‘ hatte Ernst Moritz Arndt schon 1813 in seinem Lied ‚Des Deutschen Vaterland‘ die eigene, die deutsche Sprache benannt.9 Wie kein anderer Text der Zeit zeigte dieses Lied einen wirksam werdenden „politisierten Kulturnationalismus“,10 der schließlich auch die Revolution und das sich anschließende Paulskirchenparlament von 1848 fundierte. Im Zusammenhang der hier ausgetragenen politischen Auseinandersetzung um einen deutschen Nationalstaat und der sich zwangsläufig daraus ergebenden Frage nach einem ‚deutschen Staatsvolk‘ erwies sich der programmatisch formulierte Zusammenhang zwischen der gemeinsamen Sprache und dem als Einheit zu schaffenden staatlichen Gebilde ganz besonders bei Jacob Grimm und seiner berühmt gewordenen ‚einfachen‘ Frage nach dem, was denn ein Volk sei. Seine ebenso einfache Antwort lautete: „es ist ein inbegriff von menschen, welche dieselbe sprache reden“.11 Ganz im Sinne dieser Bestimmung stellt Jacob Grimm schließlich im Vorwort seines Deutschen Wörterbuchs die rhetorisch zu verstehende Frage: „was haben wir denn gemeinsames als unsere sprache und literatur?“.12 In der Überzeugung Grimms waren sie es, über die sich Gemeinschaftlichkeit, Identität und Beheimatung historisch bereits seit langer Zeit ergeben hatten. Erst „kraft der schriftsprache“, so schrieb Grimm, „fühlen wir Deutsche lebendig das band unserer herkunft und gemeinschaft“.13 Und also proklamierte er die Sprache und Literatur als wesentliche Instrumente, deren sich ein ‚politisierter Kulturnationalismus‘ argumentativ bedienen sollte, um die schon lange existierende Kulturnation nun auch politisch zu realisieren. Aus dieser Hochschätzung von Sprache und Literatur ergab sich zwangsläufig, dass die akademische Germanistik einen nicht in Zweifel gezogenen Status einer nationalen Disziplin erhielt und die Forschungen zur einigenden Hochsprache aus diesem Kontext heraus ein zentrales Anliegen der Germanistik wurden.
Über den historisch einengenden Blick auf das Neuhochdeutsche und seine (vermuteten) Anfänge im Wirken Martin Luthers hinaus wurde aber zugleich schon auch hinsichtlich der ‚alten‘ deutschen Text- und Sprachgeschichte festgehalten, dass sie ein ebensolch politisch motiviertes Interesse befriedigte. So schrieb Jacob Grimm in der seine Deutsche Grammatik von 1819 einleitenden Zueignung „An Herrn Geh. Justizrath und Professor von Savigny zu Berlin“ über die ‚altdeutsche Literatur‘, dass „sie gerade durch die letzte feindliche Unterjochung14 für viele Gemüther Gegenstand des Trostes und der Aufrichtung geworden war“.15 Damit scheint für Jacob Grimm eine Kontinuität der Entwicklung selbstverständlich, die nicht erst in der neuen Zeit bei Luther begonnen hatte, sondern ihren Ursprung weit früher finden konnte, eine Erkenntnis, von der er jedoch schrieb, dass sie nicht allgemein anerkannt war: „Die Grammatiker [des Neuhochdeutschen aber …] bekümmerten sich selten oder gar nicht um die Denkmäler der mittleren geschweige der alten Zeit, sondern achteten höchstens auf das nächstvorhergehende […]“.16 Grimm war überzeugt, dass sich das Ansetzen von eigenständigen Epochen in der deutschen Literatur- und Sprachgeschichte dadurch ergebe, dass in der jeweiligen Zeit eine entsprechend entwickelte Literatur dann auch zu entsprechenden „niedersetzungen der sprache“17 geführt hatte. Wenn er weiterhin ausführte, dass die Literatur „im zwölften, dreizehnten [Jahrhundert …] aufblühend“18 gewesen war, dass hier eine „sprachregel“ entwickelt worden war, die von späteren Schriftstellern ‚vergröbert‘ wurde, indem sie „sich sorglos den einmischungen landschaftlicher gemeiner mundart“ überließen,19 dann ist deutlich, dass der für das Neuhochdeutsche konstatierte Status bereits auch für das Mittelhochdeutsche angenommen werden musste, waren doch zu dieser Zeit schon „die älteren mundarten verschwommen und aufgelöst, [klebte doch] nur noch einzelnen wörtern oder formen […] landschaftliches an“,20 so dass man durchaus von einer „über dem landschaftlichen gebrauch in der höhe schwebenden deutschen schriftsprache“ sprechen konnte.21
Aus einer solchen, die gesamte Sprach- und Literaturgeschichte des Deutschen in den Blick nehmenden Einschätzung wird deutlich, dass das im frühen 19. Jahrhundert breit und d.h. gesamtgesellschaftlich einsetzende Interesse an einer deutschen Gemeinsprache und das parallel dazu aus der Fachwissenschaft rührende Interesse an ihrer geschichtlichen Entwicklung dazu führten, dass auch die Frage nach einer früheren und der gegenwärtigen neuhochdeutschen bereits einmal vorausgegangen Gemeinsprache zu einer zentralen Forschungsfrage der Germanistik wurde und auch über das 19. Jahrhundert hinaus blieb.22 Dabei erweist sich die für die Germanistik bis heute beibehaltene Aktualität der Forschungsfrage nicht zuletzt an ihrer Berücksichtigung im akademischen Unterricht, ablesbar an einer Thematisierung in einschlägigen Einführungen in das Mittelhochdeutsche. Zu nennen sind die beliebten Einführungen von Rolf Bergmann et al. sowie von Thordis Hennings.23 Dabei fällt allerdings auf, dass entsprechende Wertungen in den vergangenen Jahren zunehmend vorsichtiger ausgefallen sind. So findet sich in der Erstauflage der Einführung von Thordis Hennings gegenüber der aktuell vorsichtigeren Formulierung noch die Aussage, dass sich „um die Wende vom 12./13. Jh. […] so etwas wie eine überregionale höfische Dichtersprache [entwickelte], die dadurch gekennzeichnet ist, daß dialektale Besonderheiten stark zurückgedrängt werden. Diese mhd. klassische ‚Einheitssprache‘ beruht vor allem auf alemannischer und ostfränkischer Grundlage“.24 Hier zeigt sich deutlich die Entwicklung der rezenten Forschung, der die entsprechenden Lehrbücher folgen.
2. Die Forschungsgeschichte, ein Überblick25
2.0 Vorbemerkung
Seit Beginn der akademisch-wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Mittelhochdeutschen gehört die Frage nach einer bereits in dieser Zeit oberhalb der Mundarten liegenden überregional geltenden Gemeinsprache zum Repertoire der Forschung, bereits früh wurde die Existenz einer höfischen Dichtersprache diskutiert. Bis heute enthält fast jede Sprachgeschichte zum Deutschen oder Einführung in die mittelhochdeutsche Sprachepoche Äußerungen zu dieser Forschungsfrage. Gegenwärtig gehen die Aussagen zu dieser Frage jedoch selten über eine bloße Nennung und/ oder kurze Positionierung hinsichtlich der Existenz der höfischen Dichtersprache hinaus.
Die Geschichte dieser Forschungsfrage umfasst einen langen Zeitraum, die Hauptphase und -emphase des Diskurses liegt im 19. Jahrhundert und reicht bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit entstand eine große Anzahl an Forschungsbeiträgen, die sich außerdem teilweise aufeinander beziehen und in denen die Debatte kontrovers und mitunter hitzig geführt wurde. Nach dieser Phase der intensiven Auseinandersetzung hat sich die Diskussion seit der Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend beruhigt, es herrscht mehrheitlich Konsens darüber, dass eine tendenzielle Überregionalität lediglich auf lexikalischer Ebene und zudem wesentlich in versgebundenen Texten der sog. ‚klassischen‘ Zeit vorhanden ist. Im 21. Jahrhundert entstanden bisher nur vereinzelt Beiträge, die sich mit dieser Forschungsfrage beschäftigen.26 Die lange Zeit der Beschäftigung mit einer möglicherweise einheitlichen Dichtersprache ist zudem durch eine terminologische Unschärfe und voneinander abweichende konstituierende Kriterien geprägt.
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Stationen dieser Forschungsgeschichte mit ausführlicher Einleitung begründet die Herausgabe dieser Dokumentation in der Reihe Dokumentation Germanistischer Forschung. Dabei sind vornehmlich Beiträge berücksichtigt, die sich explizit mit Schriftlichkeit im Sinne einer Gemeinsprache auseinandergesetzt haben. Aus der nahezu unübersichtlichen Vielzahl von Beiträgen, die sich in der frühen Zeit bis in die Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts zentral oder auch nur am Rande mit der mittelhochdeutschen Dichter- bzw. Gemeinsprache beschäftigt haben, musste eine Auswahl getroffen werden: Es wurden diejenigen Originalarbeiten aufgenommen, die einen eigenen Ansatz bzw. eine eigenständige neue Perspektive in die Diskussion eingebracht haben oder eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema aufweisen und auch in späterer Forschung rezipiert wurden.27
Auf lediglich referierende Beiträge wurde weitgehend verzichtet, es sei denn, dass sie in ihrer jeweiligen Entstehungszeit grundlegendes und insbesondere im akademischen Unterricht gängig rezipiertes Handbuchwissen lieferten (dies gilt u.a. für die Beiträge von Wilhelm Schmidt, Gabriele Schieb oder Norbert Richard Wolf). Des Weiteren sind keine Beiträge abgedruckt, die bereits in Band 7 der Reihe Dokumentation Germanistischer Forschung ‚Die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache‘ (hrsg. von Klaus-Peter Wegera, 2., erweiterte Aufl. 2007) enthalten sind, auch wenn die dort erneut publizierten Arbeiten oftmals ebenfalls Aussagen zu einer möglichen mittelhochdeutschen ‚Schriftsprache‘ enthalten. In jedem Fall weist die den Schlussteil des vorliegenden Bandes bildende, umfassende Bibliographie alle inhaltlich einschlägigen Beiträge aus.
Bei den weitaus meisten der aufgenommenen Originalbeiträge handelt es sich um umfangreichere Arbeiten, innerhalb derer die Diskussion der hier dokumentierten Forschungsfrage nur einen mehr oder weniger zentralen Anteil hat. Da aber nur diese für die vorliegende Dokumentation von Interesse sind, mussten jeweils aussagekräftige Textpassagen ausgewählt werden. Diese wurden so ausgesucht, dass der argumentative Zusammenhang, dass der Kontext, aus dem heraus eine Einschätzung versucht wurde, jeweils deutlich wird. Dies bedingt, dass z.T. umfänglichere Textpassagen aufgenommen wurden, obwohl die jeweilige und für den hier vorliegenden Zusammenhang wesentliche Aussage dann nur wenige Zeilen ausmacht. Man wäre jedoch den einzelnen Autoren und ihrem Anliegen nicht gerecht geworden, hätte man nur wenige ihrer Textzeilen plakativ herausgelöst.
2.1 Der Forschungsgegenstand
Obwohl die seit gut 200 Jahren anhaltende, akademische Forschungsgeschichte um eine über den Dialekten liegende und also überregional gültige mittelhochdeutsche ‚Gemeinsprache‘28 erst mit Jacob Grimm und Karl Lachmann einsetzte, lässt sich eine vorausgehende Phase der Befassung mit der ‚altdeutschen Literatur‘ beschreiben, bei der in unterschiedlicher Weise für die Zeit des 12./13. Jahrhunderts schon auch eine Tendenz zur Gemeinsprachlichkeit angesprochen wird. Dabei bleibt völlig offen, ob es sich um eine nur in der Schriftlichkeit ausweisende Entwicklung gehandelt haben mag, oder ob auch die gesprochene Sprache – in welcher Ausprägung auch immer – davon betroffen gewesen sei.
So „war es Bodmers Vorliebe, den zeitgenössischen Dichtern Wortgebrauch und Satzbau der mittelhochdeutschen höfischen Dichtung […] zur Nachahmung zu empfehlen“,29 was darauf hindeutet, dass Bodmer (1748) bei den entsprechenden Dichtern eine sprachlich-stilistische Gemeinschaftlichkeit annahm. Indem er sogar von der ‚alten Idioma‘30 sprach, scheint deutlich, dass bei ihm die Vorstellung einer solchen über den Mundarten vorhandenen Gemeinsamkeit oder Einheitlichkeit vorlag. Bodmer erkannte eine herrschende „Schwäbische Kaiserliche Hofsprache“,31 die schon durch jene „Einrichtung, Ordnung und Anwendung der Wörter“ gekennzeichnet war, die schließlich „Luther bey seiner Ankunft in die Welt vor sich gefunden“.32 In der Folge Bodmers war es Adelung (1783), der eine „Aushebung des Allgemeinsten und Besten aus allen Mundarten“ schon vor einem „Hochdeutsch“ des 16. Jahrhunderts in der schwäbischen ‚Schriftsprache‘ sah.33 Besonders Schwaben hatte sich, so Adelung, „an Wohlstand, Kunstfleiß und Geschmack hervorgethan“, so dass allein dies bereits dazu geführt hätte, „daß dessen Mundart Deutschlands Schriftsprache geworden seyn würde“; durch die Übertragung der Kaiserwürde an die Staufer „war die Verbreitung freylich schneller und allgemeiner, und die Schwäbische Mundart der obern Classen ward unter dem Nahmen des Hochdeutschen, d. i. des höhern, weiter ausgebildeten oder verfeinerten Deutschen, die allgemeine Schriftsprache für ganz Deutschland.“34 Diese von der Sprache ausgehende Beurteilung wurde durch Friedrich Heinrich von der Hagen um eine Perspektive ergänzt, bei der es allein und ausschließlich um den besonderen Wert der Literatur ging, und zwar ganz im Sinne des späteren Votums Helmut de Boors,35 dass in der Zeit des 12./13. Jahrhunderts zum ersten Mal „deutsche Dichtung Kunst“ wurde. In seiner insbesondere auch für die folgende Editionsphilologie sehr wirkungsmächtigen Arbeit zum Nibelungenlied sah von der Hagen36 in der Literatur der ‚schwäbischen Zeit‘ ebenfalls eine sprachliche Vorbildlichkeit und auch Homogenität, die aber nur begrenzt als eine grammatische gemeint war. Vielmehr war eine als besondere ‚Poetizität‘37 zu beschreibende Qualität von Sprache gemeint, die sich u.a. in Metrum, Reim, besonderer Wortverwendung und Syntax sowie der Befolgung entsprechender rhetorischer Prinzipien erweist. Damit meinte von der Hagen eine bestimmte Form des Deutschen, die Thorsten Roelcke als primär ästhetisch definierte „Literatursprache3“ („eine sprachliche Varietät, die in einer Kultur als poetisch angesehen wird“) von einer „Literatursprache2“ absetzt, die eine ‚überregionale einzelsprachliche Varietät‘ darstellt und eine u.a. „im Gegensatz zu Dialekten überregionale […] Verbindlichkeit zeigt“.38
Nach Bodmer, Adelung und von der Hagen waren es dann im Zusammenhang einer sich akademisch etablierenden Germanistik Jacob Grimm und Karl Lachmann, mit denen die späterhin an den Universitäten fortgesetzte akademische Diskussion um eine mittelhochdeutsche ‚Gemeinsprache‘ begann. Mit ihren Ausführungen gaben sie zugleich auch die Perspektiven vor, unter denen dieser Forschungsgegenstand in den kommenden Jahrzehnten untersucht werden sollte, insofern jeder folgende Diskussionsbeitrag versuchte, Grimms und Lachmanns Überlegungen zu stützen oder aber zu widerlegen. Jacob Grimm eröffnete die Diskussion, indem er bereits für das 12./13. Jahrhundert eine „allgemeine sprache“ feststellte: „Im zwölften, dreizehnten jahrh. waltet am Rhein und an der Donau, von Tyrol bis nach Hessen schon eine allgemeine sprache, derer sich alle dichter bedienen; in ihr sind die älteren mundarten verschwommen und aufgelöst, nur noch einzelnen wörtern oder formen klebt landschaftliches an“.39 Betreffs der landschaftlichen Grundlage dieser ‚allgemeinen Sprache‘ äußert sich Grimm jedoch nicht.40 Ähnlich hatte sich auch Karl Lachmann geäußert: „Denn wir sind doch eins, daß die Dichter des dreizehnten Jahrhunderts, bis auf wenig mundartliche Einzelheiten, ein bestimmtes unwandelbares Hochdeutsch redeten, während ungebildete Schreiber sich andere Formen der gemeinen Sprache, theils ältere, theils verderbte, erlaubten.“41
Der hier formulierte Gegensatz zwischen den Mundarten des Mittelhochdeutschen und einer allgemeinen, nicht nur geschriebenen, sondern nun auch explizit als gesprochen angenommenen hochdeutschen Sprache der gesellschaftlichen Eliten galt von nun an als gesetzt; die in Texten auftretende Vermeidung mundartlicher Formen wurde zum primären Kennzeichen einer bewusst gewählten, einer höfischen Sprache. Eine solche war, so die These Karl Lachmanns, den höfischen Dichtern eigen, ihre Dichtungen waren in ihrem jeweiligen ‚Originalzustand‘ in dieser höfischen Sprachform geschrieben und erwiesen damit auch eine entsprechende Bildung ihrer Autoren. Wenn man dann jedoch in der Wirklichkeit der Textüberlieferung feststellen musste, dass auch und ganz selbstverständlich mundartliche Formen vorkamen, erklärte Lachmann dies als ‚verderbte‘ Sprache, die allein durch jeweils ‚ungebildete‘ Schreiber verursacht war. Mit dieser Feststellung wurde nun auch die Frage berührt, in welcher Weise die Textausgaben, an denen man arbeitete, dann nicht auch die als gegeben behauptete, ursprüngliche und durch die Dichter verantwortete sprachliche Form aufweisen sollten. Damit wurde ein philologischer Anspruch formuliert, der nicht die handschriftliche Überlieferung zur Grundlage von Textausgaben erklärte, sondern ein durch die Philologie ‚rekonstruiertes Original‘. Hiermit erweiterte sich die Frage nach einer schon im Hochmittelalter vorhandenen ‚Gemeinsprache‘ hin zur Rechtfertigung einer ‚Normalsprache‘, hin zu dem in den folgenden Grammatiken, Wörterbüchern und Textausgaben verwendeten ‚klassischen Mittelhochdeutschen‘, dem ‚Normalmittelhochdeutschen‘. Damit wurde die Frage nach einer mittelhochdeutschen ‚Gemeinsprache‘ in der auf Lachmann und Grimm folgenden Diskussion immer auch wieder gekoppelt an die Frage der Existenz eines ‚Normalmittelhochdeutschen‘ und der Berechtigung, dieses zur Grundlage des in Grammatiken, Wörterbüchern und Textausgaben repräsentierten Wissens um das Mittelhochdeutsche zu machen.
Die allgemeine Wertung einer den Dichtern eigenen ‚höfischen‘ und also mundartfernen Sprache wurde allerdings sowohl bei Jacob Grimm als auch bei Karl Lachmann hinsichtlich der Autoren der Zeit differenziert. Für Grimm waren es besonders Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg, deren Werken er einen diesbezüglich besonders hohen Wert zuschrieb. Demgegenüber attestierte er Heinrich von Veldeke, dass er die sprachlichen „eindrücke seiner heimath […] nicht [habe] verwinden“ können.42 Auch habe die bei den höfischen Dichtern gepflegte Sprachregel bereits in der epigonalen nachklassischen Zeit eine stufenweise erfolgende Vergröberung und ein Verfallen in landschaftlich gemeine Mundarten erfahren.43 Dieser von Jacob Grimm vorgenommenen Einschätzung entsprach auch jene bei Karl Lachmann.44
Infolge der Forschungen Grimms und Lachmanns galt die Existenz einer höfischen Dichtersprache unter den deutschen Philologen nun lange Zeit als anerkannte Tatsache, auch, dass diese auf schwäbisch-alemannischer Grundlage entwickelt worden sei.45 Dies bezog sich auch auf die Auswahl oder Wertung der Autoren, von denen man insbesondere annahm, dass sie sich dieser Dichtersprache in ihren Werken bedienten. Die diesbezüglichen Forschungen konzentrierten sich zuerst hauptsächlich auf exemplarische oder vergleichende Untersuchungen zur Reimpraxis der einzelnen Dichter und zu sprachlichen Analysen einzelner Texte der höfischen Epik. Damit zielte man nicht nur auf eine entsprechende Kenntnis der behaupteten ‚Dichtersprache‘, sondern leistete erststellig den ganz praktischen, textkritischen Versuch, aus der ‚verderbten‘ Textüberlieferung auf den ‚originalen‘ Autortext zu schließen: „Wir fordern also critische ausgaben, keine willkürliche critik, eine durch grammatik, eigenthümlichkeit des dichters und vergleichung der handschriften geleitete“.46 Schon 1819 hatte Jacob Grimm bezüglich der notwendigen Textkritik gefordert, dass es hierin „keine andere practische Richtung der Critik geben [kann], als die in das Wesen jedes einzelnen Schriftstellers zu dringen und ihn von den Flecken fehlerhafter Abschriften zu säubern“.47 Den Schlüssel sah Grimm neben u.a. der Untersuchung der jeweiligen dichterischen Wortverwendung wesentlich in den entsprechenden Reimuntersuchungen: „Ein haupthülfsmittel gewährt, wie vorhin bemerkt, der reim; wer sich mit reimweise, spracheigenheiten und wortreichthum eines bedeutenden dichters vertraut gemacht, und alle seine vorhandenen schriften studiert hat, wird eine ausgabe wagen dürfen, die sich handschriftlichen verderbten lesarten zu widersetzen befugt ist.“48
2.2 Grundlagen der Diskussion
In den Forschungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging es zumeist darum, entweder die höfische Dichtersprache genauer zu bestimmen oder die von Grimm und Lachmann entwickelte These einer tatsächlich auch an den Höfen gesprochenen, hochdeutschen Literatursprache zu widerlegen.
Eine Lachmann und Grimm entschieden unterstützende Einschätzung, die in der Folge eine vielfache und zumeist positive Bezugnahme erfuhr, lieferte August Koberstein.49 Koberstein hatte eine klare Meinung über die Entstehung der höfischen Dichtersprache und sah ihre Ursachen vor allem in den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen der entstandenen Literatur. In zeitlicher und letztlich auch kausaler Koinzidenz zur Herrschaft der Hohenstaufen sah er in der „Poesie“ eine für siebzig Jahre (1170–1240) andauernde „Blüthe“ der „deutsche[n] National-Litteratur“, wohingegen sich die „Prosa […] viel weniger reich und glänzend“ entwickelte.50 Die von ihm nicht in Zweifel gezogene schwäbische Grundierung dieser „reinmittelhochdeutsche[n] Sprache“ hatte sich letztlich durch eine politisch-gesellschaftliche Entwicklung ergeben, „nachdem sie als die angeborne Mundart der Hohenstaufen mit deren Thronbesteigung die Sprache des kaiserlichen Hofes geworden war“.51 Koberstein machte damit für die folgende Forschungsdiskussion deutlich, insbesondere die außerhalb der Dichtung und ihrer sprachlich-formalen Gestaltung liegenden Bedingungen für die Herausbildung einer als vorbildlich geltenden Sprache zu berücksichtigen.
Eine erste Differenzierung der bis dahin gängigen Einschätzung der Existenz einer „von der Sprache des Volkes vielfach verschieden[en]“ Sprache, die zudem „an den Höfen und in den Dichtungen herrschte [… und] zur Unterscheidung von den Volksmundarten die höfische, die Hofsprache genannt“52 wurde, leistete Franz Pfeiffer. Als besonders bemerkenswert darf in diesem Zusammenhang seine polemische Wertung gelten, dass die Annahme, „dem staufischen Kaiserhause einen bedeutenden Einfluss auf die Entwickelung der höfischen Sprache und Poesie“ zuzuschreiben, „wenig mehr als ein schöner Wahn“ sei.53 Und so kritisierte er die Verortung dieser ‚Hofsprache‘ in den schwäbisch-alemannischen Raum, insofern die bisherige Forschung es versäumt hätte, zu beschreiben, „worin denn das eigentliche Wesen, das Gemeinsame, Allgemeingiltige dieser Hofsprache bestand, und was sie von den Mundarten, von der Sprache des niedern Volkes unterscheidet“.54 Diesen Mangel zu beseitigen, legte er eine entsprechende Studie vor und gelangte aufgrund einer Analyse des Vokalismus zu dem Schluss, dass das Schwäbische seiner Rückständigkeit wegen nicht, wie bisher angenommen, die Grundlage einer Schrift- und Dichtersprache sein könnte.55 Dass man bisher und ohne Erweisung aus entsprechenden Untersuchungen die Grundlage im Schwäbisch- Alemannischen gesehen habe, erklärte er durch die bisher „in der Grammatik wiederfahrene [sic!] Auszeichnung“ des Schwäbisch-Alemannischen.56 Dabei ging es Pfeiffer aber nicht darum, die Existenz dieser Dichtersprache infrage zu stellen, sondern zu zeigen, dass die behauptete Gemeinsamkeit der entsprechenden Texte sich „lediglich auf die Flexions- und Ableitungssylben“ bezog57 und das Wesen der höfischen Dichtersprache hauptsächlich in der Abschwächung der Nebensilbenvokale zu „tonlosem und stummen e“58 und einer weitgehend einheitlichen Flexion bestand.59 Dass die mittelhochdeutschen Epiker aufgrund des literarischen Wertes ihrer Werke eine entsprechende Strahlkraft ausübten, war auch für Pfeiffer unstrittig, fand jedoch, dass neben dem Alemannischen auch fränkische Elemente an der Bildung der Schriftsprache beteiligt waren.
Die forschungsgeschichtlich weitreichendste und auch grundlegendste Kritik an der These einer allgemeinen mittelhochdeutschen ‚Hofsprache‘ formulierte schließlich Hermann Paul.60 Dies galt insbesondere hinsichtlich der der bisherigen Forschung eigenen Grundannahme, „dass eine reiche, blühende, organisch zusammenhängende litteratur unter einem verschiedene mundarten redenden volke notwendig eine einheitliche sprache erzeugen müsste und ohne dieselbe gar nicht bestehen könnte“.61 Ihm gelang es u.a. durch Neuinterpretation von „drei dichterstellen62 […], welche gewöhnlich als direkte zeugnisse für die existenz der schriftsprache angeführt werden“,63 darzulegen, „dass aus diesen stellen kein zwingender grund für die existenz der schriftsprache entnommen werden kann“.64 Sollte es die Schriftsprache im Sinne „einer von den volksmundarten verschiedenen sprache der gebildeten“65 tatsächlich gegeben haben, so argumentierte Paul, hätte sie sich in der Überlieferung erweisen müssen. Seine Prüfung ergab eine „mundartliche verschiedenheit der handschriften“, die, so Paul, tatsächlich auch von „niemand geläugnet“ wurde.66 Der Unterschied läge jedoch in der Wertung dieses Sachverhalts. Denn die gegenüber der bisherigen Forschung entscheidende Verschiedenheit in der Wertung dieses Sachverhalts war, dass darin keine durch ungebildete Schreiber entstandene ‚verderbte‘ Sprache (so Lachmann) gesehen werden konnte, sondern allein die ganz selbstverständliche regionale/ dialektale Gebundenheit auch der geschriebenen Sprache. Schließlich fasste Paul in seiner Argumentationskette „einige einzelne punkte in’s auge […], von denen behauptet wird, dass sich darin ein einfluss der schriftsprache zeige“.67 Alles in allem, so war Paul überzeugt, hatte er nachweisen können, „dass es unberechtigt ist mit dem vorurteil an die mittelhochdeutsche literatur heranzutreten, es müsse eine einheitliche sprache gegeben haben“ und dass die „herrschaft der mundarten […] das natürliche und zunächst vorauszusetzende [ist], [dass] die schriftsprache […] erst erwiesen werden [muss], und […] der beweis noch von niemand erbracht [worden ist]“.68
Noch vor Hermann Paul hatte Karl Müllenhoff,69 auf den Paul mehrfach und prominent Bezug nahm,70 eine gänzlich andere Position eingenommen. Müllenhoff argumentierte politisch-historisch und formulierte, dass schon die politische Einheit des Reiches unter Karl dem Großen auch zu Vereinheitlichungstendenzen in Sprache und Schrift geführt hatte, so dass sich schon in karolingischer Zeit eine karolingische Hofsprache entwickelt hatte. Mit dem Wechsel des Kaisergeschlechtes und auch der zentralen Orte wären im 11. Jahrhundert Ausgleichstendenzen eingetreten, wobei das Hochfränkische über einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der oberdeutschen Hofsprache verfügte und so maßgeblich die literarische Blütezeit des 12. und 13. Jahrhunderts bestimmte.71
Ganz im Sinne Grimms und Lachmanns sah Heinrich Rückert72 die entscheidende Wende zugunsten einer Mundartlichkeit vermeidenden ‚Gemeinsprache‘ in der Literatur mit Hartmann von Aue gegeben: „Fast alle Denkmäler der deutschen Literatur bis zu Hartmann […] tragen das Merkzeichen ihrer Ortsangehörigkeit an der Stirne“.73 Seine Sprache stellte für Rückert das „älteste Mittelhochdeutsch“ dar.74 Für Rückert war sie eine aus „bewußtem Kunstgefühl“75 geschaffene „Schriftsprache“76 und trug „jenen Stempel der Einheit, der sie als Gemeinsprache bezeichnen lässt“.77 Entstanden war sie in einem engen Kontext zur Herausbildung des deutschen Rittertums in Anlehnung an das französische Vorbild und die politische Entwicklung im Kaiserreich, das Rückert als politische Einheit im engeren Sinne verstand. So wie er den Beginn der mittelhochdeutschen Gemeinsprache in den Kontext der kulturellen Entwicklung gesetzt hatte, setzte Rückert dann auch ihr Verschwinden mit der sinkenden Bedeutung des Adels im Spätmittelalter in Beziehung. Rückerts Argumentation, die sicherlich stark durch die politische Einigung Deutschlands im 19. Jahrhundert und die Gründung des Kaiserreiches 1871 beeinflusst war, beschränkte sich auch durch die starke Orientierung an Lachmann hauptsächlich auf die Reproduktion bestehender Forschungsergebnisse.
Adolf Socin78 schloss sich ebenfalls weitgehend der Argumentation Lachmanns und Grimms an und betonte damit auch die notwendigen kulturellen Voraussetzungen. Sie zu klären, war für Socin eine Hauptaufgabe zur Klärung der Frage: „Gab es eine mittelhochdeutsche Schriftsprache?“79 Ganz im Sinne Grimms sah Socin „die mittelhochdeutsche Dichtersprache […] durch die Entfaltung der Kunstpoesie im zwölften und dreizehnten Jahrhundert und den über die Landesgrenzen hinaus sich erstreckenden litterarischen Verkehr“ und d.h. durch einen literarischen Austausch zwischen den Dichtern entwickelt.80 Die Voraussetzung für eine in der Literatur verwendete und von dort auch verallgemeinerte Sprachform sah Socin in Übereinstimmung u.a. zu Müllenhoff in einem entsprechenden Idiom des höfischen Umgangs, vorgebildet am kaiserlichen Hof.81 Letztlich ging Socin in seiner Argumentation u.a. mit Lachmann, Müllenhoff und Rückert konform und kam dementsprechend zu den bereits dort erarbeiteten Einsichten. Unklar bleibt seine Begrifflichkeit, in der Dichtersprache, Schriftsprache, Literatursprache, Gemeinsprache nicht eindeutig getrennt werden.
2.3 Differenzierung der Diskussion
Zum ausgehenden 19. Jahrhundert hin wurden die Forschungsansätze facettenreicher und die Debatte entspannte sich zu einer umfassenden Diskussion, in deren Verlauf nicht immer nur sachlich, sondern zuweilen auch polemisch argumentiert wurde. Dabei standen weiterhin zwei grundlegende Positionen einander gegenüber: Auf der einen Seite diejenigen, die eine höfische Dichtersprache aus der Tatsache herausragender literarischer Werke und einer dort obwaltenden Kunstpoesie ableiteten, die sich durch einen spezifischen artifiziellen sprachlichen Gestaltungswillen definierte. Dieser Position war immer auch die Annahme eigen, dass es sich bei der höfischen Dichtersprache um eine tatsächlich gesprochene hochdeutsche Sprache der höfischen Elite handelte. Auf der anderen Seite wurden in den Texten vorhandene Gemeinsamkeiten auf sprachlicher Ebene durchaus anerkannt, die jedoch differenzierter betrachtet und nicht nur als eine Vermeidung mundartlicher Formen interpretiert wurden. Die Vertreter dieser Position bestimmten die höfische Dichtersprache zumeist als reine (geschriebene) Literatursprache und bestritten somit eine gesprochensprachliche Korrespondenz. Damit ist aber deutlich, dass die Existenz einer höfischen Dichter- oder Literatursprache von beiden Seiten als gegeben angesehen wurde.
Ein zum Ende des 19. Jahrhunderts durchaus vorsichtiger Vertreter der ‚literatursprachlichen‘ Position war Otto Behaghel,82 der zudem seine frühe Position späterhin (1933) revidierte.83 Bedeutsam ist, dass er als Erster in der Diskussion um eine mittelhochdeutsche Gemeinsprache auf das methodische Problem aller vorliegenden Untersuchungen, die „in der Beschaffenheit der Quellen selbst“ läge, hinwies: Insofern ihre genaue Lokalisierung und/ oder Datierung jeweils unbestimmt war, wäre deshalb nicht „festzustellen […], dass sie nach Ort und Zeit eine einheitliche Sprache darbieten“.84 Daraus folgend sah er in den Urkunden die „einzige, unbedingt zuverlässige Grundlage der Forschung“.85 Diese Einsicht nutzend, konnte er aufgrund einer sehr kleinteiligen und auf die vollen/ abgeschwächten Nebensilbenvokale fokussierenden Untersuchung zeigen, dass die maßgeblichen Dichter „im Reime durchaus Formen auf[zeigen], die mit ihrem heimischen alemannischen Dialekt im Widerspruch stehen“,86 woraus er u.a. und sehr vorsichtig schloss, dass es „also doch bei der Annahme einer mittelhochdeutschen Schriftsprache sein Bewenden haben“ müsse.87
Mit Behaghels Konzentration auf die Beobachtung der konkreten Sprache folgte ein gradueller Perspektivwechsel der sich anschließenden Forschung: Es erfolgte nun eine stärkere Konzentration auf die Analyse der Reime sowie auch den Sprachgebrauch einzelner Dichter.88 Mit eben diesem Ansatz wandte sich Carl von Kraus89 wiederum dem immer wieder im Zentrum des Interesses gestandenen Heinrich von Veldeke zu. Mit Hinweis auf Konrad Zwierzina90 und die von ihm „und mir angewendeten Methode, den Reimgebrauch einzelner Dichter gründlich zu untersuchen“,91 hoffte v. Kraus, „dass wenigstens die ganze Art der Beweisführung methodologisches Interesse finden möge, [und dass …] die Ueberzeugung allgemeiner würde, dass Begriff und Umfang der mhd. Dichtersprache nur auf diesem Wege bestimmt und abgegrenzt werden können“.92 Im Ergebnis bestätigte er die schon frühere Beobachtung, dass Veldeke „die Dialekticismen seiner Heimat mied und Unsicheres beiseite liess“, zugleich aber beschrieb er, dass „wenig spezifisch Hochdeutsches in seinen Werken zu finden ist.“93 Die Erklärung, die er für Veldeke lieferte und die er ähnlich auch auf andere Dichter der Zeit übertrug: „Nur bei dem Niederländer, der für Fremde schreibt, ist beides gleichzeitig erklärt: dass er seine Eigentümlichkeiten zu unterdrücken bestrebt ist, ohne doch die fremden anzunehmen.“94 Carl von Kraus ging somit nicht von einer schon bestehenden ‚Gemeinsprache‘ aus, der sich Veldeke bediente oder sich dieser anlehnte, sondern von einer entsprechenden Rezipientenorientierung, einer „Rücksichtnahme auf hochdeutsche Leser […]. Den guten Willen, Alles was diese stören könnte, seinem Werke ferne zu halten, müssen wir nach all dem Beobachteten sicherlich annehmen. Das einfachste Mittel hiezu war […] nach Möglichkeit neutrale, etymologisch gleichwertige Reimwörter mit einander zu binden. Diese liessen sich in den meisten Fällen ohne weiters in fremde Dialekte übertragen, ohne dass die Reinheit des Reims darunter zu leiden hatte.“95 Hier zeigte v. Kraus nun, dass Veldeke mit einem solchen Verfahren nicht allein stand, „im Gegenteil: was bei ihm zu lernen war, lässt sich im Wesentlichen bei den meisten seiner Genossen ebenso beobachten; sein Verhalten gegenüber dem Dialekt seiner Heimat ist im Wesentlichen typisch für das der meisten anderen Dichter gegenüber ihren Mundarten. In diesem Sinne ist es geboten, von einer mittelhochdeutschen Dichtersprache zu reden.“96 Hier wird also keine vorbildhafte Region angenommen, an der man sich sprachlich orientierte, sondern nurmehr eine auf Sprachkenntnis beruhende Anpassung an die Rezipientenerwartung. Die sich daraus ergebende Sprachform war aber keine „Schriftsprache im heutigen Sinne […]: aber vielleicht die notwendige Vorstufe zu einer solchen. Wohl hätte sich auch durch das konsequente Vermeiden von Dialekticismen etwas positiv Gemeinsames, eine Art ϰοινή [Koine] ergeben müssen: aber so konsequent waren auch die besten Dichter, waren auch Hartmann, Wolfram und Gottfried nicht […].“97
Anknüpfend einerseits an Pauls Einsicht, dass es keine mittelhochdeutsche Schriftsprache im Sinne des Neuhochdeutschen gegeben habe, und andererseits anknüpfend an die Forschungen insbesondere Carl v. Kraus’, die deutlich machten, dass Pauls Überzeugung, „jeder mhd. Dichter habe einfach seinen Dialekt geschrieben und sich um die Sprache seiner Nebendeutschen nicht im geringsten gekümmert“ nicht stimmte, wollte Samuel Singer98 nun die „Momente“ bestimmen, die „einen mhd. Dichter zur Abweichung von seinem heimischen Dialekt“ brachten.99 Um die verschiedenen in der Forschung geäußerten Meinungen entsprechend zu ordnen, leistete Singer zuerst einmal eine notwendige begriffliche Klärung und unterschied Schriftsprache, Umgangssprache, Literatursprache und Dichtersprache. Bei letzterer sah er die schon bei Carl v. Kraus formulierte Beobachtung als wesentlich, dass sie „sich auch durch das konsequente Vermeiden von Dialekticismen [als] etwas positiv Gemeinsames, eine Art ϰοινή [Koine] [hatte] ergeben müssen“ (s.o.). So schloss Singer, dass sich die Dichter dazu „eine möglichst weitreichende Kenntnis der einzelnen Dialekte verschaffen [… mussten, dass sie] das Besondre aus jedem einzelnen eliminieren und das Gemeinsame merken und ausschliesslich anwenden [mussten]. Durch eine solche Abstraktion mussten sie zu dem Begriff einer nicht wie die heutige Schriftsprache neben, sondern über den Dialekten stehenden Sprache, einer ϰοινή [Koine], eines Deutsch kommen. Diese nur in den Köpfen der Dichter, und in jedem nach seiner geringern oder grössern Dialektkenntnis anders lebende, nur in den Reimen angewendete Sprache […] ist es, was ich die Dichtersprache nenne.“100 Als die herausragende Dichtergestalt erkannte Singer Hartmann von Aue, an dessen Werken man erkennen könne, „wie sich seine Kenntnis der fremden Dialekte immer mehr und mehr erweitert, wie seine Gewandtheit im Vermeiden der nicht gemeindeutschen Reime immer zunimmt, bis er endlich im Iwein, seinem letzten Werke, seinem Ideal der Dichtersprache am nächsten kommt.“101
Völlig unabhängig von solchen Forschungen, in denen zu erweisen ersucht wurde, ob und in welcher Weise einzelne Dichter intentional an der Herausbildung einer sprachlichen Überregionalität arbeiteten, damit dann die Überwindung der eigenen Regionalität leisteten und letztlich die Entwicklung zu einer wie auch immer bestimmbaren und im schriftlichen wie mündlichen Verkehr verwendeten ‚Gemeinsprache‘ eingeleitet hatten, lieferte Agathe Lasch aus der Perspektive des (gegenüber dem Mittelhochdeutschen des 12./13. Jahrhunderts etwas späteren) Mittelniederdeutschen102 wichtige, jedoch weitgehend wenig beachtete Einschätzungen. In Zusammenfassung der Forschungen zum Mittelniederdeutschen war für sie völlig unstrittig, dass „es eine mnd. schriftsprache für den schriftlichen verkehr gab, […] wenn man im mittelalter, wo der provinzielle verkehr bei weitem der stärkere war, für den begriff ‚schriftsprache‘ nicht ein völliges aufgeben aller lokalen formen zugunsten einer mittelsprache verlangt, nicht eine einheitssprache, die über den dialekten steht, sondern wenn man ihn in dem deutlichen streben erfüllt sieht, gewisse stark abweichende züge der lokalsprache zu vermeiden. Starke dialektische unterschiede waren – mehr oder weniger vollständig – überwunden“.103 Hier schaffte Lasch hinsichtlich der für das Mittelhochdeutsche so wichtigen Forschungskontroverse eine sehr einleuchtende Klärung, indem sie feststellte: „Der unterschied liegt wohl nur in der bezeichnung“.104 Indem sie aber zugleich feststellte, dass das Hochdeutsche in Gänze (und nicht nur hinsichtlich einzelner Dichter) als dichtersprachlicher Vokabular- und Reimgeber der mittelniederdeutschen Dichtung diente,105 wurde indirekt eine literarische Vorbildwirkung einer (mittel)hochdeutschen Dichtersprache angenommen.
Dem wiederum entgegengesetzt und in Fortführung des von Paul eingenommenen Standpunktes, wesentlich von der handschriftlichen mittelhochdeutschen Überlieferungslage auszugehen und aus dieser heraus auch die Unterschiede der Dialekte zu betonen, lehnte auch Victor Michels106 unter Bezugnahme auf diese handschriftliche Überlieferung eine mittelhochdeutsche Einheits- als auch Dichtersprache im Sinne einer gültigen Überregionalität ab. Allerdings räumte er als „anzunehmen“ ein, „daß in der ritterlich-höfischen Gesellschaft einerseits eine gewisse Mischung der Dialekte, andererseits eine den besonderen Eigenheiten der Gesellschaft angepaßte Auslese aus dem dialektischen Sprachschatz stattfand“.107 Solche Gemeinsamkeiten bemerkte er im Wortschatze und auch in der dichterischen Reimgestaltung. Wie schon auch Singer sah er darin jedoch keine intentionale Tendenz zu einer Überregionalität hin, sondern eher nur die Tatsache, dass „jeder Schriftsteller an einen oder mehrere Vorgänger direkt anknüpft und Eigentümlichkeiten der literarischen Tradition mit denen der mündlichen verbindet.“108 Erstmals wurden bei Michels entsprechende Einsichten zur Grundlage einer umfassenden grammatischen Beschreibung des Mittelhochdeutschen formuliert. „Es [das Elementarbuch] macht aufs nachdrücklichste auf den Unterschied der Dialekte aufmerksam […], sucht aber auch hervorzuheben, wie sich aus den Dialekten die Literatursprache der Schriftsteller mit ihren individuellen Verschiedenheiten bildet.“109
Wie sehr und dass die Diskussion um eine mhd. ‚Dichter-‘‚ ‚Literatur-‘ oder ‚Gemeinsprache‘ und die daraus entstandene Erkenntnis zwischenzeitlich zu einem selbstverständlich berücksichtigten Aspekt in der Beschreibung des Mittelhochdeutschen geworden war, zeigte sich nach Michels’ ‚Elementarbuch‘ schließlich auch in Gustav Ehrismanns ‚Geschichte der deutschen Literatur‘.110 Dabei griff Ehrismann nicht auf eigene Forschung zurück, sondern formulierte aus dem Referat bisheriger und an der Textlichkeit der Überlieferung orientierter Erklärungsansätze die Einsicht, dass „in der höfischen Kunst der Blütezeit […] ein Zug zur Vereinheitlichung [herrscht]. […] Es besteht in der Literatur eine Gemeinsprache, die Sprache der Dichter, die mhd. ‚Dichtersprache‘, Schriftsprache. Das hervorstechend Mundartliche wird gemieden, die groben grammatischen Unterschiede verschwinden, dadurch weichen die Formen bei den einzelnen Dichtern nicht so stark voneinander ab und bieten wenig, ja bei den Klassikern fast gar keine auffallenden Merkmale.“111 Findet sich hier die bis auf Lachmann zurückgehende Einschätzung wieder, so lehnte Ehrismann aber gleichwohl dessen These ab, dass das ‚klassische‘ und in Grammatiken und Textausgaben gehandhabte Mittelhochdeutsche tatsächlich auch gesprochen oder geschrieben worden sei, es „[stelle] nur ein sprachliches Idealsystem dar“.112 Hinsichtlich der gesprochenen Sprache argumentierte Ehrismann gemäß plausiblen und aus der eigenen Alltagswelt entnommenen Annahmen (Unterschied ländlicher und regional begrenzter zu einer höfischen Kommunikation) und öffnet damit eine Perspektivierung der Forschungsfrage über die Sprachwissenschaft hinaus, „die Frage nach der mhd. Dichtersprache [wird] zugleich e. soziologisches Kulturproblem, das auf der Trennung der Stände, auf sozialen Unterschieden beruht.“113
Mit einer subtil gänzlich anderen Argumentation fällt Alfred Götze114 innerhalb der Forschungsdiskussion auf, insofern er die tatsächliche Nicht-Existenz einer ‚Schriftsprache‘ schon in mittelhochdeutscher Zeit interessanterweise durch die tatsächliche Existenz einer ‚Dichtersprache‘ begründet: „Durch künstlerische Wahl scheidet sich die Sprache des mhd. Dichters von der seiner Heimat. Er geht zwar von deren gesprochener Mundart aus und meidet […] in Wortwahl und Formgebrauch alles, was dieser fremd ist. Aber er braucht die angeborne Sprache nicht völlig, sondern schließt davon aus, was bei den Nachbarn nicht gilt. […] Das alles ist aber keine Schriftsprache, es ist vielmehr das Fehlen der Schriftsprache, das den Dichter zu solcher Enthaltsamkeit zwingt.“115 Die für die Zeit der klassischen mittelhochdeutschen Dichter somit noch nicht vorhandene ‚Schriftsprache‘ sei erst bei den nachfolgend epigonalen Dichtern entstanden, die auf eine jahrzehntelange Geschmacks- und Stilbildung des Publikums anknüpfen konnten; erst durch ihre Übernahme der gegebenen sprachlichen ‚Muster‘ sei eine Schriftsprache entstanden.116
Friedrich Wilhelm117 fügte der Diskussion um eine mittelhochdeutsche ‚Gemeinsprache‘ eine produktiv polemische und insofern die Forschungsdiskussion neu fokussierende Perspektive hinzu. Der ob seiner schon früh vorgetragenen Kritik an den gängigen Editionsverfahren innerhalb der professoralen Germanistik wenig gelittene und eher verhinderte Germanist Friedrich Wilhelm kritisierte die gängige Praxis des Mittelhochdeutschphilologie, nachdem er sich von der gängigen Orientierung an den Texten der hochhöfischen Dichter abgewandt hatte. Nachdem sich die vorausliegende Forschung aufgrund ihrer Hochschätzung der Dichter des späten 12. und frühen 13. Jahrhunderts „den poetischen, literarischen Texten zu[gewandt hatte]“,118 plädierte Wilhelm nun – wie lange vor ihm bereits auch Müllenhoff119 – für eine Berücksichtigung der der Lebenswelt näherstehenden Prosa und d.h. für eine Berücksichtigung der erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts auftretenden und häufiger werdenden deutschsprachigen Urkunden. Dort nun fand er jene bereits auch von Hermann Paul argumentativ in den Vordergrund gestellte enorme dialektal- varietäre Vielfalt des geschriebenen Deutsch dieser Zeit. Vor diesem Hintergrund nannte er das in den Textausgaben seitens der Herausgeber bewusst einheitlich gestaltete Mittelhochdeutsch als ein „von den älteren Germanisten geschaffenes Esperanto der deutschen mittelalterlichen Schreibsprachen“.120 Wilhelm formulierte hier eine Einsicht, die insbesondere dann auch für die folgende und ausschließlich an der empirisch zugänglichen Überlieferung orientierten Erforschung des Frühneuhochdeutschen nahezu forschungsparadigmatisch wurde. Hier war es der große Privatgelehrte Virgil Moser, der sich seit dem frühen 20. Jahrhundert im Zusammenhang der großen Frage nach der Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache der Erforschung des auf das Mittelhochdeutsche folgenden Frühneuhochdeutschen angenommen hatte. Unter ganz expliziter Ablehnung jedweder ideologischen Voreingenommenheit und d.h. vollends unbeeinflusst von jedweden allgemeinen Überzeugungen hatte sich Virgil Moser gänzlich positivistisch der überbordenden Überlieferung seines Zeitraumes zugewandt und versucht, die kaum zu übersehende Vielfalt des geschriebenen und gedruckten Deutsch systematisch zu erfassen. Dabei ergab es sich von selbst, dass Moser immer wieder auch den Zeitraum vor der Mitte des 14. Jahrhunderts und d.h. den mittelhochdeutschen Zeitraum mit in den Blick nahm. Im Ergebnis seiner Untersuchungen kam er zu dem Schluss, dass es eben ‚nicht so sei‘, wie er dann 1951 schrieb, dass der nahezu unüberschaubaren Vielfalt der Schriftdialekte seit der Mitte des 14. Jahrhunderts jene behauptete ‚Einheit des Mittelhochdeutschen‘ vorausgehe, dass es eben ‚nicht so sei‘, dass eine solche vorgängige sprachliche Einheit dann durch zahlreiche Schriftdialekte abgelöst worden sei. Vielmehr sah Moser eine seit ahd. Zeit ununterbrochene Existenz landschaftlich-dialektaler Schreibsprachen: „Wenn […] diese vorzüglich zur Zeit des klassischen Mittelhochdeutschen vielfach bis heute als versiegt erscheinen, so liegt das doch noch immer [und d.h. 1951] in erster Linie an der Betondecke, die Lachmann und seine Schule mit ihrem ‚noblen Mhd.‘ über [… die Sprachwirklichkeit] fast ein Jahrhundert lang gelegt haben“.121 Damit formulierte Virgil Moser sehr anschaulich, dass die sprachliche Wirklichkeit des Mittelhochdeutschen ganz anders war, als sie aus den Textausgaben und entsprechenden Grammatiken aufschien und wie wir sie uns im allgemeinen Verständnis auch dachten; er machte deutlich, dass der Zugang zum Fluss der sprachlichen Entwicklung im Hochmittelalter verdeckt war, weil dieser unter einer Betondecke versiegelt lag, man also nur die Betondecke sehen konnte.
Die seit Friedrich Wilhelm grundstürzend veränderte Einstellung dem ‚normalisierten Mittelhochdeutschen‘ gegenüber findet sich etwas abgeschwächt dann auch bei dem älteren und seine frühere Position (s.o.) relativierenden Otto Behaghel, der „es wol für möglich [hielt]“, dass man die Vorlage, „die das getreue bild von Lachmanns schöpfung darstellt“, auch finden möge, dass aber „vielleicht […] nichts anderes übrig [bleibt] als die annahme, daß Lachmann eine nur annähernd vorhandene einheit künstlich zu einer wirklichen umgeschaffen hat. So wird es also doch wol ein luftgebilde bleiben […]“.122
Mit den Beiträgen insbesondere von Friedrich Wilhelm und auch Otto Behaghel schien die Beschäftigung mit der höfischen Dichtersprache als isoliertem Forschungsgegenstand abgeschlossen zu sein, ohne jedoch alle Fragen erschöpfend beantwortet zu haben. Die These einer mundartfreien und tatsächlich gesprochenen Sprache war spätestens mit Hermann Paul überzeugend in Frage gestellt worden. Man sprach von den jeweils individuellen Spracheigentümlichkeiten der einzelnen höfischen Dichter, in denen sich jedoch eine gemeinsame Teilmenge an Gemeinsamkeiten finden lässt, so die Meidung mundartlicher Formen im Reim, so ein ähnlicher Wortschatz, so auch Gemeinsamkeiten in Stil und Form, ohne dass dies alles aber eine intentionale Komponente gehabt hatte. Gleichwohl war die Diskussion nicht erledigt, sondern erlebte auch späterhin und insbesondere im Zusammenhang eines Neuanfangs in der Erforschung der dem Neuhochdeutschen vorausgehenden nichtnormalisierten Sprachstufen des Deutschen eine vielfältige Wiederaufnahme.
Interessanterweise hatte die Germanistik den aus den Einsichten Friedrich Wilhelms, Otto Behaghels und auch Virgil Mosers dringend folgenden Anspruch einer ‚neuen, umfassenden wissenschaftlichen Grammatik des Mittelhochdeutschen‘ sehr rasch konzediert,123 eine ebenso rasche Umsetzung wurde jedoch nicht in Angriff genommen. So sprach der Mediävist Gerhard Meissburger 1983 – und d.h. 32 Jahre nach Virgil Mosers und 52 Jahre nach Friedrich Wilhelms Diktum – vom „kümmerlichen Dasein“ der mittelhochdeutschen Grammatik;124 noch 1989 klagte der Sprachhistoriker Norbert Richard Wolf: „Für den […] historischen Grammatiker ergibt sich der bedrückende Befund, dass wir über das Mittelhochdeutsche eigentlich erst sehr wenig wissen“.125 Dieses Eingeständnis wirkte überraschend vor dem Hintergrund der Tatsache, dass über mehr als ein Jahrhundert hinweg viele Generationen von Germanisten Mittelhochdeutsch in dem Bewusstsein gelernt haben, sich hier ein in Grammatiken beschriebenes und also unzweifelhaftes Grundlagenwissen anzueignen. Das 1989 von Norbert Richard Wolf formulierte Eingeständnis ist für den Bereich der Grammatikographie des Mittelhochdeutschen seitdem konsensuell geworden, bezüglich jedoch der Vorstellung einer wie auch immer gearteten mittelhochdeutschen Gemein- oder Schriftsprache war ein solcher Konsens aber auch zum ausgehenden 20. Jahrhundert noch nicht im Blick. Er war vielleicht auch deshalb nicht im Blick, weil hier – anders als in Bezug auf die sprachlich-grammatischen Verhältnisse und dabei sehr verständlich – immer auch und letztlich ähnlich zu den Verhältnissen am Anfang des 19. Jahrhunderts ein Erkenntnisinteresse mitberührt war, das außerhalb der Sprachgeschichtsforschung im engeren Sinn liegt. So diskutierte u.a. Friedrich Maurer 1951 die Frage nach der Entstehung unserer Schriftsprache126 im Zusammenhang einer im 13. und dann vor allem 14. Jahrhundert sich abzeichnenden „Entwicklung eines deutschen Nationalbewußtseins“. So blieb die Frage immer wieder aufgenommen und wurde als so bezeichnete ‚alte Streitfrage‘ auch über die Jahrtausendwende neu diskutiert. Die Antwort blieb unentschieden. Denn folgte man der 2004 formulierten Einschätzung Kurt Gärtners, dann schien man wieder dort zu sein, wo die Forschung vor Hermann Paul schon einmal war: „Die in der 1. Hälfte des 13. Jhs. geschriebenen Handschriften […] lassen jedoch eine […] seit den Anfängen der Germanistik immer wieder diskutierte Vorstellung von einer ‚mittelhochdeutschen Schriftsprache‘ […] plausibel erscheinen“.127
2.4 Die Frage der Terminologie
Der Gang der Forschungsdiskussion macht deutlich, dass in der Bezugnahme aufeinander oft eine begriffliche Unklarheit bezüglich der zu beschreibenden Sprachvarietät sowie auch eine Unklarheit bezüglich der Existenzform (mündlich oder schriftlich) der zu diskutierenden Varietät bestand. Für die Beschreibung der sprachlichen Verhältnisse finden sich insbesondere die Bezeichnungen ‚Gemeinsprache‘, ‚höherdialektische Gemeinsprache‘,128 ‚Dichtersprache‘, ‚höfische Dichtersprache‘, ‚Literatursprache‘, ‚Gesamtdeutsch‘,129 man sprach von ‚provinziellen Schriftsprachen‘ und ‚regionalen Schreibsprachen‘. Über einen langen Zeitraum hält sich auch die Bezeichnung ‚Koine‘ mit dichter- oder literatursprachlichem Charakter.130 Insgesamt aber spricht die überwiegende Mehrzahl aller einschlägigen Untersuchungen von der ‚(höfischen) Dichtersprache‘.
Die begriffliche Unschärfe und die Tatsache eines damit auch verbundenen unterschiedlichen Forschungsgegenstandes hatte besonders schon Friedrich Wilhelm in seinem Überblick über die Forschungsgeschichte herausgearbeitet und darauf verwiesen, dass das Lachmann’sche Diktum des „bestimmte[n] unwandelbare[n] Hochdeutsch“, welches „die Dichter des dreizehnten Jahrhunderts bis auf wenig mundartliche Eigenheiten … redeten“ im Verlauf des Diskurses schließlich (und bei Lachmann sicherlich nicht so verstandenen) zu einem „Problem nach der Entwickelung zur Schriftsprache hin“ geworden war: „Daran änderte sich im Grunde genommen auch nichts, als von Kraus […] das Paulsche Wort ‚Schriftsprache‘ durch ‚Dichtersprache‘ ersetzt hatte […] und Samuel Singer später […] den Begriff ‚Dichtersprache‘ dadurch zu präzisieren suchte, daß er bei der Behandlung der Frage nach einer mhd. Schriftsprache viererlei unterschieden wissen wollte: ‚1. die Schriftsprache im eigentlichen Sinne, 2. die Umgangssprache der ihm‘, d. h. dem Dichter ‚als die feinen geltenden Kreise, 3. die Literatursprache und 4. die Dichtersprache‘ […].“131 Schon sehr viel früher hatte jedoch bereits Franz Pfeiffer die bisherige Forschung als eine beschrieben, bei der Konsens darüber geherrscht hatte, eine ‚gemeinsame Schrift- und Dichtersprache anzunehmen, die von der Sprache des Volkes verschieden gewesen sei‘.132 Wurde hier der Bereich der gesprochenen Sprache ausgeklammert, so kam in Pfeiffers Kennzeichnung als „von den Volksmundarten [… unterschiedene] Hofsprache“133 nun auch der Aspekt einer sozialstilistisch qualifizierten gesprochenen Sprache hinzu.
Der Hinweis auf die uneinheitliche Terminologie verweist auf unterschiedliche Forschungskontexte und -interessen, wobei sich die zunehmende Fokussierung auf die geschriebene Sprache (begrifflich als ‚Schriftsprache‘ oder auch ‚Schreibsprache‘) als parallel zu der ebenfalls in der Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt diskutierten Frage nach der Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache beschreiben lässt. Entsprechend zeigt sich dann auch für die meisten der jüngeren Arbeiten, dass das Mittelhochdeutsche als Teil einer übergeordneten Entwicklung beschrieben wird.134
Details
- Pages
- 478
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631909591
- ISBN (ePUB)
- 9783631909607
- ISBN (Hardcover)
- 9783631909584
- DOI
- 10.3726/b21255
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- höfische Dichtersprache Wissenschaftsgeschichte Sprache und Nation Funktiolekt Schriftsprache Literatursprache Gemeinsprache Germanistik Historische Linguistik Mediävistik Jacob Grimm Mittelhochdeutsch
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 478 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG