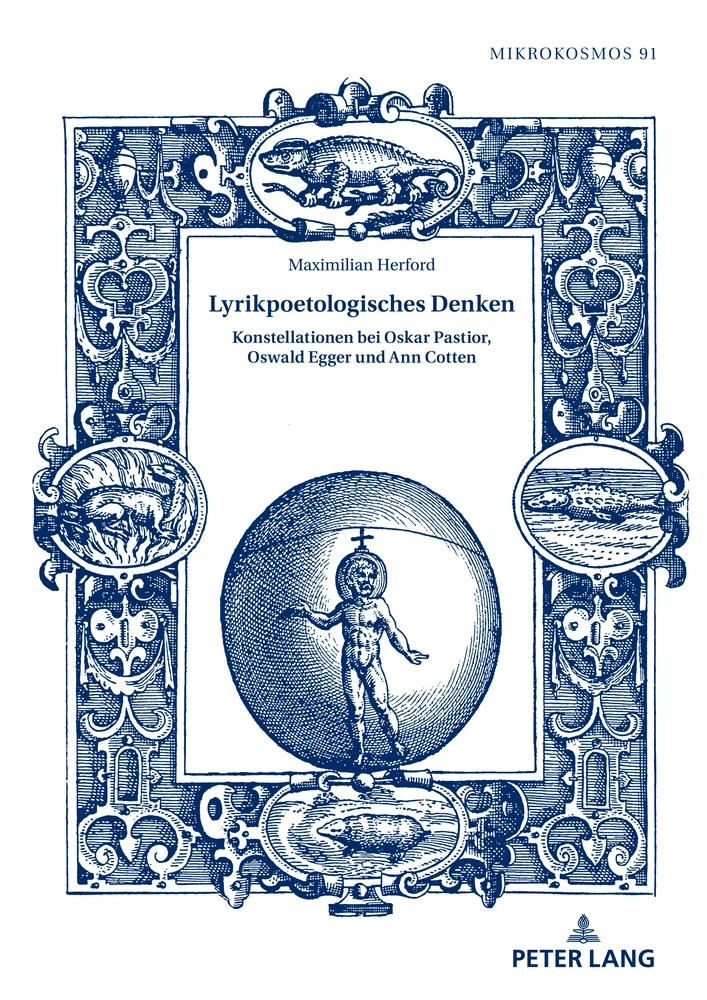Lyrikpoetologisches Denken
Konstellationen bei Oskar Pastior, Oswald Egger und Ann Cotten
Summary
wird ersichtlich, dass dieses Denken sich den epistemologischen Aporien der Beschreibbarkeit von Gedichten aussetzt und so der vermeintlichen Gewissheit eines sekundären Lyrikdiskurses eine prekäre Reflexivität wie eigenwertige ästhetische Produktivität entgegenstellt.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- I. Einleitung
- I.1. Sprechen über Gedichte? Präliminarien zu einem ›schwierigen‹ Gegenstand
- I.2. Forschungslage und Zielsetzung
- I.3. »Wie viel ist Lyrik?«. Spekulative Lyrikpoetologie
- I.4. Einige weitere theoretische und methodische Konsequenzen
- II. Lektüren
- II.1. »Poetiken: / eine Fußzerknirschung«, oder: Pastiors Undinge
- II.1.1. Pastior lesen heute
- II.1.2. »Ich weiß nicht was Lyrik ist«. Paradoxien poetologischer Epistemologie
- II.1.3. »Es kann doch nur immer erste Sätze geben«. Figurationen des Anfang(en)s
- II.1.4. Zwischen-Wissen. Pastiors transgressive Gedichtpoetik
- II.2. Das Ereignis der Poesie und die Poetologie als Ereignis. Oswald Eggers Wendungen
- II.2.1. »Aber bei Gedichten ist Verstehen: Wirken«. Affizierungen des Denkens
- II.2.2. Wort für Wort, oder: das Denken der (Un-)Grenze
- II.2.3. Die ›stille Gesellschaft‹ des Gedichts. Topologik und hermetische Syntax
- II.2.4 »ich sehe das gedicht schon nicht sein«. Vom Formlos-Werden der Rede
- II.3. Excedo, ergo sum. Ann Cottens Xenologie
- II.3.1. Freak-Theoretisches
- II.3.2. Geh raus! Realitätssinn und Übertreibung
- II.3.3. »Die Wege säumen / Unwege«. Aporien der (Sprach-)Liebe
- II.3.4. Poesie, Begriff, Methode. Die andere Materialität des ›Schlechtesten Werkzeugs‹
- III. Poetologische Harlekinaden: Schlussbetrachtungen
- IV. Literatur
- Reihenübersicht
I. Einleitung
I.1. Sprechen über Gedichte? Präliminarien zu einem ›schwierigen‹ Gegenstand
»Über Gedichte ist schwer reden«, so begann einst der Hermeneut und Lyriker Max Kommerell in seinen berühmten Gedanken über Gedichte (1943) aus der Perspektive des behutsamen, gleichwohl das ›Wesen des lyrischen Gedichts‹ erforschenden Lyrikologen, »[s]chwer für den Undichterischen, schwerer für den Dichterischen. […] Bedarf das stille Wirken eines Gedichtes unter den Menschen solcher Auslegungsversuche? Gewiß nicht. Besteht Gefahr, daß es dadurch gestört würde? Allenfalls! Warum also reden?«1 Aus dieser zunächst wenig erfolgversprechend wirkenden Prämisse2 spricht eine modernespezifische Überzeugung: dass doch gerade die klandestine, sich der philologisch-analytischen Reduktion entgegensetzende Sprache der Gedichte nicht nur ihre weitere schriftstellerische Verfertigung, sondern auch das Fortbestehen jenes wissenschaftlichen wie auch des autorenseitigen poeto-logischen ›Schwer-Redens‹ legitimiert, das die Poesie seit jeher zu begleiten scheint.3 Wenn es mit Blick auf letzteres stimmt, dass, was immer der Dichter selbst »an Erklärungen für sein Tun angibt, es […] ihm zuallererst dazu [dient], ein Geheimnis zu hüten«4, warum dann ausgerecht davon reden? Dieser Kardinalfrage der Lyrikpoetologie, nämlich der Aporie der Beschreibung und Bescheibbarkeit ihres Gegenstandes, will sich die vorliegende Arbeit mit Blick auf gegenwärtige Autorpositionen zuwenden.
Dass für letztere vielfach noch die Bezüglich- und Beziehbarkeit von ›Erklärung‹ und ›Tun‹ keine selbstevidente Angelegenheit ist, wird vorerst deutlich, wenn man ›metapoetische‹ Äußerungen wie die folgende betrachtet:
Wie bei anderen Mutmaßungen zu Bedingungen des Gedichts kann erst das poetische Tun selbst, welches noch nicht zu tief in die verschwiegenen Übereinkünfte von Standardvorstellungen darüber, was Gedichte sind, verstrickt ist, lustrieren, wozu und ob die darin offenbare Kontingenz gut sein wird: sofern sie ist, was sie sein kann.5
Dieser bemerkenswerte Satz entstammt der Abschlusspassage aus Oswald Eggers Band Diskrete Stetigkeit. Was Gedichte sind, so Egger, könne nur durch die Poesie selbst angegangen werden: jedes theoretisch-distanzierte Begehren müsse praktisch aufgebrochen werden. Im poetischen Tun, dessen Vollzug selbst unter unauflösbaren Kontingenzbedingungen stehe, werden ausgemachte Vorverständnisse und die Hybris routinierter Erwartbarkeiten durch die Singularität der Ausführung eingeholt. Indem Egger sein mutmaßliches Sprechen zu den Bedingungen des Gedichts auf die Potentialität eines Anders-Sein-Können zurückstuft, öffnet er den Raum für eine immanente Selbstreflexion, die der funktionalen oder gar dokumentaristischen Illustration mit lustvoller und umtänzelnder Skepsis begegnet.6 Die Pointe – durchaus konträr zur oben zitierten Vorstellung – besteht nun nicht zuletzt darin, dass Egger seinen poietischen ›Lustrationen‹ das letztlich Nichtssagende und Geheimniskrämerische eines konventionellen, auf Kontingenzbewältigung und Risikomanagement bedachten Redens über Gedichte gegenüberstellt. Unlängst erhob auch die Lyrikerin Monika Rinck mit ihren Streitschriften im Kontext verschiedener Überlegungen zur gegenwärtigen Relevanz der Dichtung und den möglichen ›Risiken‹ einer unverständlichen lyrischen Sprache Einspruch gegen »die komplett ungefährdete Position«7, der sie zugleich ein Plädoyer für eine solche entgegensetzt, »die sich aussetzt, einmischt, die verwirrt und verwickelt wird, […] die nicht neutral ist« (RI 19). In diesem Zusammenhang kommt sie für einen Moment zu sprechen auf jenes so vertraute wie ungeliebte Exerzitium, an dem die Streitschriften selbst nicht nur (an-)teilnehmen, sondern das dem zuvor angeführten »Moment der Selbstentsicherung« (RI 28) geradezu zu widerstreben scheint:
In den letzten Jahren wurde der Dichter immer wieder dazu aufgerufen zu sagen, was er im Begriff war zu tun. Nervös öffnet und schließt er die Schachtel und steckt sie in die Manteltasche zurück. Natürlich ist es gut, wenn es ein Interesse gibt. Ohne dieses Interesse hätte sich der Dichter womöglich längst anderem zugewandt, doch diese eigenartige Auskunftspflicht bezüglich seiner dichterischen Praxis trieb ihn in die Außenbereiche der Produktion und er wurde sich selbst gegenüber auf wortreiche Weise stumpf und undurchsichtig. (RI 31)
Den Imperativ der versichernden Selbsterklärung aufkündigend (vgl. RI 235), schreibt Rinck an einer Utopie des ›Idiotischen‹, mittels derer sie sich jener dillematischen Opposition von Selbsterklärung und Geheimniskrämerei, Auskunft und Produktion, Transparenz und Intransparenz ›aussetzt‹, sie umdenkt, andersdenkt. Der Idiot, der sich bei Rinck zu einer ganzen Schar an Akteuren des Idiotischen auffächert, verpflichtet sich deshalb einer »Spielart des Albernen […], die das Eigene als befremdlich vorführt« (RI 45); seine xenophilen Harlekinaden ersetzen das nüchterne Credo der »Selbstanalyse« (RI 197) mit einer fröhlichen Autohermeneutik des Fehlgehens, des Stolperns und Übertreibens, kurz: Lyrikpoetologie ist tot – hoch lebe Lyrikpoetologie. So oder so ähnlich jedenfalls ließe sich die Geste ›avancierter‹ Autorenpoetik – jenem diffusen Korpus an Statements »von Autoren über ihre Schreibverfahren«8 oder allgemeiner: »[k]ritisch-poetologische[n] Überlegungen […], die von dem Autor selbst stammen«9 – im Feld der deutschsprachigen Gegenwartslyrik summieren.10 Offenkundig ist damit noch wenig gesagt, vielleicht ohnehin nur, trivialiter, ein althergebrachtes Moment dichterischer Selbstzuschreibung benannt. Indes stimuliert jener inkonsequente Modus, über den Lyrik und poetische Sprache zugleich Gegenstand autoritativer Rede zu werden vorgeben und sich eines solchen Zugriffs zu entziehen suchen, erkenntniskritische, hermeneutische und darstellungslogische Probleme, deren ›Postulierung‹, ›Verhandlung‹ und ›Inszenierung‹ nur in jenem Dazwischen überhaupt (noch) möglich erscheint. Das klingt ersteinmal nach sprachskeptischer Sackgasse, ironischer Zirkelei oder der postmodernen Neuauflage jener selbstimmunisierenden Geheimniskrämerei, von der Grünbein spricht. Und doch artikuliert sich in der nicht-neutralen ›Spielart des Albernen‹ – so die Hauptthese der folgenden Überlegungen – die Suche nach einem konsequenten experimentellen Empirismus, der sich nicht als contradictio in adiecto aushöhlt, der mithin Selbstbezüglichkeit und Lebensnähe, Hermetik und Erkenntnissuche, nicht als strikten Gegensatz oder logische Alternative zementiert, sondern deren Spannungen und potentielle Beziehungen im Medium der Lyrikpoetologie erforscht.
Dass resp. ob Gedichten und schließlich dem Poetischen selbst ein – wie auch immer konzipierter – epistemischer Wert zukommt, kann aus einer solchen Perspektive sich weder mit axiomatischen Setzungen begnügen noch diskursiv verabschiedet oder aber reflexiv eingeholt werden. Stattdessen wandert das Untersuchungsobjekt ›Gedicht‹, das sich rhetorischen Handhabungen wie theoretisch-begrifflich Vereinnahmungen gegenüber als repulsiv (nicht: resistent) erweist, als irreduzibler kritischer Horizont in den poetologischen Text selbst. Gerade diese explorierenden textuellen (Selbst-)Begegnungen mit der ontologischen Repulsivität ›des‹ Gedichts wie dessen poietischer Dimension konturieren so eine Sprach- und Darstellungspraxis, die nicht einfach ihre eigenen Unzulänglichkeiten souverän abfeiert, sondern sich als In(ter)vention – also eine Praktik des Werdens und der Einschnitte – begreift und auf diese Weise nicht zuletzt ihre ganz eigenen Konstitutionsbedingungen und Lektüreeffekte mitreflektiert. Die spätestens mit den Jenaer Frühromantikern errungene Einsicht in die prinzipielle Unmöglichkeit einer erschöpfenden Rede über Poesie, die das Singuläre jener Poesie parergonal transparent machte (und damit restlos absorbierte), verlangt selbst nach close talkings: ›nahen‹ Sprechweisen, die immer wieder von diesem Anderen und Singulären herkommen, an ihm teilhaben, es besprechen und mitteilen. Gewiss, regelmäßig vorgetragene Poetik-Schelten im Zeichen von Explikationsmangel oder gar des stilisierten Unverständlichwerdens gegenüber den dabei entstehenden Arrangements, die ja ihren ›schwierigen Gegenstand‹ nur tautologisch verunklarten, sind deshalb nicht gleich unberechtigte Verkennung oder Ausweis sachlicher Inkompetenz; sie zielen aber sehr wohl an den spekulativen Bedingungen sowie den produktiven, suggestiven und teils subversiven Konsequenzen der monierten Zugänge vorbei, die hier mit ausgewählten poetologischen Beiträgen von Oskar Pastior, Oswald Egger und Ann Cotten im Zentrum der weiteren Betrachtung stehen sollen. Alle drei vereint dabei die Perspektive eines (un-)doing poetics, das das Nachdenken über die Möglichkeiten und Unmöglichkeit des Gedichts als eine Form der flüchtigen Immanenz praktiziert. Das heißt dieses Denken wird – um nocheinmal Rincks Einwurf aufzugreifen – von den Sprachschablonen und Gepflogenheit der institutionalisierten und zur Gebrauchsform degradierten Auskunftspflicht weggeführt und auf den Innenbereich der Produktion hin verlängert. Abstrakte begriffliche Fügungen wie ›Unding‹ (Pastior), ›Nichts, das ist‹ (Egger), ›schlechtestes Werkzeug‹ (Cotten) u.a. m. partizipieren so durchaus am modernistischen Kern linguistischer Negativität, an dessen notwendigem Ende das Gedicht nurmehr als absolut-stummes Genicht (Celan) stünde.11 Und doch frönt eine poetologisch geforderte wie einkalkulierte Ignoranz gegenüber der »Feinmechanik des Gedichts«12 weder einem (erneuerten) sprachludistisch-verrätselnden anything goes noch dessen quietistischen oder defätistischen Konterparts; eher gibt sie streitlustig wie ergebnisoffen zu denken auf, ob und wie überhaupt ein Sprechen und Schreiben über Lyrik vorgestellt werden kann, stets eingedenk, dass – wie der Lyriker Hendrik Jackson an einer Stelle schreibt – »[i]m Unverständnis, selbst wenn gereimt, […] das Skandalöse anstößig [bleibt]: als Anstoß, die Dinge anders zu betrachten, aus der gewohnten Weise geworfen zu werden. Sandalen-Skandale«13: Das ›Geheimnis‹ namens Gedicht ist der Idee einer solchen prekären wie volatilen Form der Lyrikpoetologie jener anhaltende Skandal, ihr andauernder Stolperstein.
Diese Sichtweise ist, wie schon angedeutet, nicht neu. Schon Friedrich Schlegel wusste um die Kraft solcher ›Sandalen-Skandale‹ wie sich nachdrücklich an seinem berüchtigten und oft kommentierten Aufsatz Über die Unverständlichkeit aus dem Jahre 1800 erkennen lässt:
[I]ch wollte zeigen, daß die Worte sich selbst oft besser verstehen, als diejenigen, von denen sie gebraucht werden […], daß man die reinste und gediegenste Unverständlichkeit gerade aus der Wissenschaft und aus der Kunst erhält […]; ich meine eine reelle Sprache, daß wir aufhören möchten mit Worten zu kramen, und schauen alles Wirkens Kraft und Samen.14
Unverständlichkeit ist nach Schlegel, der hier bekanntlich selbst auf Unverständlichkeitsvorwürfe reagierte, kein Resultat mangelnder Lesekompetenz, sondern eine spezifische Qualität von Sprache und des ›Verstandes‹ selbst, mithin ein intentionaler Überschuss, der sich der Kontrolle des Subjekts entzieht und stattdessen in den »Worten« selbst vermutet werden darf. Damit ist keiner opaken Sprachabschottung das Wort geredet. Eher geht es um das, was Maurice Blanchot mit Blick auf das Athenäum als den romantischen »Exzeß […] des Denkens« beschrieben hat, nämlich die »von der Poesie erhobene Forderung, sich zu reflektieren, und sich durch Selbstreflexion zu erfüllen«, eine »Poesie, die Wissen ist«15. Das Exzessive in Schlegels (Pseudo-)Apologie besteht nun aber nicht zuletzt darin, dass Unverständlichkeit sich gerade nicht als Gegenspieler zu einer ›reellen‹, einer transparent-totalverständlichen Sprache fassen lässt. Der keineswegs melancholische, sondern – im vollen Sinne – ironische Wink auf die linguistische Utopie einer direkten und damit: sich selbst abschaffenden Sprache, deren Möglichkeit zugleich die ganze Unterscheidung zwischen Verständlichkeit und Unverständlichkeit, Verstehen und Nichtverstehen, Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, Vernunft und Unvernunft hinfällig werden ließe, visibilisiert vielmehr die Potenz eines ironischen Diskurses. Denn indem Schlegel das Unverständliche allererst als gedanklichen Grund und diskursive Triebfeder jener Unterscheidungen denkt, fungiert es als generativer Katalysator progressiver Bedeutungsformierungen wie epistemologisches Fundament der paradoxen Konditionen jeder Verständlichkeit.16 Mit anderen Worten: Insofern das ironisierte ›Problem‹ der Unverständlichkeit sich bei Schlegel gleichermaßen modernistischen Vereinnahmungen und didaktischen Auflösungen entzieht, performiert der Unverständlichkeits-Aufsatz die von Schlegel geforderte Aufgabe der Poesie, eine »unendliche Rhetorik«17 zu sein. Daher ist auch die Projektion einer reellen Sprache, die bereits Gegenstand der Rede über die Mythologie war und dort in der letzten Fassung u.a. eine Sprache »des Dummen durchschimmern läßt«18, nicht Affirmation des Mythos oder der (Re-)Mythifizierung, sondern nachgerade Urgrund aller Poesie. Am Ende seiner programmatisch offen bleibenden Ausführungen schreibt Schlegel schließlich auch von der Unverständlichkeit als transzendentaler Bedingung von Erfahrung, ja letztlich konstitutives Element der Welt:
Ja, das Köstlichste, was der Mensch hat, die innere Zufriedenheit selbst, hängt, wie jeder leicht wissen kann, irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muß, dafür aber auch das Ganze trägt und hält, und diese Kraft in demselben Augenblicke verlieren würde, wo man ihn in Verstand auflösen wollte. Wahrlich, es würde euch bange werden, wenn die ganze Welt, wie ihr es fordert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde. Und ist sie selbst diese unendliche Welt nicht durch den Verstand aus der Unverständlichkeit oder dem Chaos gebildet?19
Unabhängig von den damit tangierten metaphysischen Spezifika kann ein kritischer Begriff des ›Unverständlichen‹ wie ihn Schlegel in einer Rede über Unverständlichkeit (in der das Dargestellte immer schon vom Darstellenden affiziert wird) als »positives Nichtverstehen«20 vorführt, durchaus von Belang sein für einen literaturwissenschaftlichen Zugang zu gegenwärtigen (lyrik-)poetologischen Schreibweisen, insofern diese nicht schlicht als Selbstverhältnis eines potenzierten oder sekundären ›lyrischen Obskurantismus‹ verabschiedet werden sollen. Dieser ›Zugang‹ griffe schon deshalb zu kurz, da sich der buchstäblich in-Rede-stehende Gegenstand der Lyrik selbst nicht nur einer metaisierenden ›Extraktion‹ des Wissens aus der Poesie sperrt; es ist vielmehr die generelle Infragestellung eines solchen poetischen Wissens, die – entlang ihrer forschungsgeschichtlichen Karriere – die ganze romantische Schlagkraft der Unverständlichkeit aushöhlt.
Die Aporie der Unverständlichkeit wie des Über-Unverständlichkeit-Redens21 verknüpft sich so auch von einer allgemeinen literatur- und lyriktheoretischen sowie einer praxeologischen Seite her mit dem Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Letztere Perspektive interessiert sich vor allem für die textuellen und erkenntnistheoretischen Bruchstellen, wo die poetologisch-reflexive Kommunikation die moderne Unselbstverständlichkeit lyrischer Rede in einer Weise thematisiert, die sich sowohl der traditionellen hermeneutischen Dublette ›schwieriger Text/erhellender Metatext‹22 als auch der metapoetischen ›Verunverständlichung‹ unter postmodernem Vorzeichen entzieht. Folgt man nämlich der notorischen und mittlerweile zum gattungstheoretischen Klischee geronnenen Vorstellung von (post-)moderner Lyrik als dem paradigmatisch fremden oder dunklen, gleichsam vulgärhermetisch23 lizenzierten Bezirk literarischer Nicht-Verständigung, so wird die damit anvisierte ›Unverständlichkeit‹ gemeinhin – und stichwortartig abstrahiert – indikativ oder privativ akzentuiert: Unverständliches ist nun entweder ein ›Noch-nicht-Verständliches‹, das aufgrund seines relativen Moments nur vor der Folie einer latenten Verständlichkeit her denkbar ist und immer schon der Überführung in eine solche harrt. Oder es statuiert ein ›Nicht-mehr-Verständliches‹, dessen defizitärer Status sich dann aus der direkten Kontradiktion zu (bzw. Ausgrenzung aus) einer verstehenden Zugänglichkeit rekrutierte.24 Während letzteres zumal auf den Aufweis intentionaler Abweichungs- und Verfremdungsprozeduren innerhalb der als antimimetisch verstandenen Lyrik abzielt und so, befördert etwa durch Hugo Friedrichs einflussreiche Studie Die Struktur der modernen Lyrik (1956), einer vorgängigen Eindunkelung und Verrätselung von Sinn das Wort redet,25 entpuppt sich ersteres bei genauerem Hinsehen als eine Gegenstand wie hermeneutische Gegenstandsreflexion nobilitierende Spielart des Dunklen, die das Gedicht in letzter Instanz doch der ›Entschlüsselung‹ oder ›Enträtselung‹ zuzuführen sucht26 (und sei es, indem im Ergebnis lediglich die potenzierte und/oder exponierte Selbstreferentialität und ›Eigensinnigkeit‹ lyrischer Rede zu verzeichnen ist). Dieser solchermaßen zwischen (negativer) ›Meta-Esoterik‹ und (positiver) ›Kryptographie‹ aufgespannte Rezeptionsraum präfiguriert schließlich auch den philologisch-theoretischen und literaturkritischen Umgang mit der neueren und jüngsten deutschsprachigen Gegenwartslyrik – und dadurch mancherorts auch der Lyrikpoetologie – immer dort, wo ihr (gattungs-)spezifischer Hang zum Dissonanten, Irritativen, Widerständigen, mithin auch ›Experimentellen‹ oder ›Sprachspielerischen‹ herausgestellt wird.27 Insbesondere aus der dogmatisch zugespitzten Variante der allenthalben betonten strukturellen Hyperdeterminierung des Gedichts (›Überstrukturiertheit‹28, ›Dichte‹29 usf.) ergibt sich danach – und durchaus analog zum ›paradigmatischen‹ Fall der Lyrik der Moderne30 – allzu oft entweder eine autotelische Antidiskursivität, d.h. eine (ohnehin unmögliche) essentialistische Absenz jedweder semantischer, instrumenteller oder referentieller Sprachfunktionen, der nurmehr im Modus ästhetisch-sinnlicher Aufmerksamkeit zu begegnen sei. Oder die postulierte Inkommensurabilität wird als abundanter Tiefsinn durch die Hintertür mitkommuniziert und so gesehen ›verständlich‹, insofern sie – im Sinne einer Art Offenlegung – als renoviertes »mimetische[s] Äquivalent für die allgemeine Unverständlichkeit der Welt«31 haftet. In beiden Fällen werden, mit den mahnenden Worten Karl Eibls, die lyrischen »Rätsel« im Zeichen ihrer Vieldeutigkeit oder Polyvalenz eher »gepflegt«32, denn als Ausgangspunkt der Analyse ernst genommen; auch die zahlreichen und interessanter Weise mehrheitlich von Lyrikern und Lyrikerinnen vorgetragenen Einsprüche wider eine solche Praxis ändern hieran wenig.33 Es liegt auf der Hand, dass beide Zugänge, zumindest in dieser jeweils überspannten Weise, kaum haltbar sind und mit der Schwierigkeit hadern, dass jeder Lyrik, insofern sie sich Sprache bedient, ein ambivalentes, jeweils unterschiedlich gewichtetes und potentiell ergebnisoffenes Aufeinanderbezogensein von Referenz und Autonomie, Kommunikativität und ihrer jeweiligen Störung eignet.34 Eine Antwort auf das in mancher Hinsicht abträgliche Echo der Friedrich’schen »Dramatik modernen Dichtens […], die Zeichen und Bezeichnetes so weit wie möglich auseinandertreibt«35, mithin auf die ihrerseits problematische Konzeptualisierung von Lyrik als ›ptolemäischer Welt‹ (Bachtin)36 findet die gegenwartsgermanistische Lyrikforschung in gewissermaßen umgekehrter Blickrichtung. Etwa indem sie unter literarhistorischem Verweis auf die autorpoetologische ›Flaschenpost‹-Metapher bei Brecht und Celan37 oder sporadischer: in vorsichtigem Rekurs auf Diskurs-, Intertextualitäts- und Dialogtheoreme – die profunde Dialogizität der Poesie tout court sowie der modernen38 und aktuellen Gedichtproduktion im Speziellen herauszustellen versucht.39 Vorherrschend ist dabei ein äußerst weites Dialog-Verständnis, das zumal als ein – wie auch immer geartetes – ›Gespräch mit‹ (also etwa als Ansprache und Adressierung, als ›Engagement‹40 oder Bezüglichkeit auf extraliterarische Diskurse, Kontexte und Wissensdomänen) konturiert wird und gegenüber dem topischen Unverständlichkeitsaspekt gerade die kommunikativ-referentielle Funktion lyrischer Erzeugnisse starkmacht. Nun führt auch in dieser Argumentationslinie der Fokus auf die proklamierte und selten näher qualifizierte Offenheit und/oder Permeabilität der (Gegenwarts-)Poesie dazu, Unverständliches – bald als apriorisch ausgeblendeter ›Rest‹, bald als textuelle Formation autosuggestiver Bedeutungsverweigerung – bisweilen analytisch zu exkludieren41 und so sowohl dessen Konstitutionsbedingungen, Qualitäten und Effekte als auch Verbindungen zu deut- und referenzierbaren Textschichten unberührt zu lassen. Indes: Im alleinigen Nachvollzug des lyrischen ›Gesprächs‹, insofern dieser Nachvollzug sich etwa in der reibungslosen Identifikation gedichtinterner Verweise und Bezüglichkeiten erschöpft, vollzieht sich so zugleich die antithetische Ausgrenzung des Unverständlichen aus ebendiesem Gespräch. In hermeneutikkritischer Hinsicht problematisch wird das hintergründige Dialog-Konzept also dann, wenn es »vom Bezug auf die zu sagende und im Sagen zu teilende Sache«42 regiert wird, wenn das Nicht-Substituierbare, Nicht-Assimilierbare und Nicht-ins-Verstehen-Überführbare aus der verständigungslogischen »Totalität […] eines Dialogs«, die »den Mythos einer ›intersubjektiven‹ […] Gründung des Logos und dessen Einheits-Wahrheit«43 supponiert, herausfällt.
Was aber sagt uns diese noch immer wirkmächtige interpretative Grundierung von Lyrik in Bezug auf gegenwärtige Tendenzen dessen, was man vorläufig als einen avancierten poetologischen ›Lyrik-Diskurs‹ bezeichnen könnte? Zum einen, dass sich die in mehrfacher Hinsicht unterkomplexe und dysfunktionale theoretische Polarisierung in ›Hermetik‹ und ›Klartext‹, Unverständlichkeit und Dialogizität, nicht nur als jeweilige Rezeptionshaltung gegenüber den Nuancen deutschsprachiger Lyrik spätestens seit den späten 1980er Jahren als wenig brauchbar erwiesen hat.44 Sie verfehlte in einer nochmals gesteigerten Weise das gegenwärtige poetologische Gespräch über Gedichte, wenn man die angebliche ›Schwierigkeit‹ (in) der rezeptiven Auseinandersetzung mit Gedichten als aufzulösendes Defizit oder verdoppeltes Ärgernis auf die autorenseitige Rede projizierte. Zum anderen offenbart sich ein verkürztes literaturwissenschaftliches Vorgehen, das fortgeschrittene Formen der Lyrikpoetologie nicht nur kaum in ihrer Komplexität wahrnimmt (oder sie, sofern wahrgenommen, kurzerhand als ›Anti-Poetik‹ rubriziert), sondern bisweilen auch – sei es aus forschungsstrategischen Gründen oder kulturkritischen Kalkülen – auszugrenzen droht. Aus diesem Umstand erklärt sich auch, dass sich angesichts der zu beobachtenden Abwendung von normativen und traditionellen produktionsästhetischen Bestrebungen seitens vieler LyrikerInnen nach wie vor eher verhaltene Zwischenrufe unterschiedlicher Couleur vernehmen lassen:
Wo sind sie nur geblieben, all die aufregenden Kontroversen über Struktur und Gestalt des zeitgenössischen Gedichts, wie sie noch in den sechziger Jahren, im goldenen Zeitalter der Autorenpoetik, ausgefochten wurden? Wo sind sie noch zu finden, all die heftigen Platzkämpfe zwischen dem ›Gelegenheitsgedicht‹ (Günter Grass) und dem ›Ungelegenheitsgedicht‹ (Walter Höllerer), zwischen dem ›langen‹ und dem ›kurzen‹ Gedicht (Höllerer versus Krolow)?45
Tatsächlich haben sich die ideologischen Grabenkämpfe und teils dogmatisch geführten Poetikdebatten um und zur kontemporären Lyrik im Laufe der 1970er und 80er Jahre beträchtlich abgekühlt. Auch die emphatische Erhebung poetologisch-dichtungstheoretischer Schriften zur »ars poetica«46 zeitgenössischer Lyrikergenerationen, wie dies noch für Benns Probleme der Lyrik (1951) möglich war, gehört zu einem durchaus historischen Abschnitt der deutschen Literaturgeschichte und ihrer wissenschaftlichen Darlegung. Gleichwohl verkennt Brauns suggestive Diagnose, der zumindest hinsichtlich jüngerer und jüngster Entwicklungen freilich die zeitliche Distanz resp. prognostische Weitsicht abgehen muss, dass sich im Laufe der 1980er und frühen 1990er Jahre autorenseitige Äußerungen und Diskussionen hinsichtlich der Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen gegenwärtiger Lyrik erheblicher Prominenz erfreuen – eine Entwicklung, die bis in die Jetzt-Zeit erkennbar bleibt, sich gar noch verstärkt hat und sich bereits an der Masse und Vielfältigkeit aktueller Formate und Projekte ablesen lässt:47 Neben den etablierten Nischen in einschlägigen Literaturzeitschriften wie Zwischen den Zeilen, Schreibheft, Sprache im technischen Zeitalter oder Akzente und den zahlreichen Anthologien und Aufsatzsammlungen,48 die sich gedichtpoetologischen Fragen widmen, gewinnen auch eigenständige Theorieunternehmen,49 Essayreihen50 oder Poetik-Plattformen51 zunehmend an Bedeutung. Unabhängig vom jeweiligen konkreten Anspruch und Geltungsumfang verbindet sich mit dieser jüngeren quantitativen Entwicklung zugleich eine vielfach proklamierte (und mancherorts tatsächlich beobachtbare) Etablierung gewandelter ›Tonlagen‹, eine Vitalisierung poetologischer Schreibweisen, die jedweden Gestus exklusiver Deutungslizenzen zu suspendieren scheinen und stattdessen dezidiert offene, explorative und prozessuale, d.h. nicht nur unabgeschlossene, sondern auch notwendig unabschließbare Entwürfe des Redens über und von Lyrik zu installieren suchen.52 Wenn Braun also in Auseinandersetzung mit der Lyrik der frühen 1990er Jahre die Autorendiskurse der ausklingenden Nachkriegsmoderne53 als »goldene[s] Zeitalter« der Lyrikpoetik apostrophiert, scheint der Argumentation – zugespitzt formuliert – ein gewisses Verständnis von Gegenwartsdichtung zu unterliegen, das sich nur noch ex post,54 mithin als Restaurations- oder Verfallsgeschichte aufarbeiten lässt. Die unterstellte Harmlosigkeit poetologischer Auseinandersetzung wurde denn auch mitunter begleitet vom Abgesang auf die gegenwärtige Lyrik per se, die ihrer attestierten gesellschaftlichen Dissoziiertheit und Funktionslosigkeit nurmehr willfährig begegne. Während noch die Literaturkritik der später 1980er und frühen 90er Jahre nicht selten die Nicht-Existenz eines differenzierten Lyrik-Diskurses monierte und dem Gedicht um die Wende-Zeit oftmals Innovationsmangel und akute Bewusstlosigkeit bescheinigen wollte,55 tut man indes gut daran, das literaturgeschichtlich stets ums Neue bemühte Bild einer sich verabschiedenden, gar für tot erklärten Poesie nicht allzu vorschnell zu reproduzieren56 und stattdessen die gegenwärtige Ambivalenz von Prekarisierung und neuer Energie, Randständigkeit und – die aus jener Marginalisiertheit allererst gewonnene – Produktivkraft ernst zu nehmen, ohne jedoch den ihrerseits präsenten literaturkritischen, verlegerischen wie auch autorenseitigen Apologemen57 unreflektiert gegenüberzustehen.
Nun sind gewiss weder Äußerungen über Lyrik durch Lyriker und Lyrikerinnen noch der Wille zu einer gewissen Reflexionshöhe neue Phänomene.58 Literaturgeschichtlich etabliert sich, nach der zwischenzeitigen Nobilitierung des Theoriediskurses in der lyrischen Moderne,59 spätestens mit Gottfrieds Benns Marburger Rede in der deutschsprachigen Lyrik-Diskussion bekanntlich die Einsicht, dass »Lyrik ohne Theorie der Lyrik […] nicht mehr möglich«60 sei – nicht obwohl, sondern gerade weil diese sich einer suffizienten definitorischen Übersetzung notorisch entziehe.61 Allerdings markiert die kurrente (und vereinzelt bemerkte62) Re-›Theoretisierung‹ des autorpoetologischen Lyrikdiskurses insofern ein auffälliges wie produktives Weiter- und Andersdenken ebendieses Dilemmas als einige jüngere poetologische Arbeiten ihren poetischen Gegenstand zwar weiterhin als grundsätzlich »fragwürdige[s] […] Phänomen«63 perspektivieren, die spezifischen Komplexitäten und Inkommensurabilitäten zwischen lyrischer Rede sowie des ›sich-mit-Lyrik-Auseinandersetzens‹ und ›über-Lyrik-Sprechens‹ indes vielfach gerade nicht gedanklich zu arretieren oder diskursiv aufzulösen versuchen, sondern jenes Sprechen vielmehr selbst permanent verhandeln, durch Mittel und Verfahren der Dichtung konfigurieren (lies: erweitern, dynamisieren, verunsichern, ironisieren, subvertieren usf.). Neben der bereits bemerkten neuen Pluralität und zahlenmäßigen Konjunktur gegenwärtiger Lyrikpoetologie scheint sich somit auch ein qualitativer shift anzuzeigen, indem das Verhältnis von Gedicht und Poetik, lyrischer Praxis und poetologischer Reflexion, Theorie und Poesie, Vers und Prosa, Evokation und Proposition im suspense gehalten und darin unablässig zur Disposition gestellt wird.64 Ferner indizieren nicht zuletzt auktoriale Darstellungs- und Inszenierungspraktiken auf der Ebene des Deutungs(nicht)wissens65 im Zeichen ›münchhausenhafter‹ Selbstbegründungsstrategien66 vielfach ein komplexes Ineinander von Affirmation und Absage, Bekenntnis zu und Demontage von lyrikpoetologischer ›Selbstbefragung‹ innerhalb derselben, sodass ihrer ästhetischen Eigenwertigkeit zugleich eine erkenntniskritische Valenz eignet.
In den hier untersuchten Texten von Oskar Pastior, Oswald Egger und Ann Cotten konzentrieren sich jene vorläufigen Beobachtungen, entwickelt sich mithin ein poetologisches Denken, das die obstinate ›Fragwürdigkeit‹ der Lyrik als produktive Provokation und intrinsischen Antrieb einer selbst zu befragenden Lyrikpoetologie fasst, die von dieser Fragwürdigkeitserfahrung ausgeht und sie zur Sprache zu bringen versucht, ohne sie je in einer begreifenden (Meta-)Kommunikation aufgehen, kontrollierbar werden zu lassen. Es ist dies ein Denken, in dem das poetologische Geschäft des Lyrikers und der Lyrikerin selbst, kurz: die reflexive Einholbarkeit der Poesie, in einem emphatischen Sinne auf dem Spiel steht.
Vielfach rekrutiert sich die zugrunde liegende Skepsis an einer solchen Einholbarkeit aus einer sprach- und systemphilosophischen Warte heraus, die die irreduzible ›Sprachlichkeit‹ sprachlichen Sprechens betont und in welcher der
Sprachraum sich […] einer betrachtenden Distanz [öffnet], die durchaus eine teilnehmende ist: der/die Beobachtende ist Teil des Systems. Das Sprechen über Sprache findet in der Sprache statt, von der es handelt – das Objekt der Untersuchung interferiert mit dem Subjekt. Diese Interferenz soll als grundlegend für die Versuchsanordnung gelten: keine Metaebene, keinen ÜberBlick, sondern mit der Sprache sprechen, auch im Hinblick auf mögliches Entgegenkommen.67
Der bei Barbara Köhler aufgerufene Modus der Interferenz meint nun aber nicht die Annahme einer radikalkonstruktivistischen (Wirklichkeits-)Beobachtung, sondern jene eminent problematisierende Begegnung, die sich weder mit postmodernen Verdunkelungen oder ekstatischer Sprachanarchie begnügen noch auf einen definitiven Kern ihres Objekts abzielen kann. Anvisiert wird in der hier eröffneten Erkenntnisszene vielmehr eine Form des ›Dazwischenschlagens‹, eine kritische Autodisposition, die gleichwohl nicht das Darstellungsprinzip der (Selbst-)Reflexion liquidiert.68 Vielmehr wird die Darstellung strategisch radikalisiert, indem sie auf einer Schwelle operiert, von der aus Beobachter und System, Subjekt und (Text-)Objekt nurmehr im wechselseitigen ›Entgegenkommen‹ und ›Distanznehmen‹, in Form einer relationalen Positionalität des ›Mit‹ ansteuerbar werden.69 Folgt man in diesem Zusammenhang den Ausführungen von Michel Serres, so markiert das Phänomen der Interferenz (gelesen als »Inter-Referenz«70) die Unverfügbarkeit globaler Referenzen71 und zugleich die potentielle Anwesenheit von dynamischen Rekursionen, Kopplungen und Korrespondenzen. Selbstbeobachtung – auch die der Lyrikerin – ist damit nie ›extern‹ zu haben. Dennoch kann sie driftende Bezüge und metonymische Zusammenhänge stiften, kann schließlich selbst Gegenstand po(i)etischer Auseinandersetzung werden. Bei Ann Cotten etwa wird das poetologische Denken immer wieder durch diese Logik der Interferenz affiziert, wird Selbstbeobachtung bisweilen ›geflutet‹72, unentwegt konfrontiert, disloziert, gestört; der archimedische Hebel gerät so zum ›archiwehischen‹73, Metatheorie zum »Meta-Manöver«74, Übersicht gleichsam zum hyperbolischen ›Über-Fall‹:
Es folgen nun ein paar informative Verzerrungen des Worts Überfall. Wie man mit den Händen eine Strumpfhose verzerrt. Es geht dabei um die Eigenschaft des Übermaßes, des Zuviels. Wie verhält sich ein Sachverhalt, wenn man ihn übertreibt?75
Details
- Pages
- 256
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631911747
- ISBN (ePUB)
- 9783631911754
- ISBN (Hardcover)
- 9783631911730
- DOI
- 10.3726/b21386
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (July)
- Keywords
- Gegenwartslyrik Lyrikpoetologie Literaturtheorie Gegenwartsliteratur-forschung Literaturwissenschaft spekulative Lyrikpoetologie
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 256 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG