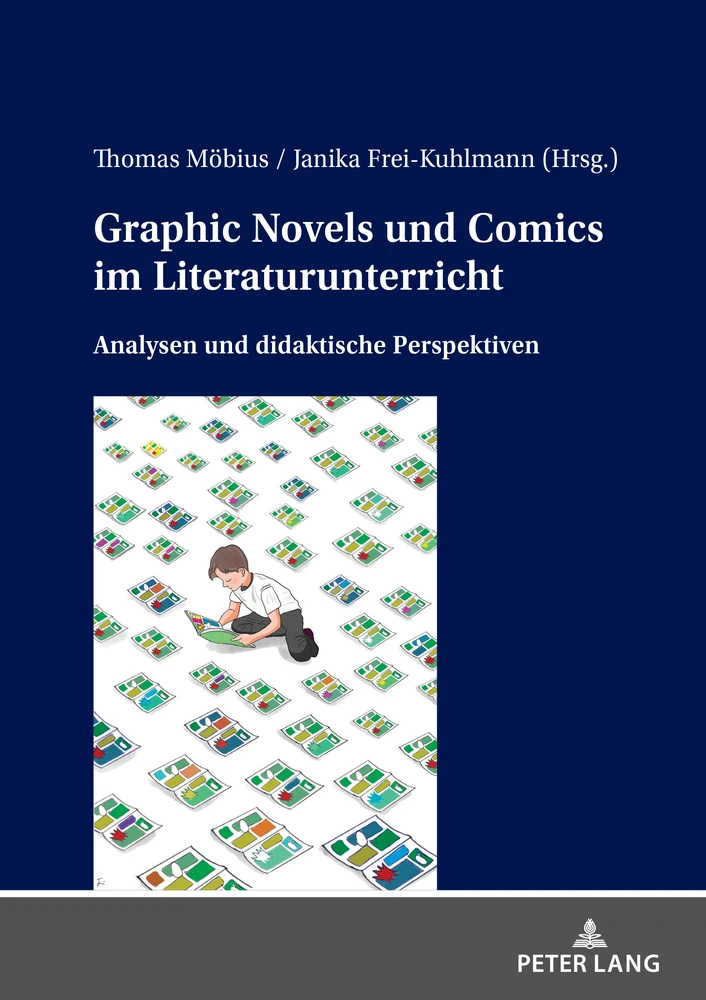Graphic Novels und Comics im Literaturunterricht
Analysen und didaktische Perspektiven
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Zur Einführung
- Zur Glaubwürdigkeit von erinnerter Vergangenheit in Nora Krugs Heimat und Barbara Yelins Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung ()
- Adaptionsstrategien in Graphic Novels: Eine literaturdidaktische Untersuchung der Literaturadaption Woyzeck ()
- Zur Notwendigkeit der Förderung comicspezifischer Lesekompetenz im Deutschunterricht. Lesedidaktische Überlegungen am Beispiel von Reinhard Kleists Knock Out! ()
- Hybride Formen der Graphic Novel zwischen fiktionaler und Sachliteratur ()
- Comics gemeinsam lesen und (digital) inszenieren. Literaturdidaktische Überlegungen für die Grundschule ()
- Didaktisches Potential von identitätsstiftenden Erzählfacetten in Mawils Kinderland ()
- Didaktische Potentiale grotesk-ironischer Vermittlung von sozialen Ungerechtigkeiten am Bespiel des Comics Alan Ford ()
- Comics und Graphic Novels – Komik in Text-Bild-Gefügen ()
- Graphic Novels im Englischunterricht: Zu den fremdsprachendidaktischen Potentialen einer multimodalen Textsorte ()
- Anders sein oder der Punk im Schrank (2019). Graphic Novel im fächerübergreifenden Unterricht ()
- Potentiale und Funktionen der phantastischen Graphic Novel für den Literaturunterricht am Beispiel von Die Stadt der Träumenden Bücher von Walter Moers und Florian Biege ()
- In dex
Zur Einführung
„Romane in Comicform“, „Graphic Novels“, „Autorencomics“ – es existieren zahlreiche Bezeichnungen zur Beschreibung einer Literaturform, die in den letzten Jahren nicht nur auf dem Literaturmarkt an Bedeutung gewonnen hat, sondern auch in der Forschung zunehmend Beachtung findet. Gemeint sind damit zumeist jene Texte, die durch eine spezifische Kombination aus Bild- und Textanteilen Geschichten erzählen oder faktuale Sachverhalte darstellen, wie dies bei Graphic Novels oder Sach-Comics der Fall ist. Da sich eine einheitliche Begriffsverwendung, die insbesondere eine Abgrenzung zwischen der Bezeichnung „Comic“ und „Graphic Novel“ in den Blick nimmt, in der Forschungslandschaft noch nicht durchgesetzt hat, obliegt die Begriffsbestimmung in diesem Sammelband den Autoren und Autorinnen in ihren jeweiligen Beiträgen.
Comics und Graphic Novels sind längst mehr als vermeintlich „komische“, „leichte“ oder ausschließlich „unterhaltende“ Literatur. Die Bandbreite der Spielarten ist zu groß, um Comics und Graphic Novels typisierende Attribute zuzuweisen. Denn durchaus können sowohl (und nicht ausschließlich) Comics als auch Graphic Novels komische Elemente enthalten, dies gilt jedoch nicht für alle Publikationen. Gleichermaßen unterscheiden sie sich – wie jede andere Literaturform auch – in ihrer Komplexität, sodass eine Kategorisierung von Comics und Graphic Novels oder gar von grafischer Literatur im Bereich der (früh-)kindlichen Lesesozialisation ein Trugschluss ist. Weder ist der Comic spezifisch an kindliche Rezipientinnen und Rezipienten gerichtet noch zielt die Graphic Novel ausschließlich auf ein erwachsenes Publikum ab. Vielmehr zeigen gerade die zum Teil experimentellen Darstellungsformen und die daraus resultierenden komplexen Erzählstrukturen, dass sich Comics und Graphic Novels als eigenständige Kunstform mit spezifischen Rezeptionsanforderungen behaupten. Während Comics im französischsprachigen Raum mit den „bande dessinée“ bereits als „neunte Kunst“ und nationales Kulturgut etabliert sind, lässt sich in der deutschsprachigen literarischen Öffentlichkeit erst seit einigen Jahren eine zunehmende Wertschätzung und gesteigerte Aufmerksamkeit insbesondere für Graphic Novels beobachten: Graphic Novels erscheinen in Buchbesprechungen (und) im Feuilleton, und auf den Listen renommierter Literaturpreise wie dem Deutschen Jugendliteraturpreis finden sich regelmäßig Graphic Novels unter den Nominierten und Preisträgern. An der steigenden Anzahl an Publikationen, Unterrichtsvorschlägen und Tagungen, die Comics und Graphic Novels aus didaktischer Perspektive beleuchten, lässt sich auch im Forschungskontext ein gestiegenes Interesse ablesen. Unter den jüngeren Publikationen finden sich unterrichtspraktische und fächerspezifische Überlegungen (vgl. z.B. Hainmüller/Möbius 2022, Ammerer/Oppolzer 2022), didaktische Perspektiven (vgl. z.B. Wittig 2022, Engelns/Giesa/Preußer 2021, Granzow 2020, Hoffmann/Führer 2017), Themenhefte mit dem spezifischen Schwerpunkt „Graphic Novel“ und „Comic“ (vgl. z.B. Praxis Deutsch 252/2015, KJL&M 65/2013, Grundschule Deutsch 35/2012) sowie eine Vielzahl an Einzeltextanalysen mit didaktischen Perspektivierungen (vgl. z.B. Führer/Wilde 2024, Frei 2023, Emmersberger 2021).
Der vorliegende Sammelband ist unter anderem aus den Beiträgen der Tagung und Lehrerfortbildung „Graphic Novels im Deutschunterricht“ hervorgegangen, die am 2. Februar 2023 an der Justus-Liebig-Universität Gießen stattfand, er versucht, die Vielfalt der vorgestellten Themen und die geführten Diskussionen widerzuspiegeln. Besonders erfreulich war die rege Teilnahme zahlreicher hessischer Lehrkräfte, die ihr Interesse an Graphic Novels im Deutschunterricht deutlich machten. Die lebendigen Diskussionen zeigten jedoch auch, dass insbesondere Comics und Graphic Novels im schulischen Kontext noch eine untergeordnete Rolle spielen. Es wurde deutlich, dass trotz des großen Interesses und der Relevanz einer Auseinandersetzung mit grafischer Literatur weiterhin Handlungsbedarf besteht, um das Thema stärker in den schulischen Alltag zu integrieren. Zu Unrecht sind Comics und Graphic Novels als Unterrichtsgegenstand bislang wenig etabliert, denn sie bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten für eine unterrichtliche Auseinandersetzung, die in den folgenden Beiträgen ausgelotet werden. Dabei können Comics und Graphic Novels als Lerngegenstände zur Vermittlung sprachlicher und literarischer Verstehenskompetenz oder zur Initiierung literar- und bildästhetischer Erfahrung im Unterricht genutzt werden.
Der vorliegende Band versammelt Beiträge, die sich aus literaturdidaktischer Perspektive mit dem Potenzial von Comics und Graphic Novels für den Deutsch- und Englischunterricht auseinandersetzen und Anregungen für den Einsatz von Comics und Graphic Novels im Literaturunterricht geben wollen.
Dabei stehen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund:
- Thomas Möbius untersucht in seinem Beitrag, wie Nora Krug und Barbara Yelin in ihren Graphic Novels Erinnerung ästhetisch gestalten und wie sie sich dabei der noch verfügbaren Quellen mit dem Ziel bedienen, aus ihnen glaubwürdige Aussagen über die Zeit des Holocaust und des Nationalsozialismus abzuleiten. Die Analyse geht der Frage nach, welche ästhetischen Mittel verwendet werden, um gleichermaßen Authentizität wie historische Glaubwürdigkeit zu erzeugen und in welcher Weise die gewonnenen Erkenntnisse aus der rekonstruierten Vergangenheit die Einstellung zu eben dieser Vergangenheit beeinflussen.
- Janika Frei-Kuhlmann befasst sich in ihrer Analyse mit Literaturadaptionen in Form von Graphic Novels und geht am Beispiel von Woyzeck der Frage nach, wie eine differenzierte Auseinandersetzung mit Literaturadaptionen sowohl den Prätext als auch die Adaption wertschätzend in den Blick nehmen kann und wie solche Adaptionsstrategien didaktisch modelliert werden.
- Tihomir Engler und Florian Rauscher nehmen mit Mawils Kinderland das Thema „Adoleszenz“ in den Blick und untersuchen, wie das Thema „Identität“ vor dem Hintergrund der Wendezeit im Jahre 1989 graphisch und sprachlich gestaltet wird.
- Auch José Fernández Pérez beschäftigt sich mit einem Text, der in der DDR der 1980er Jahre angesiedelt ist. Die Graphic Novel Anders sein oder der Punk im Schrank thematisiert politische Zusammenhänge explizit mittels der inszenierten Handlungen und Reflexionsmomente der Figuren, für die Punk-Musik unter anderem die Sehnsucht nach einer Veränderung ausgedrückt. Im Sinne einer „reflexiven Erinnerungskultur“ kann die Behandlung der Graphic Novel im fächerübergreifenden Unterricht dazu dienen, historisches Lernen zu initiieren, mithin die Mechanismen totalitärer Strukturen zu erkennen, eine Sensibilität für die Folgen dieser Strukturen zu entwickeln und eine Orientierungshilfe für gegenwärtiges und künftiges Handeln zu ermöglichen.
- Petra Zagar-Sostaric und Tihomir Engler stellen mit Alan Ford einen Comic vor, der in Deutschland kaum bekannt ist, während er im Jugoslawien der 1970er Jahre eine große Popularität genoss. In ihrem Beitrag arbeiten sie an zahlreichen Beispielen die teilweise grotesk-ironische Darstellung der Realität heraus und belegen die ungebrochene Aktualität des Klassikers.
- Anna Rebecca Hoffmann beschäftigt sich mit dem immer wichtiger werdenden Bereich der Sach-Graphic-Novels, die mittlerweile ein breites Spektrum an Themen und Genres abdecken. Sie untersucht die Gruppe der faktualen Graphic Novels, die fiktionale Elemente einbetten, im Hinblick auf Faktendarstellung, Authentisierungsstrategien und fiktionalisierende Elemente und formuliert auf dieser Grundlage didaktische Perspektiven.
- Renata Behrendt betrachtet Graphic Novels im Hinblick auf ihren Einsatz im Kontext der Leseförderung; am Beispiel von Reinhard Kleists Knock Out! zeigt sie, dass diese Graphic Novel anspruchsvolle Anforderungen auf der hierarchiehöheren Ebene der Lesekompetenz stellt und dass die gezielte Vermittlung comicspezifischer Lesekompetenzen eine unabdingbare Voraussetzung dafür darstellt, komplexeres Leseverstehen zu erlangen.
- Caroline Wittig stellt in ihrem Beitrag drei in der Grundschule erprobte Varianten der Comicinszenierung vor: die Comiclesung mit Bild- und Geräuschekarten, die Panellesung sowie die digitale Comicinszenierung mit Hilfe eines Tablets. Neben konkreten Einblicken in den Arbeitsprozess formuliert sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenartigen Comicinszenierungen.
- Melissa Heitzenröder widmet sich dem Fantasy-Genre in der Form der Graphic Novel. Am Beispiel von Die Stadt der Träumenden Bücher von Walter Moers und Florian Biege wird untersucht, inwieweit ihr unterrichtlicher Einsatz das literarische und das soziale Lernen unterstützen kann.
- Jennifer Neumann geht von dem Befund aus, dass Graphic Novels häufig „ernste“ Themen behandeln, sie stellt die Frage, welche Bedeutung der Komik in graphischer Literatur zuteilwerden könnte. An drei Beispielen arbeitet sie heraus, wie auf Komik basierende Darstellungsverfahren nicht nur in den Dienst des „ernsten“ Themas gestellt werden, sondern auch der Unterhaltung dienen und damit die Lesemotivation fördern können. Komik sei, so resümiert die Autorin, im Curriculum ein bislang wenig behandeltes Gebiet, das mit dem Einbezug von Graphic Novels und Comics in die Lehre auch entlang ernster Themen einen Platz im Literaturunterricht einnehmen könne.
- Ivo Steininger richtet den Blick auf die Verwendung von Graphic Novels im Englischunterricht und stellt fest, dass v.a. Produkte aus dem englischsprachigen Raum dazu prädestiniert sind, Einblicke in zielkulturelle Diskurse soziale Aushandlungsprozesse zu geben. Nach einer Klärung des Verhältnisses von Graphic Novels und Comics setzt sich der Autor dann mit dem didaktischen Konzept der „visual literacy“ und dem Stellenwert der Textsorte für das literarische Lernen mit textsortenspezifischen Bauformen im Englischunterricht auseinander.
Wir verbinden mit diesem Sammelband den Wunsch, dass die angesprochenen inhaltlichen Aspekte, die vorgestellten Primärtexte und die didaktischen Überlegungen sowohl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung als auch für eine breitere Leserschaft eine wertvolle Ressource darstellt und die Diskussion über Comics und Graphic Novel aus didaktischer Perspektive weiter anregt. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung „Graphic Novels im Deutschunterricht“, die zu einer lebhaften Auseinandersetzung mit dem Gegenstand beigetragen haben. Unser besonderer Dank gilt den Beiträgerinnen und Beiträgern für ihre Vorträge und ihre Bereitschaft, ihre Forschungsergebnisse in diesem Sammelband zu teilen.
Literatur
- Ammerer, Heinrich/Oppolzer, Markus (Hrsg.) (2022): Was kann der Comic für den Unterricht leisten? Fachdidaktische Perspektiven auf ein subversives Erzählmedium. Münster/New York: Waxmann.
- Emmersberger, Stefan (2021): Nora Krugs Graphic Memoir Heimat. Eine Unterrichtsanregung zu literarischem Lernen mit einem Grenzgängertext zwischen Faktualität und Fiktionalität. In: MiDU. Medien im Deutschunterricht. Jg. 3/H. 2. DOI: 10.18716/OJS/MIDU/2021.2.12
- Engelns, Markus/Giesa, Felix/Preußer, Ulrike (Hrsg.) (2021): Comics in der Schule. Theorie und Unterrichtspraxis. Berlin: Christian A. Bachmann.
- Frei, Janika (2023): „Ich habe drei Väter“ – Erzählen vom Aufwachsen in einer Patchworkfamilie mit Bild und Wort. Narratologische und didaktische Überlegungen zur Graphic Novel „Drei Väter“ von Nando von Arb. In: Literatur im Unterricht (LiU). Texte der Gegenwartsliteratur für die Schule: Familie. 1/2023, S. 27–38.
- Führer, Carolin/Wilde, Lukas R.A. (2024): „spannend […] wegen […] den ganzen Geheimnissen, die man noch ähm halt, irgendwie lüften musste“ Lernen durch, zu und mit unzuverlässig erzählten Comics am Beispiel von Sascha Hommers ‚Insekt‘ (2006). In: Bernhardt, Sebastian (Hrsg.): Unzuverlässiges Erzählen in Literatur und Medien. Didaktische Perspektiven. Band 9 der Reihe Literatur – Medien – Didaktik. Berlin: Frank & Timme. S. 147–169.
- Granzow, Stefanie (2020): Anspruchsvolle Text-Bild-Symbiosen. Geeignete Lerngegenstände für den inklusiven Literaturunterricht? In: Glasenapp, Gabriele/Frickel, Daniela A./Kagelmann, Andre/Seidler, Andreas (Hrsg.): Kinder- und Jugendmedien im inklusiven Blick: Analytische und didaktische Perspektiven. Frankfurt a.M.: Peter Lang, S. 219–238.
- Grundschule Deutsch. Themenheft „Comic & Co“, Nr. 35/2012.
- Hainmüller, Nina/Möbius, Thomas (2022): Graphic Novels. Grafische Literatur im Deutschunterricht. Braunschweig: Westermann.
- Hoffmann, Jeanette/Führer, Carolin (2017): Zum didaktischen Potenzial von Graphic Novels. Erkenntnisse zur Rezeption von ‚Meine Mutter ist in Amerika‘ durch Grundschulkinder. In: Scherf, Daniel (Hrsg.): Inszenierungen literalen Lernens: kulturelle Anforderungen und individueller Kompetenzerwerb. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 192–206.
- KJL & M. Themenheft „Graphic Novels“, 65. Jg./2013.
- Praxis Deutsch. Themenheft „Graphic Novels“, H. 252/2015.
- Wittig, Caroline (2022): Panellesungen in der Grundschule. Eine rekonstruktive Fallstudie zu multimodalen Transformationen des Comics Lehmriese lebt! Münster: Waxmann.
Thomas Möbius
Zur Glaubwürdigkeit von erinnerter Vergangenheit in Nora Krugs Heimat und Barbara Yelins Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung
Abstract: Nora Krug und Barbara Yelin gestalten in ihren Graphic Novels Erinnerung und bedienen sich dabei der noch verfügbaren Quellen mit dem Ziel, daraus glaubwürdige Aussagen über die Zeit des Holocaust und des Nationalsozialismus abzuleiten. Die Analyse geht der Frage nach, welche ästhetischen Mittel verwendet werden, um gleichermaßen Authentizität wie historische Glaubwürdigkeit zu erzeugen und in welcher Weise die gewonnenen Erkenntnisse aus der rekonstruierten Vergangenheit die Einstellung zu eben dieser Vergangenheit beeinflussen. Als Ergebnisse können festgehalten werden: Eine wissenschaftliche Absicherung gilt in beiden Graphic Novels als Beleg der Glaubwürdigkeit. Während Yelin sprachlich-visuelle Gestaltungsmittel dafür nutzt, um den Prozess der allmählichen Vergegenwärtigung der Erinnerung darzustellen, sodass die traumatischen Erfahrungen verbalisiert und verifiziert werden können, nutzt Krug unter anderem das Werkzeug der Collage, das die traditionelle sequentielle Struktur des Comics konterkariert, im Gegenzug aber eine grafische Form der Zeitlosigkeit darstellt, die das Verstehen ermöglicht. Beiden Graphic Novels ist ein heuristisches Interesse gemein: Die Rekonstruktion der Vergangenheit aus den noch zugänglichen Quellen dient der Konfrontation und dem Verstehen des Erinnerten, in beiden Texten findet ein Prozess der (auch therapeutischen) Selbstklärung statt, an dessen Ende sowohl Nora Krug als auch Emmie Arbel mit einem veränderten Verständnis der Vergangenheit einen neuen Blick auf sich selbst und auf ihre Verantwortung in der Gegenwart werfen.
Details
- Pages
- 270
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631913123
- ISBN (ePUB)
- 9783631913130
- ISBN (Hardcover)
- 9783631913116
- DOI
- 10.3726/b21473
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (March)
- Keywords
- Comics Graphic Novels Deutschunterricht Englischunterricht
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford. 2025. 270 S., 22 farb. Abb., 8 S/W Abb., 1 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG