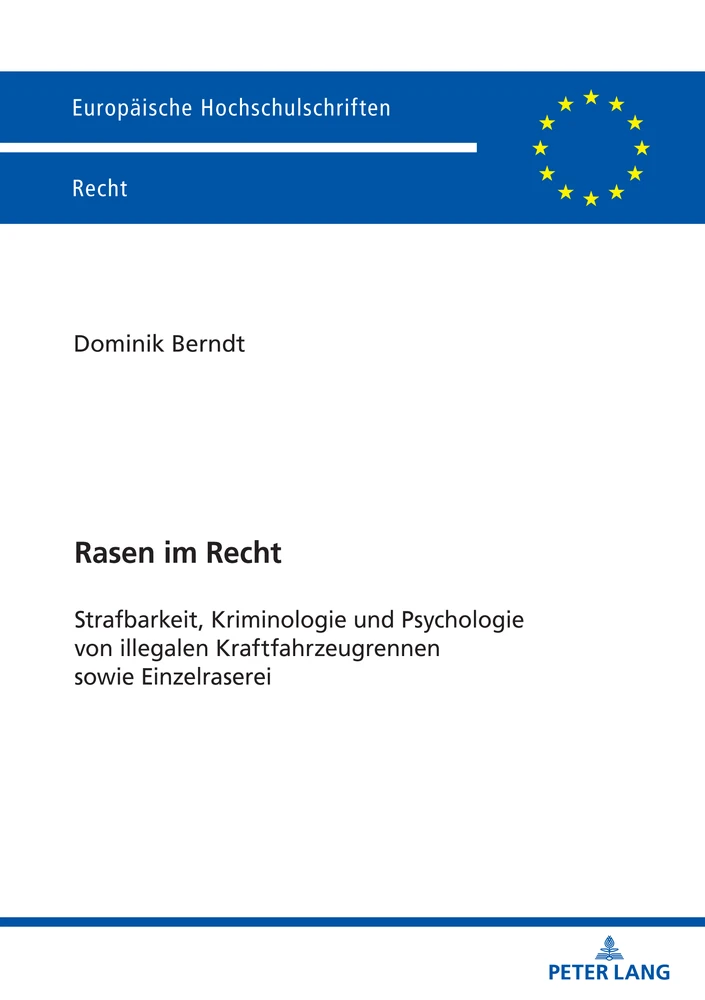Rasen im Recht
Strafbarkeit, Kriminologie und Psychologie von illegalen Kraftfahrzeugrennen sowie Einzelraserei
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- INHALTSÜBERSICHT
- RASEN IM RECHT
- A. Ein Rennen mit weitreichenden Folgen
- B. Die Untersuchung des Rasens
- C. Rasen als gesellschaftliches Phänomen und Problem
- I. Der Begriff des „Rasens“
- II. Verbreitung, Folgen und gesellschaftliche Wahrnehmung der Raserei
- III. Die Raser
- IV. Praktische Maßnahmen gegen Raserei
- D. Rasen nach neuer und alter Rechtslage
- I. Die Gesetzesänderungen im Allgemeinen
- II. Die Rechtslage im Konkreten
- III. Verschärfte Sanktionen als Folge
- E. Auswirkungen der Maßnahmen gegen Raserei
- I. Staatliche Sanktionen
- II. Weitere Maßnahmen
- III. Ergebnis
- F. Resümee
- G. Der Blick in die Zukunft
- H. Anhänge
- FORMALE ERLÄUTERUNGEN
- LITERATURVERZEICHNIS
- STICHWORTVERZEICHNIS
RASEN IM RECHT
A. Ein Rennen mit weitreichenden Folgen
Am 1. Februar 2016 kurz nach Mitternacht im Zentrum Berlins:
Der 24-jährige N wollte die K, mit der er zuvor den Abend in einem Steak-Restaurant und einer Bar verbracht hatte, mit seinem Auto nach Hause bringen. Seinen hochmotorisierten Mercedes-Benz CLA 45 AMG hatte er erst vor einigen Wochen geleast. Im Verlauf der Heimfährt hielt N wegen einer roten Ampel an der Kreuzung des Adenauerplatzes. Kurze danach hielt auch der 26-jährige H mit seinem Audi A6 3.0 TDI auf der Spur links neben N an und spielte mit dem Gaspedal, um auf sich aufmerksam zu machen.
Beim Blick in das jeweils andere Fahrzeug erkannten H und N, dass sie sich aus einer Shisha-Bar kannten, die beide häufiger aufgesucht hatten und wo auch andere junge Männern mit einer Vorliebe für schnelle Autos sowie anderen teuren Lifestyle-Produkten verkehrten. Sowohl N als auch H fuhren gerne schnell und ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln oder andere Verkehrsteilnehmer. So wurden bereits in der Vergangenheit rote Ampeln ignoriert, Geschwindigkeitsvorgaben innerorts teilweise um das Doppelte überschritten und Rennen gegen andere Gleichgesinnte gefahren. H trug wegen seines Fahrstils sogar den Spitznamen „Transporter“ in Anlehnung an den gleichnamigen Actionfilm aus Frankreich.
Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren H und N zügig los, hielten dann aber hinter der Kreuzung nebeneinander mitten auf der Fahrbahn an, um sich durch die geöffneten Seitenscheiben miteinander zu unterhalten. Als beide durch das Hupen anderer Fahrzeuge zur Weiterfahrt aufgefordert wurden, gab H, der zuvor erneut mit dem Gas gespielt hatte, Vollgas. N sah dies als Aufforderung zu einem Stechen zwischen ihnen an und beschleunigte ebenfalls maximal. Aufgrund der deutlich stärkeren Motorisierung von Ns Mercedes mit 380 PS gegenüber Hs Audi mit 224 PS kam N nach 300 m als erster an der nächsten roten Ampel zum Stehen.
Der danach neben ihm anhaltende H forderte N durch Aufheulenlassen seines Motors direkt zu einer Revanche heraus. N ließ sich darauf ein und so rasten beide beim Umschalten der Ampel wieder los. Erneut war N schneller und hielt nach 270 m an der nächsten roten Ampel an. H blieb dort jedoch nicht stehen, sondern überfuhr mit hoher Geschwindigkeit die Haltelinie, um N zu einer längeren Wettfahrt herauszufordern. Nach kurzem Zögern ließ sich N auf die weitere Wettfahrt ein und nahm stark beschleunigend die Verfolgung des H über den Kurfürstendamm auf. Mit hoher Geschwindigkeit holte N den nicht viel langsamer fahrenden H fast ein, als zwei Fußgängerinnen, die gerade von der Mittelinsel aus die Straße kreuzen wollten, verängstigt hinter das Geländer des Eingangs zum U-Bahnhof Uhlandstraße sprangen, um nicht von den Fahrzeugen erfasst zu werden. N und H setzten ihre Wettfahrt auf dem Kurfürstendamm dicht bei- und nebeneinander mit sehr hohen Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gen Osten fort. Dabei wurden auch rote Ampeln ignoriert und jeder versuchte sich von dem anderen entscheidend abzusetzen, um das Rennen zu gewinnen. Kurz vor der Kurve am Breitscheidplatz konnte N seinen Konkurrenten überholen, weshalb H die Kurve mit annähernd der Grenzgeschwindigkeit von 130 km/h durchfuhr. Die noch in der Kurve befindliche Ampel wurde gleichfalls bei Rot überfahren, wobei H noch ein auf der Mittelspur stehendes Taxi über die rechte Abbiegespur umfahren musste. Auf der von ihm nun befahrenen rechten Spur befand sich in nur 40 m Entfernung nach dem Kurvenausgang eine abgesperrte Baustelle, der H entweder nach rechts über die Busspur oder links hinter dem noch immer führenden N ausweichen musste. Da die folgende Strecke der Tauentzienstraße ausschließlich gerade verlief, musste H das Risiko nochmals steigern, um den besser motorisierten Mercedes des N überholen und das Rennen doch noch für sich entscheiden zu können. Deshalb beschleunigte H seinen Audi mit Vollgas, obwohl er wie auch N bereits die nächste rote Ampel an der 250 m entfernten Kreuzung sah, deren kreuzende Nürnberger Straße man wegen der seitlichen Bebauung und Bepflanzung nach rechts nicht einsehen konnte. H holte auf, was N bemerkte und deshalb ebenfalls wieder Vollgas gab, um vorn zu bleiben. Zirka 100 m vor der Kreuzung fuhr N mittlerweile 130 km/h, wobei H weiter aufholte. Beide hätten zu diesem Zeitpunkt mit einer Vollbremsung noch rechtzeitig vor der roten Ampel zum Stehen kommen können. N ging wegen der noch immer Rot zeigenden Ampel für eine Sekunde vollständig vom Gas, wohingegen H weiter maximal beschleunigte. Da H so weiter aufholte und auch N das Rennen unbedingt gewinnen wollte, trat N das Gaspedal seines Mercedes aber wieder beständig bis zum Anschlag durch. 35 m vor der Kreuzung betrug Ns Vorsprung nicht einmal mehr zwei Fahrzeuglängen und verringerte sich weiter. Keine 20 m weiter löste er nochmals das Gaspedal reflexartig für den Bruchteil einer Sekunde, nur um es direkt wieder voll durchzudrücken.
Annähernd auf gleicher Höhe raste N auf der linken Spur mit 134 km/h und H auf dem rechten Busfahrstreifen mit mehr als 160 km/h über die Haltelinie der Kreuzung – noch immer bei Rotlicht. In diesem Augenblick fuhr gerade der 69-jährige Rentner W in seinem älteren Jeep Wrangler mit vorgeschriebener Geschwindigkeit bei Grünlicht von rechts in die Kreuzung ein, um die von H und N befahrene Straße zu kreuzen. Auf der Kreuzung stieß H ungebremst mit der Front seines Audi auf Höhe der Vorderachse in die linke Seite des Jeeps. Dabei drang der Audi über einen halben Meter in die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs ein und unterfuhr dieses. Dadurch wurde der Jeep quer in die Luft geschleudert, wobei er nach links um die Längsachse zu rotieren begann. Nach 25 m landete das Fahrzeug mit der Fahrerseite auf der Straße und rutschte weiter, bis es erst nach knapp weiteren 50 m kurz vor der nächsten Einmündung zur Passauer Straße zum Liegen kam.
Der Mercedes des N verfehlte den Jeep auf der Kreuzung nur knapp, wurde aber von dem durch die Kollision nach links gedrückten Audi an der rechten Fahrzeugseite getroffen und gleichfalls nach links abgelenkt. Dadurch stieß der Mercedes mit seiner linken Fahrzeugfront gegen einen Ampelmast auf der Mittelinsel und knickte diesen überfahrend um. Sowohl Hs Audi als auch Ns Mercedes prallten anschließend mit weiterhin hohen Geschwindigkeiten gegen die direkt links von der Fahrbahn stehenden Hochbeete mit Graniteinfassung auf der Mittelinsel. Dabei hob der Mercedes ab, flog einige Meter durch die Luft und blieb nach weiterem Auslauf auf einem Hochbeet auf der anderen Seite der Mittelinsel liegen. Der Audi stieß noch mehrmals gegen die steinernen Hochbeete und kam erst gute 50 m weiter auf der Straße zum Stehen.
Der Jeep wurde infolge des Zusammenstoßes mit dem Audi im Bereich des Aufpralls links massiv eingedrückt, das linke Vorderrad und die Motorhaube abgerissen sowie das Dach stark deformiert. Auch der Audi und der Mercedes wurden schwer beschädigt. Durch die verschiedenen Kollisionen wurden nicht nur ganze Fahrzeugteile abgerissen, sondern auch einzelne Granitblöcke aus den Hochbeeten herausgeschlagen, die zusammen mit weiteren Teilen und Splittern bis zu 70 m weit flogen und Passanten am Straßenrand teilweise nur knapp verfehlten.
H und N konnten ihre Fahrzeuge nach dem Unfall selbstständig und nur leicht verletzt verlassen. K wurde als Beifahrerin im Mercedes erheblich verletzt, musste aber nur zwei Tage im Krankenhaus bleiben. Dagegen erlitt W durch die Kollision des Audis mit seinem Jeep infolge der stumpfen Gewalteinwirkungen schwerste multiple Verletzungen, sodass er direkt an der Unfallstelle verstarb.1
1 - Das beschriebene Geschehen stellt die wahren Gegebenheiten des sogenannten Berliner Raserfalls auf dem Kurfürstendamm zusammenfassend dar und beruht auf entsprechenden Feststellungen des Landgerichts Berlins: LG Berlin, (535 Ks) 251 Js 52/16 (8/16), Urteil vom 27.02.2017, Rn. 3 ff. – im Internet abrufbar: www.juris.de (Stand: 11.04.2020) und LG Berlin, (532 Ks) 251 Js 52/16 (9/18), Urteil vom 26.03.2019 (unveröffentlicht), S. 4 ff.; LG Berlin, (529 Ks) 251 Js 52/16 (6/20), Urteil vom 02.03.2021, Rn. 6 ff. – im Internet abrufbar: www.juris.de (Stand: 28.12.2022).
- - Beachte zu allen Fußnoten die formalen Erläuterungen auf S. 280.
B. Die Untersuchung des Rasens
Es sind Vorfälle wie diese, die deutschlandweit für Aufsehen sorgen. Dabei ist die Betroffenheit und Entrüstung groß, auch weil es jeden hätte treffen können. Und unweigerlich kommen die Fragen auf, wie es zu solchen Raserfällen kommen und was dagegen getan werden kann.
Die komplexen Antworten auf diese Fragen handeln vom Menschen, seiner Natur, seiner Psyche, dem gemeinsamen Zusammenleben, Gesellschaftsstrukturen, staatlicher Macht, Recht und Kriminalität.
Aus all diesen und noch weiteren Blickwinkeln untersucht die vorliegende juristische Dissertation „Rasen im Recht“ das menschliche Verhalten, Kraftfahrzeuge auf öffentlichen Straßen unter grober Missachtung der Verkehrsregeln wie Rennmaschinen auf Rennstrecken zu bewegen. Dabei wird nicht nur abstrakt eine Antwort auf das „Warum?“ solchen Fehlverhaltens gegeben. Vielmehr wird weitergehend die in diesem Kontext bestehende neue Rechtslage seit Oktober 2017 im Vergleich zur vorherigen analysiert, hinterfragt und fortentwickelt. Darauf aufbauend wird erforscht, welche Auswirkungen die alten und neuen Maßnahmen gegen das Rasen haben (können) und welche weitergehenden Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.
Konkret wird im ersten Kapitel das hier zu untersuchende Fehlverhalten, das allgemein als „Rasen“ bezeichnet werden kann, genauer eingegrenzt und definiert. Daran anschließend wird der Frage nachgegangen, wie weit das Rasen verbreitet ist, welche Folgen es tatsächlich hat und wie es von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Sowohl für die Frage nach dem „Warum?“ als auch nach den Gegenmaßnahmen gilt es sodann herauszufinden, welche Personen ein solches Verhalten zeigen und vor allem was sie dazu veranlasst. Dabei müssen nicht nur das gesellschaftliche Umfeld und die Lebensverhältnisse, sondern vor allem auch das psychische Innenleben der Personen untersucht werden, um möglichst umfassend alle Motive und Gründe für das Verhalten zu ermitteln. Zum Ende dieses Kapitels werden als Bestandsaufnahme die wichtigsten Maßnahmen herausgearbeitet, die der Staat in der Vergangenheit gegen Raserei getroffen hat. Im zweiten Kapitel wird die Raserei aus rechtlicher Sicht analysiert. Dabei steht die neue Rechtslage nach der Gesetzesänderung2 vom Oktober 2017 im Vordergrund, wobei die vorherige damit verglichen wird. Allgemein wird nach Straf-/Ahndungsvorschriften (im engeren Sinne), fahrerlaubnisrechtlichen Vorschriften und Vorschriften der Einziehung als Normen mit verschiedenartigen Regelungsinhalten differenziert. Bei ersteren bezieht sich die Untersuchung hauptsächlich auf die straßenverkehrsbezogenen Bereiche des StGB und dort insbesondere auf den neuen § 315d StGB3, dessen Strafgrund und Tatbestandsmerkmale besondere Aufmerksamkeit erhalten. Bei den Strafbarkeiten treten auch strafrechtsdogmatische Problemfelder des allgemeinen Teils zutage, vor allem die Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, die genauen Anforderungen der Mittäterschaft sowie die Möglichkeit und Voraussetzungen einer wirksamen Zustimmung zur eigenen Rechtsgutsgefährdung und -verletzung. Im zweiten Bereich der fahrerlaubnisrechtlichen Vorschriften werden dazugehörige Sanktionen für Raser nach dem StVG und StGB behandelt. Der dritte Bereich der Einziehungsvorschriften geht auf Grundlage der seit Juli 2017 bestehenden neuen Gesetzeslage auf dem Gebiet der Vermögensabschöpfung4 der Frage nach, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Einziehung der zum Rasen eingesetzten Fahrzeuge möglich ist. Zum Kapitelende wird sanktionsübergreifend die mögliche Sanktionsintensität nach alter und neuer Rechtslage verglichen. Aufbauend auf den Erkenntnissen der ersten beiden Kapitel wird im dritten aus kriminologischer Sicht analysiert, welche Auswirkungen die Maßnahmen gegen Raserei in der Realität haben können. Die einzelnen Sanktionen und die sonstigen Maßnahmen werden dafür auf ihre potenziellen Wirkungen untersucht. Gleichzeitig werden sie sowohl auf rechtlicher als auch tatsächlicher Ebene hinsichtlich möglicher Optimierungen in den Blick genommen und konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht. Am Kapitelende kann im Rahmen einer Gesamtwirkung gesagt werden, wie aussichtsreich all diese Maßnahmen gegen die Raserei sind. Inhaltlich schließt die Arbeit mit einem zusammenfassenden Gesamtergebnis und wirft zuletzt noch einen Blick in die Zukunft.
2 Gemäß dem Sechsundfünfzigsten Strafrechtsänderungsgesetz – Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr vom 30.09.2017 (BGBl. I 2017, S. 3532).
3 Zur besseren Lesbarkeit wird für die §§ des StGB im Folgenden auf die Gesetzesangabe verzichtet (siehe dazu auch S. 280).
4 Gemäß dem Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 872).
C. Rasen als gesellschaftliches Phänomen und Problem
Was ist nun unter dem Begriff des „Rasens“ als menschliches Verhalten genau zu verstehen und wie sehr betrifft es unsere heutige Gesellschaft?
I. Der Begriff des „Rasens“
Das Wort „rasen“, wohlgemerkt als Verb, beschreibt einerseits den Vorgang des sehr schnellen (Fort-) Bewegens und andererseits eine besonders aufbrausende Form der Aufregung.5 Meist wird es nach erster Bedeutung im Kontext mit hohen Geschwindigkeiten von Fahrzeugen verwendet, worum es auch hier gehen soll. Dabei kann sich jede Person etwas unter „rasen“ vorstellen, wobei der Begriff im Recht nicht verwendet wird. Das könnte der Schwierigkeit geschuldet sein, über die allgemeine Wortbedeutung hinaus eine konkretere Beschreibung oder gar Definition zu finden.
Da der Begriff des „Rasens“ in dieser Arbeit als Sammelbegriff für sämtliches Verhalten im Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Straßenverkehr verwendet wird, bedarf es einer genaueren Begriffsklärung.
Die problematische Frage dabei ist, ab wann sich ein Fahrzeug schnell genug fortbewegt, dass es nicht nur (normal) schnell, sondern so (sehr) schnell ist, dass es rast. Für die Ermittlung dieser Geschwindigkeitsgrenze sollte zuerst ein möglichst konkreter Anknüpfungspunkt gefunden werden. Die Verwendung des Begriffs in der Alltagssprache oder den Medien ist dafür eher unbrauchbar, weil es an einem auch nur halbwegs einheitlichen Wortgebrauch fehlt und die Streuung der einbezogenen Geschwindigkeitsbereiche sehr weit ist.6 Die gesetzlichen Regeln des Straßenverkehrs für die maximal erlaubte Geschwindigkeit ermöglichen hingegen eine klarere Grenzziehung. Grundsätzlich darf nach § 3 I 1, 2 (auch i.V.m. § 1) StVO nur so schnell gefahren werden, dass das Fahrzeug unter den gegebenen Bedingungen allzeit sicher beherrscht wird. Häufig werden diese allgemeinen Bestimmungen durch konkrete Regeln ergänzt, die auch unter optimalen Bedingungen eine maximal zulässige Geschwindigkeit festlegen (so insb. nach § 3 III StVO und nach §§ 45 I 1, 39 II, 41 I StVO mittels Verkehrszeichen). Situationsabhängig kann eine nach § 3 I StVO auch deutlich darunter liegende angepasste Geschwindigkeit verlangt werden,7 so z. B. bei geringer Sicht, schlechter Witterung, engen Kurven oder anderen gefährlichen Straßengegebenheiten. Insofern kann rechtlich zwischen dem Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Überschreiten der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit unterschieden werden (so auch: lfd.-Nr. 8 und 11 der Anlage zu § 1 I BKatV8). Hält sich ein Fahrer an diese Vorgaben, fährt er vorschriftsmäßig. Dies entspricht grundsätzlich der einzuhaltenden Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr, weshalb es sich um normales und nicht zu schnelles Fahren handelt. Dementsprechend erfordert Rasen zumindest eine Geschwindigkeit, die über der erlaubten liegt.9 Dies wird auch durch den allgemeinen Wortgebrauch gestützt, als nur dann von rasen die Rede ist, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wird.
Ein konkreter Anknüpfungspunkt ist so zwar gefunden, allerdings stellt dieser nur die Grundvoraussetzung des Rasen-Begriffs dar, weil nicht jede regelwidrige Geschwindigkeitsübertretung ein sehr schnelles Fahren ist. Schon die Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit um 1 km/h ist eine Regelverletzung, die im Vergleich zur vorgeschriebenen Geschwindigkeit aber nicht ins Gewicht fällt. Für die Grenze zwischen normalem zu schnellem Fahren und Rasen helfen deutsche Gesetze mangels spezifischer Regelungen wenig weiter, doch findet man eine genaue Regelung in Art. 90 des Schweizer Straßenverkehrsgesetzes (SVG). Demnach ist eine doppelt so hohe Geschwindigkeit bei erlaubten 50 oder mindestens 80 km/h (Art. 90 IV SVG) als „besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit“ anzusehen (Art. 90 III SVG). Das sind zwar konkrete Grenzwerte, die ebenso für das Rasen herangezogen werden könnten, doch stellt sich dabei wiederum die Frage, warum bei 1 km/h unterhalb dieser Grenzwerte kein Rasen vorliegen soll. Selbst das SVG trägt dieser Überlegung Rechnung, indem es die Grenzwerte nach Art. 90 IV SVG als Zumindest-Regelung ausgestaltet und Art. 90 III SVG auch bei geringeren Geschwindigkeiten erfüllt sein kann. Damit werden aber doch offene und keine abschließenden konkrete Geschwindigkeitsgrenzen getroffen. Letztere haben neben einer begründeten Grenzwertbestimmung auch das Problem, dass sie in bestimmten Fällen zu wenig Spielraum bieten. Beispielhaft kann das eine Konstellation veranschaulichen, in der auf einem Streckenabschnitt mit an sich zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h enge und nicht einsehbare Kurven verlaufen, deren sichere Durchfahrt bei Regen gemäß § 3 I StVO jedoch nur mit angepassten 40 km/h möglich ist. Würde dort nun 70 km/h gefahren, wäre dies zwar eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 75 %, die trotzdem deutlich unter den schweizerischen Grenzwerten läge. Selbst wenn die erhöhte Geschwindigkeit zu einem Kontrollverlust über das Fahrzeug führte, wäre dies danach kein Rasen. Zwar könnten selbstverständlich geringere Schwellenwerte herangezogen werden, doch bliebe das Problem der begründeten Grenzfindung und des fehlenden Spielraums gleichfalls bestehen.
Somit ist es nicht möglich, eindeutige Kriterien zu finden, die eine abschließende Grenzziehung zwischen (normalem) Zu-schnell-Fahren und Rasen anhand konkreter Geschwindigkeiten ermöglichen. Auch wenn klare Grenzwerte den Vorteil von Eindeutigkeit und Rechtssicherheit haben, womit sie gegenüber allgemeinen Formulierungen grundsätzlich vorzugswürdig sind, muss hier darauf verzichtet werden. Da nicht jede Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit Rasen darstellt, kann anstatt der konkreten Grenzgeschwindigkeiten eine vergleichbare, allgemeinere Schwelle herangezogen werden. Die aus vielen anderen Rechtsvorschriften bekannte Erheblichkeit reicht zwar von der Wortbedeutung her etwas weiter als „sehr schnell“ der allgemeinen Begriffsumschreibung des Rasens, ermöglicht dafür aber eine solide Grenzziehung sowie größere Flexibilität in Zweifelsfällen.
Eine besondere Beachtung erfordern in diesem Zusammenhang die zirka 75 % der deutschen Bundesautobahnen10 sowie sonstige Streckenabschnitte, auf denen keine konkreten Geschwindigkeitsbeschränkungen vorgeschrieben sind. Dort gilt nach § 3 III Nr. 2 lit. c S. 2 u. 3 StVO i.V.m. § 1 I AB-Rg-VO11 die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, die lediglich eine Empfehlung darstellt, weshalb das Fahren mit höheren Geschwindigkeiten grundsätzlich erlaubt ist.12 Allerdings entfaltet § 3 I (auch i.V.m. § 1) StVO hier ebenfalls Wirkung und schreibt mit der jederzeit sicheren Fahrzeugbeherrschung eine maximal erlaubte Geschwindigkeit vor, deren Überschreitung rechtswidrig und damit verboten ist.13 Unter diesen Voraussetzungen kann also auch auf Strecken ohne konkrete Geschwindigkeitsbeschränkung zu schnell gefahren werden.
Unbedeutend für den Begriff des Rasens ist, mit welcher Kraftfahrzeugart (Automobil, Motorrad, Quad, Elektro-Fahrrad) und wie genau der Geschwindigkeitsverstoß begangen wird. Letzteres meint die konkreten sonstigen Umstände der Fahrt: Das alleinige Zu-schnelle-Fahren ist bei Erheblichkeit ebenso ein Rasen, wie ein illegales Straßenrennen gegen andere oder die Flucht vor der Polizei im Rahmen einer Verfolgungsjagd.
Insgesamt ist unter „Rasen“ jedes menschliche Verhalten zu verstehen, bei dem der Fahrer mit seinem Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr die erlaubte Geschwindigkeit erheblich überschreitet.
II. Verbreitung, Folgen und gesellschaftliche Wahrnehmung der Raserei
Das Rasen hat also verschiedene Erscheinungsformen. Fraglich ist, wie weit die Raserei verbreitet ist, welche Folgen sie hat und wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen wird.
1. Verbreitung der Raserei
Zur Verbreitung des Rasens in Deutschland existieren keine umfänglichen bzw. repräsentativen Statistiken und auch aus den Unfallzahlen oder der Anzahl der registrierten Geschwindigkeitsverstöße kann nicht verlässlich auf die tatsächliche Verbreitung der Raserei geschlossen werden.
Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass zu jeder Zeit um die 50 % der Fahrer die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschreiten.14 Werden dem tatsächliche, wenn auch nicht repräsentative, Zahlen aus umfangreichen Messungen an 190 innerstädtischen Straßen in vier deutschen Großstädten über jeweils 24 Stunden15 gegenübergestellt, fällt der Anteil der Geschwindigkeitsübertretungen deutlich geringer aus: Berechnungen auf dieser Grundlage ergeben, dass von den insgesamt 2.150.566 gemessenen Fahrzeugen lediglich zirka 16 % die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. Zu beachten ist dabei allerdings, dass wegen einer angenommenen Toleranz von 5 km/h eine Geschwindigkeitsübertretung erst ab einer Überschreitung von mindestens 6 km/h registriert wurde. Des Weiteren blieben andere Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, wie z. B. nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeiten, ebenfalls unberücksichtigt. Insofern lag der Anteil der tatsächlich zu schnell fahrenden Fahrer über den ermittelten 16 %.16
Auch wenn das hier zu untersuchende Rasen die erhebliche Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit erfordert, was nur bei wenigen dieser Geschwindigkeitsüberschreitung gegeben ist, zeigen die Messungen auch extreme Geschwindigkeiten, die mitunter deutlich mehr als doppelt so hoch wie erlaubt ausfielen (Höchstwerte: 137 bei erlaubten 50 km/h und 115 bei erlaubten 30 km/h). Auffällig ist, dass nachts vergleichsweise wesentlich höhere Geschwindigkeiten gefahren wurden als am Tag und auch die Höchstwerte fast durchweg bei Dunkelheit erreicht wurden.17
Bei einer europaweiten Untersuchung gaben 19 % der befragten deutschen Fahrer an, allgemein im Vergleich zu anderen schneller zu fahren. Außerdem berichteten 20 % auf Autobahnen, 16 % auf Landstraßen und 7 % in geschlossenen Ortschaften oft, sehr oft oder immer die zulässige Höchstgeschwindigkeit (ohne Toleranz) zu überschreiten.18 Schon die Differenz zwischen diesen 7 % und den soeben anhand tatsächlicher Messungen errechneten 16 % für Geschwindigkeitsverstöße in geschlossenen Ortschaften zeigt die Besonderheiten und die damit zusammenhängenden Probleme bei selbstbelastenden Befragungen. Regelmäßig wird nämlich das eigene unrechtmäßige bzw. nicht gewünschte Verhalten – hier: zu schnelles Fahren – von den Befragten relativiert (sog. soziale Erwünschtheit), sodass in der Realität von einer größeren Häufigkeit ausgegangen werden muss.19 Auch wenn die beiden Erhebungen nicht in direktem Zusammenhang zueinander stehen (unterschiedliche Untersuchungen mit verschiedenen Personen; nicht alle befragten, zu schnell Fahrenden fahren „immer“ zu schnell etc.), hindert das nicht, sie in Verbindung zueinander zu setzen. So kann jedenfalls ungefähr aus den anderen Befragungswerten auf das durchschnittliche tatsächliche Fahrverhalten von deutschen Kraftfahrzeugführern bei den anderen Straßenarten geschlossen werden.20
Die Abweichung unter den zu schnell Fahrenden zwischen den Messwerten in der Stadt und den Befragungswerten für diesen Bereich beträgt zirka 9,7 %,21 wobei angenommen wird, dass nur die Angaben zum ordnungsgemäßen Fahren teilweise fehlerhaft und die Abweichungen auf allen Straßen verhältnismäßig gleich ausfallen. Demnach fahren auf Landstraßen tatsächlich zirka 24,1 % und auf Autobahnen zirka 27,8 % der Fahrzeugführer zu schnell.22 Diese Werte sind wegen ihrer Ermittlung naturgemäß nochmals weniger präzise als die auf tatsächlichen Messungen beruhenden 16 % des innerörtlichen Verkehrs. Da es aber keine tatsächlichen Messungen für Landstraßen und Autobahnen gibt, bleibt nur dieser Weg, um hier zumindest Näherungswerte für das zu schnelle Fahren zu ermitteln. Werden nun alle Werte für Geschwindigkeitsverstöße auf den verschiedenen Straßentypen gleich gewichtet, erhält man eine durchschnittliche Gesamthäufigkeit an Geschwindigkeitsverstößen von zirka 22,6 % aller Fahrten.
Um mit diesem Wert die ungefähre Verbreitung der Raserei zu ermittelten, muss einerseits berücksichtigt werden, dass sich dieser mit seinen zugrundeliegenden Daten einerseits nur auf die Überschreitung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit und nicht auf eine ansonsten nicht angepasste Geschwindigkeit bezieht. Fälle von nicht angepasster Geschwindigkeit fallen unter normalen Bedingungen meistens mit dem Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zusammen, treten bei schwierigen Straßen- bzw. schlechten Wetterbedingungen demgegenüber aber häufiger in selbstständiger Form auf. Andererseits erfordert das Rasen definitionsgemäß die erhebliche Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit, welche allgemeingültig nicht konkret beziffert werden kann.23 Da die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten in ihrer Gesamtheit regelmäßig einer Normalverteilung (Gaußʼsche Glockenfunktion)24 folgen – sich also die Geschwindigkeiten zumeist im näheren Bereich der vorgeschriebenen/angemessenen bewegen und große Geschwindigkeitsabweichungen weniger häufig/wahrscheinlich sind – macht die Raserei als erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung nur einen kleinen Teil an den gesamten Geschwindigkeitsverstößen aus.25
Zur Ermittlung der Gesamtverbreitung des Rasens müsste folglich der zuvor ermittelte Wert der Häufigkeit an Geschwindigkeitsverstößen von 22,6 % einerseits – wegen der nicht erfassten Fälle rein unangepasster Geschwindigkeit – etwas erhöht und andererseits – wegen der für das Rasen notwendigen erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung – stark verringert werden. Welche Größe diese Faktoren besitzen, entzieht sich aber bisher wissenschaftlichen Erkenntnissen, weshalb hier aus anderen bekannten Daten Rückschlüsse auf das Rasen gezogen werden müssen. Da Fahrverbote im Rahmen von Geschwindigkeitsverstößen nur bei schwerwiegenderen Geschwindigkeitsüberschreitungen angeordnet werden,26 lassen sie sich hier zumindest zur statistischen Erfassung mit den für das Rasen notwendigen erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen gleichsetzen. Zwar existiert kein gesamtdeutsches Lagebild zur (anteiligen) Anordnung von Fahrverboten wegen überhöhter Geschwindigkeit, doch führt die Jahresstatistik 2019 des Bayerischen Polizeiverwaltungsamtes 1.110.945 ordnungswidrige Geschwindigkeitsverstöße im Berichtsjahr auf, aus denen 45,5 % aller verhängten Fahrverbote (Gesamtanzahl: 72.406) folgten.27 Damit wurde 2019 in Bayern bei fast 3 % aller erfassten ordnungswidrigen Geschwindigkeitsverstöße ein Fahrverbot angeordnet.28 Es bestehen keine ernsthaften Bedenken, diesen Wert auf ganz Deutschland zu übertragen. Geht man also davon aus, dass annähernd 3 % aller Geschwindigkeitsübertretungen Raserei darstellen,29 ergibt sich als Endergebnis für die Verbreitung des Rasens am Gesamtverkehr auf Deutschlands Straßen ein Anteil von zirka 0,7 %.30 Dabei beschreibt dieser Wert aufgrund der begrenzten Datenlage und des offenen Raserbegriffs weniger eine exakte Konstante als vielmehr eine möglichst konkrete Größenordnung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rasen einerseits zwar kein völliges Randphänomen darstellt, andererseits jedoch nur verhältnismäßig wenig verbreitet ist. Wegen der recht hohen Verkehrsdichte auf Deutschlands Straßen tritt es absolut gesehen aber immer mal wieder zutage.
Seltener und auch weniger sichtbar, weil sie vermehrt nachts stattfinden, sind sog. illegale Straßenrennen, bei denen mindestens zwei Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen gegeneinander um die Wette fahren. Solche Rennen können allgemein als besonders exzessives Rasen zu Wettkampfzwecken bezeichnet werden. Sie starten meist spontan und obwohl sie mit zunehmender Tendenz vermehrt in Innenstädten stattfinden, wird dabei nicht selten in den dreistelligen Geschwindigkeitsbereich vorgedrungen. Die wenigen organisierten illegalen Straßenrennen sind demgegenüber vorwiegend von eher professioneller Vorbereitung, vielen Teilnehmern sowie Start- und/oder Preisgeldern geprägt und weisen teilweise sogar internationale Bezüge auf. Rennen sollen von den Sicherheitsbehörden unbemerkt stattfinden, wobei bei den organisierten teilweise versucht wird, sie nach außen hin wie legale Veranstaltungen, z. B. als Schnitzeljagden, darzustellen.31
Statistisch genau erfasst werden illegale Straßenrennen in Deutschland aber nicht: Weder weisen die offiziellen Straßenverkehrsunfallstatistiken dieses Phänomen bei Unfällen separat aus, noch gibt es umfassende Zahlen zur Verbreitung oder polizeilichen Feststellungen derselben. Zwar registrieren einige Polizeibehörden solche Vorfälle genauer, so z. B. die Polizei Köln (77 Anzeigen wegen illegaler Straßenrennen von Januar bis Oktober 2016)32 und die Polizei NRW (230 solcher Anzeigen in 2015), doch gibt selbst die Bundesregierung zu, dass kein bundesweites Lagebild zu diesem Komplex existiert.33 Wegen einer Strafgesetzesänderung werden seit Ende 2017 mittlerweile vermehrt Zahlen zu Strafverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen von den Bundesländern erhoben. Allerdings sind die neueren Erfassungen, welche inhaltlich eine stark steigende Tendenz strafbarer Raserei ausweisen,34 an dieser Stelle nur begrenzt aussagekräftig. Denn sie umfassen zumeist neben originär illegalen Straßenrennen mit mehreren Beteiligten auch strafbare Fälle der Raserei einzelner Personen. Außerdem handelt es sich bei diesen Zahlen nur um eingeleitete Verfahren und nicht zwingend um (später) rechtskräftig bewiesene Vorwürfe. Demgegenüber erfasst zwar das Kraftfahrtbundesamt die rechtskräftig bestätigten Vorwürfe von Kraftfahrzeugrennen in ganz Deutschland – mit ebenfalls stark steigender Tendenz –, doch wird ebenso nicht zwischen den beiden verschiedenen Formen der Raserei unterschieden.35 Wegen ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen sollten sie aber besser statistisch getrennt erfasst werden. Für alle Zahlen gilt, dass Rennen an sich nur selten von der Polizei entdeckt werden, womit die Dunkelziffer sehr groß ist, und die statistische Zunahme der Verfahren auch mit auf eine zuletzt erhöhte polizeiliche Kontrolldichte zurückzuführen sein wird.36 Trotz fehlender exakter Statistiken kann zumindest anhand der bekannten Zahlen, einer entsprechenden Internetrecherche37 und unter Berücksichtigung des großen Dunkelfelds festgehalten werden, dass illegale Straßenrennen als – bedeutend kleinerer – Teil der Raserei mit nicht zu vernachlässigender Häufigkeit auftreten. Dabei sind sie nicht nur hierzulande ein Problem, sondern eine weltweite Erscheinung38.
Insgesamt ist Raserei auf Deutschlands Straßen durchaus präsent, doch stellt sie trotz ihrer Alltäglichkeit nur einen äußerst geringen Anteil am gesamten Verkehrsverhalten dar.
2. Folgen der Raserei
Die vom Rasen ausgehenden Gefahren hängen von der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und den möglichen Unfallfolgen ab. Neben der Verkehrssituation sind dafür vor allem folgende physikalische Faktoren maßgeblich:
- 1. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr Wegstrecke ( ) wird in der gleichen Zeit ( ) zurückgelegt ( ).39 D. h., um die gleiche Fahraktion innerhalb der gleichen Wegstrecke durchzuführen, müsste die Informationsverarbeitung, Reaktion und Durchführung durch den Fahrer entsprechend schneller erfolgen.
- 2. Je höher die (Ausgangs-) Geschwindigkeit ist, desto mehr Wegstrecke wird bei gleicher negativer Beschleunigung ( ) für den Bremsvorgang benötigt .40 D. h., um die Geschwindigkeit in der gleichen Wegstrecke auf den gleichen Wert zu reduzieren, müsste im Vergleich zu einer langsameren Ausgangsgeschwindigkeit eine stärkere negative Beschleunigung (Bremsung) erfolgen.
- 3. Je größer die bewegte Masse ist, desto mehr Kraft ( ) wirkt bei gleicher richtungsändernder Beschleunigung ( ) auf sie ( | ).41 D. h., um die gleiche Bewegungsänderung als Beschleunigung wie bei einer geringeren Masse zu erreichen, müsste eine entsprechend größere Kraft wirken.
- 4. Je höher die Geschwindigkeit bzw. je größer die bewegte Masse ist, desto größer ist die kinetische Energie ( ).42 D. h., für die gleiche Auf- prallenergie wie bei einer entsprechend geringeren Geschwindigkeit bzw. Masse müsste im Falle einer Kollision der jeweils andere Faktor entsprechend kleiner sein.
Mit höherer Geschwindigkeit und größerer Masse des Fahrzeugs erhöht sich demnach die Unfallwahrscheinlichkeit, denn es steigen die Fahranforderungen und gleichzeitig verringert sich die Fahrzeugbeherrschung. Auch die Schwere der Unfallfolgen hängt von der Geschwindigkeit und der Masse ab, denn sie bestimmen die kinetische Energie des Fahrzeugs, die bei einem Unfall umgewandelt wird und entsprechend auf die Unfallbeteiligten einwirkt. Dabei hat die steigende Geschwindigkeit einen besonders großen Einfluss, weil ihre Erhöhung (aufgrund der Zweierpotenz) für eine exponentielle Zunahme der kinetischen Energie sorgt. Die OECD43 und der ECMT44 schätzen deshalb, dass bis zu einem Drittel der tödlichen Verkehrsunfälle in Europa zumindest auch durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht werden. Insofern wird überhöhte Geschwindigkeit allgemein als das größte Problem der Verkehrssicherheit europaweit angesehen.45
Diese erhöhten Gefahren des Rasens bestehen in verschärfter Form für illegale Straßenrennen, weil die gefahrenen Geschwindigkeiten regelmäßig nicht nur besonders hoch sind, sondern auch mehrere Fahrzeuge parallel rasen und dabei zumeist noch weitere Verkehrsverstöße begangen werden.46
Allein im Jahr 2019 wurden in Deutschland insgesamt 2.685.661 Straßenverkehrsunfälle polizeilich registriert. In 2.385.518 Fällen blieb es bei Sachschäden, davon waren 69.189 schwerwiegende Unfälle mit Sachschäden, und lediglich in 300.143 Fällen wurden auch Personen verletzt. Die Unfälle mit Personenschäden führten zu insgesamt 387.276 Verunglückten, wovon die meisten (318.986 Personen) nur leicht verletzt wurden. Die Zahl der schwerverletzten Personen lag bei 65.244 und 3.046 Todesopfer waren 2019 auf Deutschlands Straßen zu beklagen.47
Eine zusätzliche Sonderauswertung dieser Daten durch das Statistische Bundesamt ergibt für Unfälle, die Kraftfahrzeugführer jedenfalls auch durch überhöhte Geschwindigkeit herbeigeführt haben, folgendes Bild: Es kam 2019 zu 53.716 Geschwindigkeitsunfällen mit Personen- und/oder schwerwiegenden Sachschäden, was einem Anteil von 14,5 % an allen vergleichbaren Unfällen entspricht. In 17.873 (25,8 %) Fällen blieb es bei schwerwiegenden Unfällen mit Sachschäden und in 35.843 (11,9 %) Fällen kam es zu Personenschäden mit insgesamt 50.225 (13 %) Verunglückten. Es wurden 36.736 (11,5 %) Personen leicht und 12.556 (19,2 %) Personen schwer verletzt. 933 Menschen wurden durch Geschwindigkeitsunfälle getötet, was einem Anteil von 30,6 % aller Todesopfer der Verkehrsunfälle im Jahr 2019 entspricht.48
Wie häufig dabei das Rasen die Unfallursache bildet, lässt sich mangels seiner statistischen Erfassung auch hier nur schwer sagen, was erst recht für die Unterkategorie der illegalen Straßenrennen gilt. Denn das Rasen erfordert die erhebliche Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit, was keineswegs Grund jedes Geschwindigkeitsunfalls war, sodass der Anteil der Raserunfälle deutlich unter den Werten der Sonderauswertung liegt. Zur weiteren Berechnung kann hier ohne genauere Daten nur auf den schon ermittelten Wert des Anteils der Raser an allen Geschwindigkeitsüberschreitungen von 3 % zurückgegriffen werden.49 Gerade hinsichtlich schwererer Unfälle ist dieser Anteil aber einerseits zu niedrig, weil Unfälle mit solchen Folgen regelmäßig viel kinetische Energie voraussetzen, die vor allem von Fahrzeugen mit (solch) hohen Geschwindigkeiten ausgeht. Andererseits ist dieser Anteil zu hoch. Denn bei der Bestimmung des Anteils der Raserei an allen Geschwindigkeitsverstößen ist eine allein nicht angepasste Geschwindigkeit ohne Überschreitung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit kaum berücksichtigt, doch spielt sie bei der Erfassung des Fehlverhaltens des Fahrers in der Unfallstatistik eine bedeutende Rolle. Da beide Abweichungen insofern entgegensetzt sind, gleichen sie im Ergebnis die unvermeidlichen Ungenauigkeiten der hier gesuchten Zahlen zu den Folgen der Raserei teilweise aus.
Demnach ist es 2019 infolge von Raserei zu 1.611 Unfällen mit Personen- und/oder schwerwiegenden Sachschäden gekommen, was einen Anteil von 0,44 % an allen Verkehrsunfällen 2019 ausmacht. Die prozentualen Werte erscheinen auf den ersten Blick vernachlässigbar, doch sorgten Raserunfälle absolut gesehen für insgesamt 1.507 Verunglückte, wovon 1.102 Personen leicht und 377 Personen schwer verletzt wurden. Fast 1 % der 2019 im Straßenverkehr getöteten Personen lassen sich dabei auf Raserei zurückführen, was 28 Todesopfer bedeutet. Zwar stellen auch diese Werte lediglich möglichst konkrete Größenordnungen dar, doch darf Raserei als Unfallursache wegen der hohen Fahrgeschwindigkeiten erst recht hinsichtlich schwerer Unfälle und ihrer Folgen nicht unterschätzt werden.
Die volkswirtschaftliche Analyse der Raserunfälle mit Ermittlung der materiellen Unfallfolgen muss ebenfalls ohne spezifische Daten zum Rasen auskommen. Insofern erfolgt sie mittels Unfallfolgenanalyse50 auf Basis der bisher ermittelten Daten zu Raserunfällen in Verbindung mit den Durchschnittswerten zu den volkswirtschaftlichen Kosten von Straßenverkehrsunfällen für das Jahr 2019 in Deutschland51. Die konkreten Berechnungen52 ergeben Unfallkosten durch das Rasen von fast 175 Mio. Euro für 2019, was einen Anteil von ca. 0,5 % an den jährlichen Gesamtunfallkosten des Straßenverkehrs ausmacht. Auch bei diesem Ergebnis handelt es sich lediglich um eine möglichst konkrete Größenordnung, die aber in absoluten Zahlen zeigt, welche großen negativen Folgen Raserei für die deutsche Volkswirtschaft hat.
Wie viel von alledem auf illegale Straßenrennen zurückgeht, lässt sich mangels spezifischer Erfassung nicht sagen. Mit den wenigen verfügbaren Daten kann nur ein räumlich begrenzter Eindruck skizziert werden. So kam es laut Polizei in Nordrhein-Westfalen 2017 zu 32 Unfällen infolge illegaler Straßenrennen und 2018 zu ca. 75 Unfällen.53 Laut Polizei Berlin standen 2020 in der Hauptstadt 53 Unfälle im Zusammenhang mit Straßenrennen. Für Bayern berichtet das Innenministerium von 77 Verletzten und 7 Toten im Jahr 2020 bei Unfällen infolge von verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zu denen aber auch strafbare Raserei einer Einzelperson gezählt wird.54 Da bei Rennen mit mehreren Fahrzeugen meist besonders hohe Geschwindigkeiten erreicht werden, ist regelmäßig davon auszugehen, dass solche Unfälle verhältnismäßig schwer ausfallen und die Schadensfolgen entsprechend groß sind.
Details
- Seiten
- 532
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631918098
- ISBN (ePUB)
- 9783631918104
- ISBN (Paperback)
- 9783631918081
- DOI
- 10.3726/b21777
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (März)
- Schlagworte
- Raser Straßenverkehr verbotene Straßenrennen praktische Maßnahmen Einziehung Sanktion Verfolgerfälle Mittäterschaft konkrete Gefährdung Zurechnung Vorsatz
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 532 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG