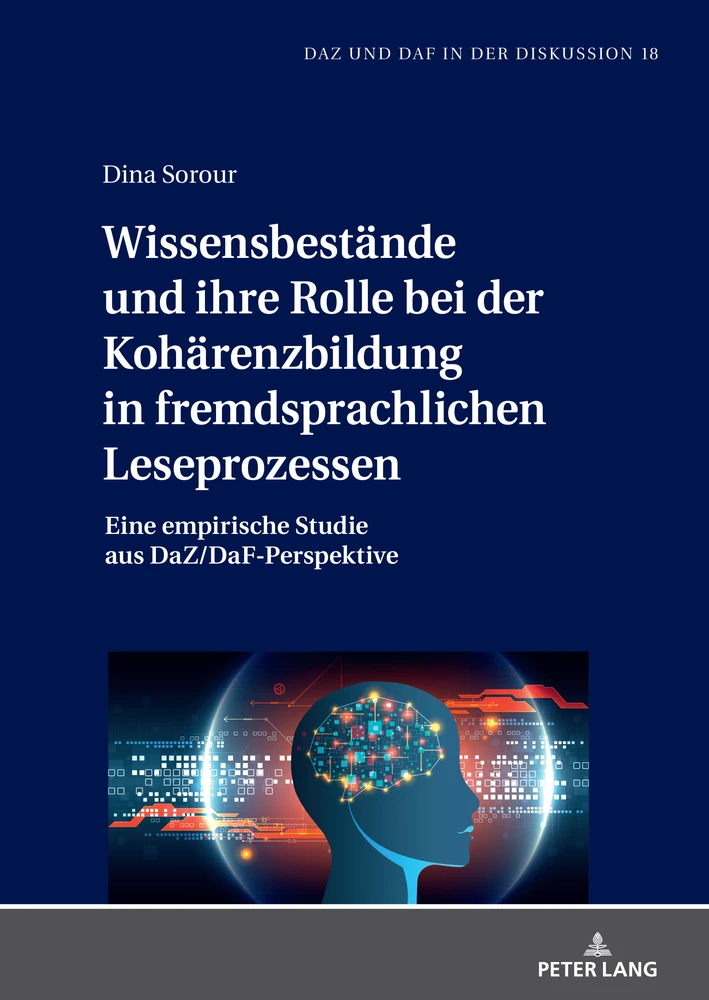Wissensbestände und ihre Rolle bei der Kohärenzbildung in fremdsprachlichen Leseprozessen
Eine empirische Studie aus DaZ/DaF-Perspektive
Zusammenfassung
Um auf das zusätzliche Material zuzugreifen, gehen Sie auf den folgenden Link.
https://supplementaryresources.blob.core.windows.net/4312450-sorour/Anhang_V_Belegstellen_20240505_Dina_Sorour.pdf
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- I. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 1.Problemaufriss
- 1.1 Leseforschung in der Erst- und Fremdsprache
- 1.2 Leseverstehen und das ‚thematische Hintergrundwissen‘
- 1.3 Ableitung der Forschungsfrage
- 2.Theoretische Grundlagen zum Leseverstehen in der Erst- und Fremdsprache
- 2.1 Variablen des fremdsprachlichen Lesens
- 2.2 Leseverstehen als Konstrukt unterschiedlicher Prozesse
- 2.2.1 Kohärenzbildungsprozesse und mentale Repräsentation
- 2.2.2 Inferenzbildung und Elaboration
- 2.2.3 Prozess vs. Strategie
- 2.2.4 Zusammenfassung: Bezug zur eigenen Forschung
- 2.3 Lesemodelle aus der Perspektive der kognitiven Linguistik und Kognitionspsychologie
- 2.3.1 Verarbeitungsebenen des Leseprozesses
- 2.3.2 Wissenstypen auf den einzelnen Ebenen
- 2.3.2.1 Bedeutungskonstruktion auf der Wortebene
- 2.3.2.2 Aufbau einer propositionalen Repräsentation: Bedeutungskonstruktion auf der Propositions- sowie Satzebene
- 2.3.2.3 Aufbau eines mentalen Modells
- 2.3.2.4 Aufbau einer Repräsentation des Einzeltextes und einer Text übergreifenden Repräsentation
- 2.3.2.5 Die Ebenen des verstehensrelevanten Wissens nach Busse
- 2.3.3 Leseziele
- 2.3.4 Zusammenfassung in Bezug auf die eigene Forschung
- 2.4 Konsequenzen für das fremdsprachliche Lesen und die Sprachniveaus
- 3.Das ‚außersprachliche Wissen‘
- 3.1 Aspekte des Wissens
- 3.2 Sprache und Wissen
- 3.3 Weltwissen, kulturelles Wissen und Diskurs
- 3.3.1 Diskurs und ‚kollektives Wissen‘
- 3.3.2 Sachwissen vs. diskursives Wissen
- 3.3.3 Diskursives Wissen vs. Konnotation
- 3.3.4 Die Rolle diskursiven Wissens, der ‚Diskursfähigkeit‘ und der ‚kultureller Orientierung‘
- 3.4 Operationalisierung von Wissensbeständen
- 3.5 Zusammenfassung mit Bezug auf die empirischen Daten
- II. EMPIRISCHER TEIL
- 4.Methodisches Vorgehen
- 4.1 Erkenntnisinteresse und Hypothesenbildung
- 4.2 Forschungsdesign
- 4.2.1 Reflexion über die eigene Perspektive als Forscherin
- 4.2.2 Forschungsmethode
- 4.2.3 Forschungsdesign im Überblick
- 4.3 Teilnehmende und Untersuchungsmaterial
- 4.3.1 Beschreibung der Teilnehmenden
- 4.3.2 Begründung der Themen- und Textauswahl
- 4.4 Textanalyse
- 4.4.1 Hartz IV in den Medien: Ein Einblick in den medialen Diskurs
- 4.4.2 Allgemeine Richtlinien der Textanalyse
- 4.4.3 Analyse Text 1 „Irgendwann ist man ganz unten angekommen“
- 4.4.4 Analyse Text 2 „Würde statt Härte“
- 4.4.5 Zusammenfassung
- 4.5 Datenerhebung
- 4.5.1 Überlegungen zur Aufgabenstellung
- 4.5.2 Datenerhebung mittels Fragebogens
- 4.5.3 Datenerhebung mittels Lauten Denkens
- 4.5.3.1 Vorbereitende Übung
- 4.5.3.2 Haupterhebung
- 4.5.3.3 Reflexion der methodischen Umsetzung
- 4.5.4 Datenerhebung mittels retrospektiven Interviews
- 4.6 Datenaufbereitung (Transkription)
- 5.Auswertungs- und Analyseverfahren
- 5.1 Methodologische Überlegungen
- 5.2 Auswertungsdesign
- 5.2.1 Identifikation der Sequenzen zu Leseprozessen (offenes Kodieren)
- 5.2.2 Identifikation der Sequenzen zu Kohärenzbildungsprozessen im Datenmaterial (offenes Kodieren)
- 5.2.3 Identifikation der Wissensaspekte in den Sequenzen
- 5.2.4 Axiales und selektives Kodieren
- 5.2.5 Fallanalyse
- 5.3 Geltungsbegründung der Datenauswertung
- 6.Datenauswertung und Ergebnisse
- 6.1 Kohärenzbildungsprozesse auf Basis von Wissensbeständen der Lesenden
- 6.1.1 Heranziehen des referenziellen Wissens eines Lexems
- 6.1.1.1 Übersehen/Auslassen der propositionalen Gehalte (Kohäsionsmittel)
- 6.1.1.2 Verwirrung/Nichtübereinstimmen
- 6.1.1.3 Grundlage zur Erweiterung des mentalen Modells
- 6.1.1.4 Zwischenfazit
- 6.1.2 Heranziehen des Sachwissens (einer kognitiven Repräsentation)
- 6.1.2.1 Übersehen/Auslassen der propositionalen Gehalte (Kohäsionsmittel)
- 6.1.2.2 Verwirrung/Nichtübereinstimmen
- 6.1.2.3 Grundlage zur Erweiterung des mentalen Modells
- 6.1.2.4 Zwischenfazit
- 6.1.3 Heranziehen des Wissens über alltagspraktische (nichtsprachliche) Handlungs- und Lebensformen
- 6.1.3.1 Elaboration
- 6.1.3.1.1 Sich in die Lage versetzen
- 6.1.3.1.2 Hinterfragen, Anzweifeln, Bestreiten bestimmter propositionaler Gehalte
- 6.1.3.1.3 Bestätigen bestimmter propositionaler Gehalte
- 6.1.3.2 Grundlage für eine weitere Bedeutungskonstruktion/Inferenzbildung
- 6.1.3.3 Verwirrung/Nichtübereinstimmen
- 6.1.3.4 Zwischenfazit
- 6.1.4 Heranziehen diskursiven Wissens
- 6.1.4.1 Übersehen/Auslassen der propositionalen Gehalte (Kohäsionsmittel)
- 6.1.4.2 Verwirrung/Nichtübereinstimmen
- 6.1.4.3 Häufige Elaborationsprozesse
- 6.1.4.3.1 Ergänzung der Leerstellen mit dem entsprechenden Muster im Modus des Selbstverständlichen
- 6.1.4.3.2 Herstellung von Bezügen zu anderen Texten sowie Diskursen
- 6.1.4.3.3 Hinterfragen, Anzweifeln, Bestreiten bestimmter propositionaler Gehalte
- 6.1.4.3.4 Bestätigung bestimmter Propositionen
- 6.1.4.3.5 Erkennen der Arten und Weisen des Zusammenspiels von Texten und Äußerungen in einem Diskurs
- 6.1.4.4 Zwischenfazit
- 6.1.5 Fazit: Die Rolle der Kohärenzbildung anhand der Wissensbestände der Lesenden
- 6.2 Kohärenzbildungsprozesse anhand der Textpropositionen
- 6.2.1 Heranziehen vorher gelesener Propositionen/Einsatz bereits aufgebauter Wissensstrukturen
- 6.2.1.1 Grundlage zur Hypothesenbildung
- 6.2.1.2 Grundlage für die Inferenzbildung
- 6.2.1.3 Übersehen/Auslassen der propositionalen Gehalte (Kohäsionsmittel)
- 6.2.1.4 Ergänzen der Leerstellen mit dem entsprechenden Muster in Modus des Selbstverständlichen (Elaborationsprozesse)
- 6.2.1.5 Zwischenfazit
- 6.2.2 Heranziehen neu gelesener Propositionen
- 6.2.2.1 (Re-)Konstruktion der kognitiven Repräsentation
- 6.2.2.2 Bestätigung oder Widerlegung der Erwartungen
- 6.2.3 Kohärenzbildung durch Übersetzen (in die Erstsprache)
- 6.2.3.1 Inferieren anhand wörtlicher Übersetzung bestimmter Begriffe
- 6.2.3.2 Lokale und globale Kohärenzbildung durch Aneinanderreihung von Wörtern und Sätzen
- 6.2.4 Kohärenzbildung durch Paraphrasieren (Wiedergabe der Propositionen)
- 6.2.4.1 Hypothesenbildung
- 6.2.4.2 Globale Kohärenzbildung durch ständiges Paraphrasieren der aneinandergereihten Sätze
- 6.2.5 Identifizierung von Zuschreibungsobjekten (Schlüsselwörter)
- 6.2.5.1 Konstruktion und Erweiterung des mentalen Modells (über einen Sachverhalt)
- 6.2.5.2 Inferieren von Stimmung/Textintention
- 6.2.6 Auslassen/Wiedergabe von bestimmten Propositionen
- 6.2.7 Kohärenzbildung durch Zusammensetzung ausgewählter Lexeme (globaler Texteinstieg)
- 6.2.8 Fazit: Die Rolle der Kohärenzbildungsprozesse anhand von Propositionen
- 6.3 Weitere Aspekte der Textverarbeitung
- 6.3.1 Textelemente
- 6.3.1.1 Funktion des Bildes
- 6.3.1.2 Funktion der Titel und Zwischentitel
- 6.3.2 Interesse/Motivation der Teilnehmenden
- 6.3.3 Textsortenwissen
- 6.3.4 Aufgabenstellung
- 6.4 Diskussion der Ergebnisse
- 6.4.1 Übersehen/Auslassen der propositionalen Gehalte (Kohäsionsmittel)
- 6.4.2 Validierung zwischen Textpropositionen und Wissensaspekten
- 6.4.3 (Re-)Konstruktion des angesprochenen Sachverhalts auf der Textebene
- 6.4.4 (Re-)Konstruktion einer Text übergreifenden Repräsentation
- 6.5 Quantitatives Auftreten bestimmter Kohärenzbildungsprozesse
- 7.Fallanalyse
- 7.1 Fall 1: Intensive Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt durch diskursives Wissen
- 7.2 Fall 2: (Re-)Konstruktion des Sachverhalts durch ‚gute‘ Sprachkenntnisse
- 7.3 Fall 3: Einordnung des Sachverhalts in einen anderen Diskurs durch Sachwissen
- 7.4 Fall 4: (Re-)Konstruktion des Sachverhalts durch nahe Arbeit am Text
- 7.5 Fall 5: Beschränkung auf Bedeutung einzelner Lexeme und wörtlicher Übersetzung
- 7.6 Leseprozesse in der Erstsprache Arabisch
- 7.7 Zusammenfassende Analyse der Fälle
- 8.Diskussion der Ergebnisse
- 8.1 Diskussion der Ergebnisse im Kontext des wissenschaftlichen Diskurses
- 8.2 Diskussion der Ergebnisse im Kontext des didaktischen Diskurses und ihre Implikationen für den fremdsprachlichen Unterricht
- 8.2.1 (Re-)Konstruktion der Deutungsmuster
- 8.2.1.1 Thematisches Arbeiten
- 8.2.1.2 Wiedergabe in der Erstsprache
- 8.2.1.3 Zusammenfassung der gelesenen Textpropositionen
- 8.2.1.4 Erarbeitung des ‚Wissens‘ aus den Textpropositionen
- 8.2.1.5 Wörterbucharbeit
- 8.2.2 Weniger effiziente Maßnahmen
- 8.2.3 Diskursives Wissen, ‚Diskursfähigkeit‘ und das Sprachniveau
- 8.2.4 Fazit
- 9.Zusammenfassung und Ausblick
- Anhang
- Anhang I: Sitzungsverlauf
- Anhang II: Zeitungstexte als Erhebungsmaterial
- Anhang III: Kodierungen der gelesenen Artikel
- Kodierschemata Text 1
- Kodierschemata Text 2
- Anhang IV: Kodiersystem
- Anhang V: Belegstellen
- Literaturverzeichnis
Danksagung
Die vorliegende Studie stellt meine Dissertation im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig dar. An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichsten Dank an alle aussprechen, die mich auf diesem Weg unterstützt und gefördert haben. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Claus Altmayer, der mich stets mit Rat und anregenden Diskussionen bei meinem Vorhaben begleitet und motiviert hat. Seine konstruktive Kritik und seine ständige Bereitschaft zur fachlichen Diskussion waren für mich von unschätzbarem Wert. Herrn Prof. Dr. Christian Fandrych danke ich für die freundliche Übernahme des Zweitgutachtens und für seine zahlreichen Hinweise.
Herrn Dr. Michael Dobstadt und Frau Dr. Rebecca Zabel danke ich für ihr offenes Ohr und die fachlichen Diskussionen während meiner ersten Schritte, die mich zu weiteren Recherchen auch in anderen Forschungsfeldern motiviert haben. Mein besonderer Dank gilt auch Christine Magosch, Dr. Anja Ucharim und Irmgard Wanner für ihre Zeit, ihre wertvolle Unterstützung und ihr ausführliches Feedback zu meinen Texten. Meinen Mitdoktoranden Dr. Parivash Mashhadi, Dr. Sara Agiba und Dr. Karim Mahmoud danke ich für die schönen Erinnerungen im Doktorandenalltag. Herzlichen Dank an unsere Schreibgruppe, die mir durch wöchentliche Schreibtreffen und Schreibwochenenden geholfen hat, regelmäßig und motiviert an meinem Dissertationsprojekt zu arbeiten. Ebenso möchte ich meinen Studienteilnehmenden danken, dass sie mir Zeit und Offenheit entgegenbrachten und mir Zugang zu ihren Gedanken und Leseprozessen gewährten.
Bedanken möchte ich mich beim DAAD für die finanzielle Unterstützung und die Möglichkeit zur Durchführung meines Promotionsvorhabens in Deutschland. Mein Dank gilt auch dem Team der Universitätsbibliothek Leipzig, das für die Doktorandinnen und Doktoranden spezielle Arbeitsplätze eingerichtet hat und stets für die verschiedensten Anliegen ansprechbar war. Dies alles hat zu einem deutlich sichtbaren Fortschritt bei der Fertigstellung der Dissertation beigetragen.
An dieser Stelle möchte ich besonders meinen Eltern danken, die den Grundstein meines Erfolges legten, indem sie mir das Masterstudium in Leipzig finanziell ermöglichten. In dieser Zeit spielten auch Thorsten Schoel und Katrin Schoel (Kurth) eine sehr wichtige Rolle, indem sie mir in den verschiedensten Situationen beistanden, wofür ich mich herzlich bedanke.
Meinem Mann, Nadeem Melhem, danke ich von ganzem Herzen für seine grenzenlose und liebevolle Unterstützung und sein Verständnis in all den Jahren für den Zeitaufwand, den die Realisierung dieses Vorhabens erfordert hat. Für seine intensive emotionale und fachliche Unterstützung in der Endphase der Dissertation und seine stetige Ermutigung möchte ich mich ganz besonders bedanken. Ohne diese Unterstützung und seinen Glauben an mich wäre der Abschluss meiner Promotion nicht möglich gewesen.
Zu guter Letzt danke ich meinen lieben Großeltern, die immer an mich geglaubt und sich über jeden Fortschritt gefreut haben und mir dadurch das Durchhaltevermögen gegeben haben. Ihnen ist diese Arbeit als Dank für ihren wichtigen Beitrag in meinem Leben gewidmet.
Einleitung
Lesen ist ein Prozess, bei dem Lesende auf unterschiedliche Arten von Wissen zurückgreifen. Dabei kann es sich um systematisch gebundenes oder lexikalisches Wissen handeln wie Morpheme und die Bildung von Wörtern daraus, oder um Wissen, das nicht sprachsystematisch verankert ist. Dieses sogenannte ‚außersprachliche Wissen‘ kann sich beispielsweise auf spezifische Themengebiete wie Geschichte oder Faktenwissen beziehen. Welche Rolle dieses nicht sprachsystematisch verankerte Wissen bei der Kohärenzherstellung im Leseprozess spielt, steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Es ist anzumerken, dass an dieser Stelle primär der Begriff ‚außersprachliches Wissen‘ verwendet wird, der sich auf nicht sprachsystematisch verankertes Wissen bezieht1.
Bereits im Jahr 1932 hat sich Bartlett mit dieser Thematik befasst und damit die Grundlagen für die Schema-Theorie gelegt. Deshalb ist die Frage nach der Rolle von Wissensbeständen, die auch oft ‚Hintergrundwissen‘, ‚Vorwissen‘ oder auch ‚kulturelles Wissen‘ bezeichnet werden, bei der Bedeutungskonstruktion während des Lesens nicht neu. In der Vergangenheit sind Studien wiederholt dieser Frage nachgegangen, indem vor allem die Erstsprachen der Teilnehmenden variiert und somit auch die Themen der jeweiligen ‚Kultur‘ angepasst und kontrastiv analysiert wurden (vgl. z. B. Carrell 1987; Johnson 1981; Lee 1986; Pritchard 1990; Steffensen, Joag-Dev & Anderson 1979). Hierbei ist die Annahme problematisch, dass es einerseits eine bestimmte Gruppe von Individuen gebe, die nur aufgrund der gemeinsamen Sprache über den Zugang zu einem spezifischen, ‚kulturell geprägten‘ Thema verfüge, und andererseits eine Gruppe existiere, die diese Sprache nicht bzw. nur als Fremdsprache beherrsche, und deshalb nur geringe Wissensbestände über dieses Thema besitze.
Neben dieser Prämisse wird nur selten die reflektierte Verwendung der Begriffe, welche diese Wissensbestände bezeichnen sollen, etwa ‚kulturelles Wissen‘, ‚Vorwissen‘, ‚außersprachliches Wissen‘ oder auch ‚Weltwissen‘, infrage gestellt. Nach dem gleichen Prinzip wurde in den jeweiligen Studien die Auswahl der ‚kulturellen‘ Themen ohne jegliche wissenschaftliche Fundierung vorgenommen. Weiterhin erfordert es, die Effizienz der Erhebungsmethoden wie der Textwiedergabe oder der Multiple-Choice-Fragen in Bezug auf den erforschten Gegenstand in der Fremdsprache zu hinterfragen (vgl. dazu Kap. 1.2).
Immer wieder wurde in diesen Forschungen die positive Rolle des ‚außersprachlichen Wissens‘ beim Leseverstehen hervorgehoben und bestätigt. Das gilt auch für weitere Studien, deren Schwerpunkt ein anderer war (vgl. z. B. Schramm 2001; Würffel 2006). Dabei hat sich dieser Wissensaspekt nicht nur ‚positiv‘ auf die Leseprozesse ausgewirkt (vgl. Schramm 2001: 357 f.).
Ein weiteres Phänomen, das mich zur Erforschung des Themas motiviert hat, ist meine eigene Erfahrung im Unterricht als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. In meiner Unterrichtspraxis wurde immer wieder deutlich, dass die Kenntnis der Wortbedeutungen im engeren Sinn (d. h. einer referenziellen Repräsentation eines Lexems) nicht ausreichend ist, um den angesprochenen Sachverhalt in einem Text in seiner ganzen Tiefe, d.h. auf allen Verarbeitungsebenen, zu erfassen.
Mein Forschungsinteresse richtet sich daher darauf, der Frage nach der Rolle des nicht sprachsystematisch verankerten Wissens bei der Kohärenzbildung in den Leseprozessen auf Basis wissenschaftlicher Fundierung nachzugehen. Dieses Vorhaben soll aus der Perspektive des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache mit dem Schwerpunkt Kulturstudien angegangen werden. Für die Entwicklung eines entsprechenden Forschungsdesigns und für die Analyse der generierten Daten war es vor allem unerlässlich, sich mit den Forschungsdesigns bereits existierender Studien und deren Ergebnissen zu beschäftigen und daraus die Forschungsfrage abzuleiten (vgl. Kap. 1).
Der theoretische Teil (Teil I) der vorliegenden Arbeit ist zum einen auf die Beschreibung der Leseprozesse wie Kohärenzbildung, Inferenzbildung und Elaboration ausgerichtet. Dabei stütze ich mich auf die Konzepte der kognitiven Linguistik (Aufbau der mentalen Modelle) sowie der (fremdsprachlichen) Leseforschung (vgl. Kap. 2.2). Zum anderen zielt dieser Teil darauf ab, die unterschiedlichen Variablen des (fremdsprachlichen) Lesens sowie sämtliche Wissens- aspekte, die in die Leseprozesse auf den unterschiedlichen Ebenen einfließen, zu identifizieren (vgl. Kap. 2.1). Aufbauend auf dem von Weir & Khalifa (2008) vorgeschlagenen Lesemodell sowie dem Modell von Busse (2015) zur Textverarbeitung mit dem Schwerpunkt Wissenstypen werden Wissensaspekte, die in Leseprozesse einfließen, weiterhin in Bezug auf die Forschungsfrage präzisiert (vgl. Kap. 2.3).
Auf der Grundlage von Kapitel 2.3 werden sämtliche bis dahin identifizierten Wissensaspekte aufgelistet und diskutiert. Im Verlauf dieser Diskussion zeigt sich die Problematik einiger Wissensaspekte, die in Kapitel 3 erneut aufgegriffen werden soll. Zuerst gehe ich auf den Zusammenhang zwischen sprachsystematisch gebundenem und nicht sprachsystematisch verankertem Wissen bzw. ‚außersprachlichem Wissen‘ ein. Als Nächstes setze ich mich mit den Begriffen ‚Diskurs‘ nach Michael Foucault (1981) und ‚diskursives Wissen‘ auseinander. Darüber hinaus wird eine Abgrenzung des ‚diskursiven Wissens‘ von bereits bekannten Begriffen wie ‚thematisches Wissen (Sachwissen)‘ und ‚Kollokation‘ vorgenommen. Zum Schluss wird die Rolle des ‚diskursiven Wissens‘ mithilfe der Beschreibung von Prozessen wie ‚Diskursfähigkeit‘ nach Altmayer (2016) sowie ‚kulturelle Orientierung‘ nach Zabel (2016) thematisiert. So wird eine Operationalisierung der Wissensaspekte während der Datenanalyse möglich.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist die Differenzierung zwischen zwei Arten von Wissen von großer Bedeutung: das Wissen im kognitiven Apparat des Individuums und das Wissen, das unabhängig von den Individuen in einem Diskurs existiert (sog. ‚Deutungsmuster‘). Um beide Arten im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu unterscheiden, wird mit dem Begriff ‚Wissen‘ auf die Wissensbestände von Individuen in Form einer kognitiven Repräsentation Bezug genommen, die den Prozessen der Konstruktion und Rekonstruktion unterliegen. Deutungsmuster sind hingegen ein auf Zeit stabilisiertes Wissen in einem Diskurs (vgl. Keller 2011: 8 in Kap. 3.3).
Der empirische Teil beinhaltet eine ausführliche Diskussion der Forschungsmethode und der Variablen, die das (fremdsprachliche) Lesen beeinflussen. Danach werden die einzelnen Schritte der Datenerhebung expliziert. Diese Darstellung bezieht sich nicht nur auf das vorgenommene Design, sondern reflektiert auch im Nachhinein dessen Umsetzung (vgl. Kap. 4). Einen wichtigen Beitrag leistet im empirischen Teil die Analyse der beiden Lesetexte, die der Datenerhebung zugrunde liegen. Für die Darstellung der Makro- sowie der Mikrostruktur der Texte habe ich die Analyseschritte von Maringer (2009; 2012) verwendet. Darüber hinaus wurde in Kapitel 4.4 der Diskurs ‚das Arbeitslosengeld II‘, dem beide Texte zuzuordnen sind, thematisiert. Des Weiteren wurden die dem Sachverhalt zugeschriebenen diskursiven Deutungsmuster nach Butterwegge (2018) zusammenfassend dargestellt, die sich auf das Zuschreibungsobjekt ‚Hartz IV‘ beziehen, der seit dem 1. Januar 2023 durch den Begriff ‚Bürgergeld‘ ersetzt wurde. Diese Muster wurden anschließend mit den in den Texten verwendeten Deutungsmustern verglichen.
Die anhand der Methode des Lauten Denkens erhobenen Daten wurden mithilfe einer Kombination aus Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und der Methode der Grounded Theory nach Strauss (1998) kodiert (vgl. Kap. 5). Für die Darstellung der Kategorien habe ich einige Sequenzen ausgewählt und in Bezug auf die jeweilige Kategorie diskutiert. Diese Kategorisierung ermöglichte es, die unterschiedlichen Wissensaspekte sowie ihre Rolle bei der Kohärenzbildung in den Leseprozessen herauszuarbeiten. Ein weiterer Analyseschritt betraf die Fallanalyse, in deren Rahmen die Konstellation zwischen den Sprachkenntnissen und den herangezogenen Wissensaspekten in Bezug auf die Kohärenzbildung diskutiert wurde.
Im letzten Kapitel der vorliegenden Arbeit werte ich die durchgeführte Studie und deren Ergebnisse in Bezug auf den wissenschaftlichen sowie didaktischen Diskurs aus und leite daraus didaktische Implikationen ab (vgl. Kap. 8).
1 Die Problematik der Unterscheidung zwischen ‚sprachlichem‘ und ‚außersprachlichem‘ Wissen wird in Kapitel 3.2 thematisiert.
1 Problemaufriss
Der Überblick über die Forschungen zum Leseverstehen2 in diesem Kapitel dient in erster Linie dazu, die Problematik bezüglich der Variable des ‚Hintergrundwissens‘ und deren Erforschung darzustellen und zu konkretisieren. Ferner resultiert aus der dargestellten Problematik die Ableitung des Forschungsinteresses dieser Arbeit. Der ‚übliche‘ Forschungsüberblick wird aufgrund der erkennbaren Relevanz, Nachvollziehbarkeit und Zuordnung in Bezug auf die eigene Forschung in die einzelnen Kapitel dieser Arbeit integriert.
1.1 Leseforschung in der Erst- und Fremdsprache
Zahlreiche Studien haben das Thema Lesen in der Fremdsprache aus unterschiedlichen Perspektiven heraus behandelt. Allein in den letzten 30 Jahren sind im deutschsprachigen Raum Arbeiten verfasst worden, die den Fokus auf die Prozesse und Strategien des Lesens gelegt haben, d. h. auf die Leseprozesse und -strategien in der Erst- und/oder Fremdsprache (Costa 2010 zur Dekodierfähigkeit; Ehlers 1998 mit der Erweiterung Richtung erzählende Texte; Hu 2013; Karcher 1994; Lutjeharms 1988) oder auf eine spezifische Textsorte, wie beispielsweise Fachtexte (Lisiecka-Czop 2003; Schramm 2001). Einige Arbeiten fokussieren sich auf bestimmte Variablen wie Interesse bzw. Emotion und deren Einfluss auf die fremdsprachliche Lesekompetenz (Biebricher 2008) oder auf die Lesestrategien (Finkbeiner 2005). Besonders die Studien von Lutjeharms (1988), Karcher (1994), Ehlers (1998) und Schramm (2001) vermitteln einen fundierten Überblick über die Lesetheorien und Leseprozesse und bieten dadurch eine ausführliche theoretische Grundlage, auf die ich mich im Rahmen dieser Arbeit stütze.
Obwohl der Fokus der oben aufgelisteten Arbeiten auf einem bestimmten Aspekt des Lesens liegt, setzen sich die Arbeiten mit der Rolle des ‚Vorwissens‘3 bzw. ‚Weltwissens‘ beim Leseverstehen als eine der möglichen, das Verstehen beeinflussenden Variablen auseinander. Einerseits werden in diesen Studien Forschungen aus dem englischsprachigen Raum mit ihren Ergebnissen zur Rolle des thematischen oder auch ‚kulturellen Hintergrundwissens‘ beim Leseverstehen hinterfragt (vgl. Kap. 1.2), andererseits werden auch weitere Impulse, vor allem für fremdsprachliches Lesen, unter Rückgriff auf die gleichen Studien gegeben bzw. zusammengefasst (vgl. Ehlers 1998; Karcher 1994; Lutjeharms 1988; Schramm 2001). Laut Lutjeharms (2001: 904) sind beispielsweise „[e]ine Überschrift, ein passendes Bild oder eine vorangestellte Zusammenfassung […] wichtige Hilfen, weil sie eine Erwartungshaltung auslösen, die den Einsatz der Dekodierprozesse unterstützt“. Ebenso wird in Anlehnung an Carrell (1988: 245) argumentiert, dass, wenn das Vorwissen durch bestimmte Aktivitäten vor dem Lesen aufgebaut wird, dies das Lesen in der Fremdsprache verbessert, also in ihrem Fall English as a Second Language (ESL). Zu diesen Aktivitäten gehören einführende Vorträge, Bilder, Filme, das Sammeln von authentischen Erfahrungen, Debatten und Diskussionen, Rollenspiele usw. (vgl. Ehlers 1998: 126; Schramm 2001: 73). Bei derartigen Empfehlungen wird davon ausgegangen, dass „[j]e mehr Hintergrundwissen ein Lerner in bezug auf den Inhaltsbereich eines Textes hat, desto mehr und besser versteht er“4 (Ehlers 1998: 126).
In diesem Zusammenhang führt Ehlers an einem Beispiel aus ihrer Erfahrung aus, dass das vorgegebene ‚Wissen‘ vor dem Lesen das Verstehen auch verunsichern kann und es eines gezielten Rückgriffs auf bestimmte Textsignale bedürfe, um Kohärenz herzustellen (ebd.: 129). Der Leseprozess kann aber auch durch das vorab vermittelte Wissen determiniert werden (ebd.: 128, 244). Darüber hinaus trägt nicht jedes Bild zwangsläufig zum besseren Textverstehen bei, weil man in diesem Fall auch erst einmal ein entsprechendes Schema dazu bilden muss (vgl. hierzu Lee 1986: 353). Wie an dieser Stelle nur kurz erläutert, kann die Effizienz der Vorentlastung vor dem Lesen auch maßgeblich infrage gestellt werden. Auch Nuttall (1983: 153 f.) warnt vor längeren thematischen Einführungen vor dem Lesen, plädiert aber wie Carrell (1988: 245) dafür, die Lernenden daran zu beteiligen, das zum Verstehen notwendige ‚Vorwissen‘ durch Diskussionen, Debatten und Rollenspiele zu erarbeiten bzw. zu erwerben. Diese Positionen bauen in erster Linie auf den Erfahrungen der forschenden Person als Lehrenden auf (ausgenommen Lee 1986) und weisen keine empirische Fundierung auf. Doch bevor derartige Empfehlungen vorgenommen werden können, ist es m. E. grundlegend wichtig, empirisch zu erforschen, wie die Erarbeitung des Wissens während des Lesens erfolgt, um überhaupt mögliche Konzepte für eine solche Beteiligung ableiten zu können.
In der empirischen Studie von Schramm (2001), in der sie die Leseprozesse untersucht, ist der Einfluss des ‚Vorwissens‘ während des Leseverstehens anhand der Datenanalyse erkennbar. Im Gegensatz zu den Studien zur Rolle des ‚Hintergrundwissens‘ beim Leseverstehen (vgl. Kap. 1.2) konnte Schramm (2001) anhand ihrer Ergebnisse empirisch nachweisen, dass sowohl das fehlende als auch das vorhandene ‚Vorwissen‘ zum „inkongruenten Verstehen“5 führen können (ebd.: 348). Somit „kann […] vorhandenes Vorwissen beim Wissensaufbau stören“ und sich dann nachteilig auswirken, wenn beispielsweise nachfolgende Inhalte auf diesem inkongruenten Wissen aufbauen (ebd.: 357). Diese Erkenntnisse lassen erneut die meist positiv diskutierte Vorentlastung vor dem Lesen fragwürdig erscheinen.
Aus der oben dargestellten Diskussion lässt sich schlussfolgern, dass das ‚Vorwissen‘ bzw. das ‚thematische Hintergrundwissen‘ eine wichtige Variable für das Leseverstehen ist, die nicht nur im theoretischen Teil der oben genannten Studien eine Rolle spielt, sondern auch in den Forschungsergebnissen thematisiert wird (vgl. z. B. Schramm 2001: 348 ff.; Würffel 2006: 3036). Allerdings war der Fokus in diesen Studien nicht darauf gelegt, die Rolle des ‚Hintergrundwissens‘ beim Leseverstehen zu untersuchen, weshalb dieses Ergebnis als Teilergebnis gesehen wird.7 Nicht nur in den Studien, sondern auch im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) fließt das „Weltwissen“ in die rezeptiven Kompetenzen in Form von Rezeptionsstrategien ein, die „das Identifizieren des Kontextes auf der Basis relevanten Weltwissens [umfassen]“ (Europarat 2017: 77) und somit die Rolle dieser Variable kennzeichnen. Im Rahmen dieser Arbeit wäre es deshalb von Interesse, sich gezielt mit dieser Variable auseinanderzusetzen und sich dem Thema auf Grundlage empirischer Daten zu nähern. Der Einblick in die Prozesse soll es auch ermöglichen, die Fälle zu differenzieren, in denen das vorhandene ‚Vorwissen‘ entweder auf Kohärenzbildungsprozesse unterstützend oder auch beeinträchtigend einwirkt. Darüber hinaus müsste konkretisiert werden, inwiefern Wissen und auch welches Wissen bzw. laut Carrell (1984) welche prereading activities relevant sein können – oder ob das „Wissen [tatsächlich, D.S.] nicht in Form fertiger Wissensblöcke extern vom Lehrer bereitgestellt werden [sollte]“ (Ehlers 1998: 245).
1.2 Leseverstehen und das ‚thematische Hintergrundwissen‘
Der Einfluss des ‚Hintergrundwissens‘ auf das Leseverstehen, das sich auf die ‚Kultur‘ der Lesenden bezieht, wurde in mehreren Studien, vor allem im englischsprachigen Raum, untersucht. In Anlehnung an die Studie von Bartletts (1932) konnten Steffensen, Joag-Dev & Anderson (1979) in ihrer Studie eine positive Rolle des ‚kulturspezifischen Hintergrundwissens‘ bei der Lesegeschwindigkeit und Textwiedergabe nachweisen. Amerikanische und indische Teilnehmende der Universität Illinois (USA) haben zwei Briefe auf Englisch gelesen, die jeweils eine ‚typisch‘ indische oder eine ‚typisch‘ amerikanische Hochzeit beschreiben. Neben der Lesegeschwindigkeit und der Wiedergabeleistung bei den ‚kulturell verwandten‘ Briefinhalten wurden als weitere Ergebnisse die sogenannten ‚kulturell angemessenen‘ Elaborationen („culturally appropriate elaborations“) und weniger die inhaltlichen Entstellungen („culturally based distortions“) festgehalten (ebd.: 10). Die Studie hat Variablen wie Geschlecht, Alter, Studienjahr, Fach und Familienstand berücksichtigt. Die Texte wurden in Bezug auf die Wissensbestände der Teilnehmenden als für sie thematisch ‚fremd‘ und thematisch ‚bekannt‘ bezeichnet. Ob für die indischen Teilnehmenden eventuell Englisch als Zweitsprache bezeichnet werden kann, und damit eine weitere Variable darstellt, wurde außer Acht gelassen. Ferner vertritt Ehlers (1998: 124 f.) die Auffassung, dass die möglichen inhaltlichen Entstellungen eher auf die fehlende Fähigkeit, zu deuten und Zusammenhänge abzuleiten als auf das fehlende ‚kulturelle‘ Hintergrundwissen hinweisen. Außerdem liefert die Weise, in der die Ergebnisse in dieser Studie betrachtet und bewertet werden, keine Erklärung für die „Phänomene des Fremdverstehens und des Lernens von Neuem“ (ebd.: 125). Ebenso ist das Erhebungsinstrument kritisch zu bewerten: Denn direkt nach dem Lesen wurde der Wortschatz abgefragt, wodurch auch der Fokus der Teilnehmenden auf bestimmte Textteile gelenkt wird. Die weitere Aufgabe, den Text möglichst in der gleichen Reihenfolge und mit gleichen Worten wiederzugeben, misst eher die Gedächtnisleistung als das Leseverstehen (vgl. hierzu auch Groeben 1982: 59). Die darauffolgenden Inferenzfragen wie ‚Welche Bedeutung trägt das Fangen des Brautstraußes?‘ (vgl. Steffensen, Joag-Dev & Anderson 1979: 16) – auch wenn darauf nur zum Abgleich mit dem Wiedergabeprotokoll zurückgegriffen wurde – sind von der Auswahl her nicht begründet und können evtl. auch beantwortet werden, ohne den Text zu lesen, wie dies beispielsweise in der oben genannten Frage der Fall ist8. Die Autoren schlussfolgern, dass „the schemata embodying background knowledge about the content of a discourse exert a profound influence on how well the discourse will be comprehended, learned, and remembered“ (ebd.: 19; Herv. D.S.). An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob das Leseverstehen an sich überhaupt untersucht wurde.
Johnson (1981) und später Carrell (1987) haben den Einfluss der inhaltlichen, aber auch der formalen Schemata beim Leseverstehen bei Lesenden mit Englisch als Fremdsprache untersucht. Die beiden Studien ähneln sich insofern in der Methode, als dass die Teilnehmenden mit einem als ‚kulturell fremd‘ und einem als ‚kulturell bekannt‘ konnotierten Lesetext konfrontiert wurden. Diese Texte sind darüber hinaus zusätzlich in zwei Versionen unterteilt worden – einmal in vereinfachter Sprache bzw. mit logischem Aufbau und einmal mit komplexen Sätzen. So erhob Carrell (1987) beispielsweise ihre Daten, indem sie katholische und muslimische ESL-Lesende zwei Texte lesen ließ, die thematisch der jeweiligen Religion angepasst wurden. Sie stellte fest, dass das ‚kulturspezifische Wissen‘ nicht nur eine positive Wirkung auf das Leseverstehen hat, sondern auch einen stärkeren Einfluss als der syntaktische Schwierigkeitsgrad der Sätze ausübt (ebd.: 461). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Johnson (1981). Das Leseverstehen wurde mit einer ähnlichen Methode wie bei Steffensen, Joag-Dev & Anderson (1979) überprüft: Zuerst wurde die Textwiedergabe auf Englisch erhoben, danach wurden solche Fragen zum Text gestellt, die laut den Forschenden sowohl explizite als auch implizite Inhalte abgefragt haben (in den zwei letztgenannten Studien handelte es sich um Multiple-Choice-Fragen).
Details
- Seiten
- 434
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631918180
- ISBN (ePUB)
- 9783631918197
- ISBN (Hardcover)
- 9783631918173
- DOI
- 10.3726/b21785
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (Januar)
- Schlagworte
- Lautes Denken fremdsprachliche Leseprozesse Kohärenzbildungsprozesse kulturelle Deutungsmuster diskursive Wissensbestände Diskursfähigkeit Diskurs ‚außersprachliches Wissen‘ nicht sprachsystematisch verankertes Wissen
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 434 S., 9 s/w Abb., 12 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG