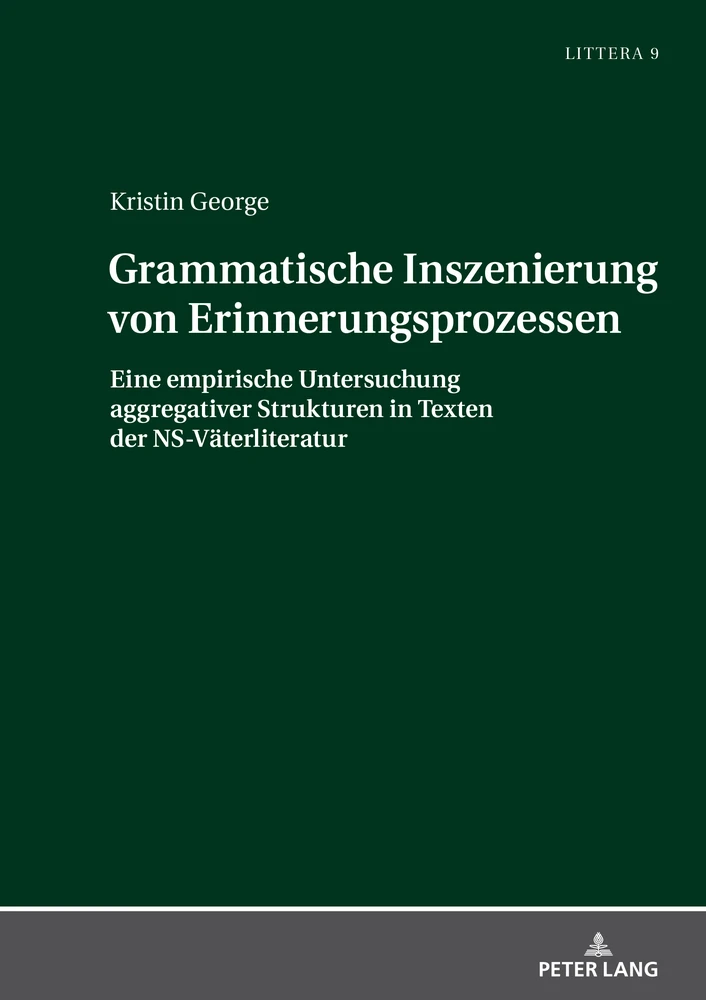Grammatische Inszenierung von Erinnerungsprozessen
Eine empirische Untersuchung aggregativer Strukturen in Texten der NS-Väterliteratur
Zusammenfassung
Um auf das zusätzliche Material zuzugreifen, gehen Sie auf den folgenden Link.
https://supplementaryresources.blob.core.windows.net/4336493-george/Online_attachement_Dissertationskorpus.pdf
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft
- 1.2 Sprachwissenschaft und Gedächtnisforschung
- 1.3 NS-Väterliteratur als Untersuchungsgegenstand und Korpus
- 1.4 Inszenierung und Authentizität
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 2.1.1 Modellierungsmöglichkeiten
- 2.1.2 Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei Koch/Oesterreicher
- 2.1.3 Das Nähe-Distanz-Modell von Ágel/Hennig
- 2.1.4 Exemplarische Nähe-Distanz-Analyse für +/- inszenierte Erinnerung
- 2.1.5 Die Systemfrage
- 2.2 Forschungsstand Satzrand
- 2.2.1 Das Skriptizismus-Problem anhand von Altmann (1981)
- 2.2.2 Emanzipation der Gesprochene-Sprache-Forschung
- 2.2.3 Satzrand in der Gesprochene-Sprache-Forschung
- 2.2.4 Satzrand in der ‚Geschriebene-Sprache-Forschung‘
- 2.3 Aggregative Strukturen
- 2.3.1 Satzrandverdächtige Strukturen
- 2.3.2 Aggregation und Integration
- 2.3.3 Satzrandglieder im engeren Sinne: Grammatische Textanalyse (GTA 2017)
- 2.3.3.1 Anbindung und Deixis
- 2.3.3.2 Nichtsätze und der Satzrand
- 2.3.3.3 Nichtsatzrand
- 2.3.3.4 Appositionen und der Satzrand
- 2.3.3.5 Externe Prädikation vs. virtueller Satz
- 2.3.3.6 Weitere aggregative Strukturen
- 2.4 Gedächtnis in der Kognitionspsychologie
- 2.4.1 Versprachlichung von Erinnerungsprozessen
- 2.4.2 Geschichte der Gedächtnisforschung
- 2.4.3 Systematik und Modelle
- 2.4.4 Episodisches und semantisches Gedächtnis
- 2.4.5 Das autobiographische Gedächtnis
- 3 Methode
- 3.1 Korpuseigenschaften und -design
- 3.2 Grammatische Analyse
- 3.3 Quantifizierung Erinnerungsdetails
- 4 Empirische Ergebnisse
- 4.1. Grammatische Phänomene
- 4.1.1 Grammatische Phänomene im Gesamtkorpus
- 4.1.2 Grammatische Phänomene in den einzelnen Korpustexten
- 4.2 Erinnerungsdetails
- 4.2.1 Erinnerungsdetails im Gesamtkorpus
- 4.2.2 Erinnerungsdetails in den einzelnen Korpustexten
- 4.3 Kombi-Auswertung: Grammatische Phänomene und Erinnerungsdetails im Gesamtkorpus
- 5 Fazit
- 5.1 Aggregative Strukturen in Texten aus der NS-Väterliteratur
- 5.2 Erinnerungsdetailtypen in Texten aus der NS-Väterliteratur
- 5.3 Das Verhältnis aggregativer Strukturen zu Erinnerungsdetailtypen in Texten aus der NS-Väterliteratur
- 5.4 Ausblick
- 6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Zentraler Gegenstand dieser Arbeit sind diejenigen grammatischen Strukturen, mit deren Hilfe Autor*innen Erinnerungsprozesse in autobiographischen Narrationen der NS-Väterliteratur inszenieren.1 Die Textsequenzen, in denen dies passiert, nenne ich Erinnerungen.2 Ziel der Dissertation ist es, Affinitäten zwischen grammatischen Strukturen einerseits und Typen von Erinnerungsdetails andererseits dort empirisch nachzuweisen, wo Erinnerungsprozesse abgebildet werden.3 Dabei steht das Prozesshafte im Zentrum des Forschungsinteresses, d.h. der Abrufprozess von Erinnerungen ikonisch abgebildet auf der Linearstruktur und nicht narrativierte Inhalte von Erinnerungen im Allgemeinen.4 Diese sprachwissenschaftliche Arbeit bezieht für die genannte Perspektivierung Erkenntnisse aus der Gedächtnispsychologie und Literaturwissenschaft mit ein. Das Ziel der Arbeit ist es ebenfalls, eine anwendbare Systematik auszuloten und zu erstellen, die entsprechend der Charakteristika des Textkorpus, das für diese Untersuchung erstellt wurde, adäquat und anwendbar ist.
Die grammatischen Techniken, die Lesende in den Eindruck einer gerade abgerufenen Erinnerung versetzen sollen, haben eine Gemeinsamkeit. Das Prozesshafte wird nicht integrativ wie in (1‘), sondern aggregativ (vgl. Raible 1992; Hennig 2009; Ágel/Diegelmann 2010; Ágel 2010, 2012) wie in (1) ausgedrückt:
- (1) Ein Geräusch konnte jederzeit diesen Zustand entlarven. Rennende Füße auf dem Trottoir, lässige Stiefelschritte, marschierende Stiefel, die Flüche von Männern, vor allem der Schrei einer Frau. Gewimmer in einer Wohnung nicht weit von mir. (Meckel 278)
- (1‘) Ein Geräusch konnte jederzeit diesen Zustand entlarven. Ich erinnere mich, dass ich rennende Füße, lässige Stiefelschritte und marschierende Stiefel auf dem Trottoir hörte. Ich konnte die Flüche von Männern hören. Vor allem erinnere ich mich an den Schrei einer Frau und dass ein Gewimmer in einer Wohnung zu hören war, die nicht weit von mir entfernt lag.
Im Fokus dieser Arbeit stehen Strukturen, die zu solcher Aggregation führen. Dies sind vor allem Satzrandstrukturen, die im Sinne der Grammatischen Textanalyse (= Ágel 2017, im Folgenden: GTA) als Nichtsätze verstanden werden. Auch die dort angenommenen Nichtsatzklassen (externe Prädikation, Existenzialnichtsatz, Fragmentarischer Nichtsatz) werden hier übernommen. Dabei geht diese Arbeit jedoch anders als die GTA davon aus, dass Satzrandstrukturen nicht unterschiedlichen Nichtsatzklassen entsprechen, sondern immer externe Prädikationen sind (ebd.: 176) (vgl. Kap. 2.3.3.2). Zu diesen werden im Rahmen dieser Arbeit auch Appositionen gezählt. Des Weiteren fallen unter die untersuchen Phänomene Parenthesen (vgl. Hoffmann 1998) und einige aggregative Satzformate wie dynamische Infinitivsätze und interne Prädikationen. Die syntaktische Korpus-Analyse wird auf grammatiktheoretischer Grundlage der GTA und in Form des dort verwendeten erweiterten Stellungsfeldermodells (vgl. GTA 2017: 94 ff.) vorgenommen.
Darüber hinaus werden für die aggregativen Strukturen in Anlehnung an den gedächtnispsychologischen CRAM-Test (Cue-Recalled Autobiographical Memory Test) (vgl. Gardner et al. 2012 und 2015) Typen von Erinnerungssdetails quantitativ und qualitativ ausgewertet. Diese Details wurden dazu in solcher Weise adaptiert, dass sie auf (schriftliche) Texte anwendbar sind. Unterschieden werden Detailtypen wie Ort, Emotion, Person, Gegenstand/Gegenstandsbeschreibung sowie einige weitere.
Die zentrale These dieser Arbeit ist: Aggregation eignet sich zur Inszenierung von Erinnerungsprozessen. Die zentralen Fragen lauten: Gibt es Affinitäten zwischen bestimmten aggregativen Strukturen einerseits und bestimmten Erinnerungsdetails andererseits? Welche grammatischen Phänomene und Techniken werden für die Darstellung welcher Inhalte genutzt?
Wenn hier davon gesprochen wird, dass grammatische Techniken genutzt werden, so scheint dies eine bewusste Nutzbarmachung durch die Autor*innen zu implizieren. Und tatsächlich lässt sich aus meiner Sicht nicht zuletzt deshalb auch von Inszenierung sprechen, weil, wie die folgenden Ausschnitte aus den autobiographischen Narrationen zeigen, der Versuch einer bestimmten Darstellungsweise bewusst unternommen wird. Dennoch ist davon auszugehen, dass etwaige Muster in den Zusammenhängen von grammatischen Phänomenen und Erinnerungsdetails nicht bewusst erzeugt wurden.
In der autobiographischen Narration Am Beispiel meines Bruders (2011) schreibt Uwe Timm:
Die Gefahr, glättend zu erzählen. Erinnerung, sprich. (Timm 2011: 37)
Es ist ein Zitat, das sicher nicht zuletzt aufgrund seiner Kürze und gleichzeitigen Inhaltsschwere auch zum Titel eines literaturwissenschaftlichen Aufsatzes von Friedhelm Marx (2007) wurde.5 Es drückt in besonderer Prägnanz das aus, was auch andere Autor*innen beschreiben, die sich in ihren der NS-Väterliteratur zugeordneten Texten mit der Verarbeitung dessen beschäftigen, was sie vom eigenen Vater erinnern. Die Gefahr, von der in Am Beispiel meines Bruders die Rede ist, wird dort im weiteren Verlauf folgendermaßen ausgeführt:
Noch Jahre nach dem Krieg, mich durch meine Kindheit begleitend, wurden diese Erlebnisse immer und immer wieder erzählt, was das ursprüngliche Entsetzen langsam abschliff, das Erlebte fassbar und schließlich unterhaltend machte […]. (Timm 2011: 37)
In Die kleine Figur meines Vaters bezieht Peter Henisch die Gefahr der glatt geschliffenen Erzählungen direkt auf den Vater:
Details
- Seiten
- 198
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631920770
- ISBN (ePUB)
- 9783631920787
- ISBN (Hardcover)
- 9783631920763
- DOI
- 10.3726/b21936
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Dezember)
- Schlagworte
- Authentizität Mündlichkeit/Schriftlichkeit Gedächtnispsychologie Erinnerungsdetails Inszenierung Aggregation/Integration Grammatik Syntax NS-Väterliteratur Autobiographisches Gedächtnis Erinnerung Nichtsatz Satzrand Literaturgrammatik
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 198 S., 4 farb. Abb., 7 s/w Abb., 21 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG