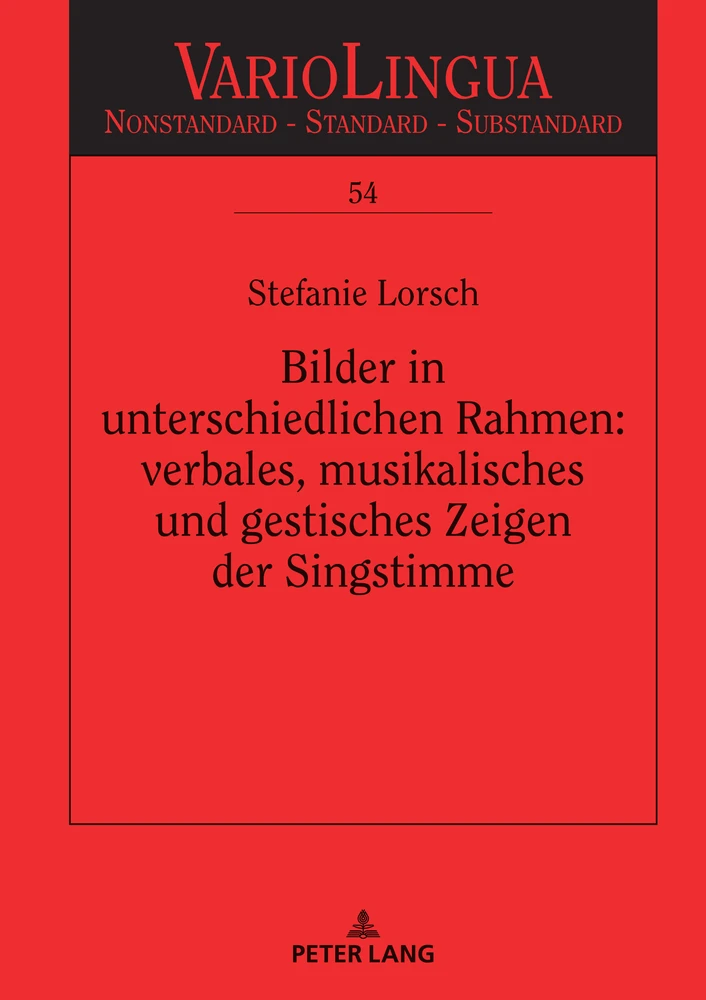Bilder in unterschiedlichen Rahmen: verbales, musikalisches und gestisches Zeigen der Singstimme
Zusammenfassung
Ein höchst beeindruckendes Werk, welches eine reiche Perspektive für Aus-und Fortbildung bietet. Die Wortliste ist ein Nachschlagewerk, auf das in allen fachbezogenen Zusammenhängen des Sprechens über Gesang und Stimme Bezug genommen werden kann.
Barbara Hoos de Jokisch, Universität der Künste Berlin
Diese interdisziplinäre Studie schließt eine relevante Forschungslücke. Die Erkenntnisse werden viele Bereiche des fachlichen Diskurses neu strukturieren und endlich sachlich fundieren. Sie sind für alle, die sich mit der Singstimme beschäftigen, von größtem Wert.
Peter Anton Ling, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Auf der Suche nach Beschreibungen der Singstimme: Die Recherchen und ihre Rahmen
- 2 Beschreibungen der Singstimme im Rahmen musikjournalistischer Texte
- 3 Beschreibungen der Singstimme im Rahmen schülersprachlicher Texte
- 4 Beschreibungen der Singstimme im Rahmen expertensprachlicher Texte
- 5 Über verbale Beschreibungen hinaus: Kommunikation über die Singstimme im Rahmen professionellen Gesangsunterrichts
- 6 Liste der zur Beschreibung der Singstimme verwendeten Wörter
- 7 Resümee: verbales, musikalisches und gestisches Zeigen der Stimme in unterschiedlichen Rahmen
- Anhang: Empirisches Material, angewandte Methoden und Auswertungen
- 9 Literatur und Internetquellen
- 10 Liste der zur Beschreibung der Singstimme verwendeten Wörter mit Definitionen und Belegen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zusammensetzung des Korpus musikjournalistischer Texte
Tabelle 2: Leitfaden für die Interviews mit Experten/Expertinnen
Tabelle 3: Interviewte Experten/Expertinnen
Tabelle 4: Beispiel S1 (0036, 00:15:56-00:16:40): „Mittelstimmenge“
Tabelle 5: Beispiel V1 (0150, 00:16:56-00:17:58): „Robbe“
Tabelle 6: Beispiel B1 (0027, 00:00-00:46-00:10:40): „Organisation eines Notenständers“
Tabelle 7: Beispiel V2 (0056, 00:01:03-00:01:35): „Darf ich?“
Tabelle 8: Beispiel S2 (0141, 00:03:10-00:03:57): „Mit der Ölkanne drüber“
Tabelle 9: Beispiel S3 (0127, 00:04:30-00:08:06): „Bleib drin“
Tabelle 10: Beispiel V26b (0124, 00:06:15-00:06:17): „Stopp“
Tabelle 11: Beispiel S4 (0169, 00:12:15-00:12:28): „Cello“
Tabelle 12: Beispiel V3a (0092): „Hohe Resonanz 1“
Tabelle 13: Beispiel V4 (0041, 00:15:09-00:15:12): „Daumen hoch“
Tabelle 14: Beispiel V5 (0150, 00:08:02-00:02:13): „Anzeigen des Resonanzortes“
Tabelle 15: Beispiel S5 (0046, 00:05:06-00:06:11): „Massiges Gefühl“
Tabelle 16: Beispiel V6 (0125, 00:02:30-00:02:39): „Ja“
Tabelle 17: Beispiel V7 (0125, 00:03:40-00:05:20): „Fast ein Siele“
Tabelle 18: Beispiel S6 (0044, 00:03:03-00:04:13): „Happezappelappigkeit“
Tabelle 19: Beispiel S7 (0027, 00:05:49-00:06:04): „Gut in der Mischung“
Tabelle 20: Beispiel S8 (0027, 00:06:22-00:06:58): „Komische Offenheit“
Tabelle 21: Beispiel S9 (0027, 00:17:22-00:17:40): „Unfallfrei auf das fis“
Tabelle 22: Beispiel S10 (0140, 00:03:30-00:04:05): „Pulsation der Stimmlippen“
Tabelle 23: Beispiel S11 (0161, 00:13:50-00:14:11): „Zu offen“
Tabelle 24: Beispiel S12 (0029, 00:13:55-00:14:18): „Kein richtiger Sitz“
Tabelle 25: Beispiel S13 (0030, 00:08:09-00:14:25): „Schwa-Laut“
Tabelle 26: Beispiel S14 (0030, 00:12:50-00:13:11): „Deswegen hat es gekiekst“
Tabelle 27: Beispiel S15 (0031, 00:02:08-00:02:40): „Gefühl von inhalare“
Tabelle 28: Beispiel S16 (0046, 00:02:08-00:02:40): „Kiefer möglichst hängen lassen“
Tabelle 29: Beispiel S17 (0046, 00:04:50-00:05:02): „Schöner Stimmschluss“
Tabelle 30: Beispiel S18 (0079, 00:18:12-00:18:35): „Mit dem Bogen auf der Seite“
Tabelle 31: Beispiel S19 (0129, 00:05:15-00:07:39): „Such den Klang“
Tabelle 32: Beispiel S20 (0129, 00:07:36-00:08:11): „Engster Punkt im Vokaltrakt“
Tabelle 33: Beispiel S21 (0024, 00:04:10-00:04:41): „Mehr Kompression in Richtung i“
Tabelle 34: Beispiel S22 (0024, 00:13:43-00:14:44): „Vordersitz“
Tabelle 35: Beispiel S23 (0051, 00:05:00-00:14:26): „Drei Schichten der Stimmlippe “
Tabelle 36: Beispiel S24 (0052, 00:06:25-00:07:09): „Randstimme schließt nicht“
Tabelle 37: Beispiel S25 (0085, 00:01:50-00:01:59): „Aussteigen aus der Form“
Tabelle 38: Beispiel S26 (0134, 00:09:45-00:10:23): „Fließendere Struktur“
Tabelle 39: Beispiel S27 (0043, 00:06:22-00:06:30): „Wenig unnötige Zwischentöne“
Tabelle 40: Beispiel S28 (0056, 00:13:58-00:14:21): „Rückkehr zum Originalvokal“
Tabelle 41: Beispiel S29 (0125, 00:19:29-00:19:54): „Brillanz in der Dunkelheit“
Tabelle 42: Beispiel S30 (0029, 00:11:06-00:11:39): „Sitz geht weg“
Tabelle 43: Beispiel S31 (0030, 00:16:25-00:16:41): „Sing geerdeter “
Tabelle 44: Beispiel S32 (0046, 00:03:08-00:03:48): „Geblökt“
Tabelle 45: Beispiel S33 (0046, 00:17:15-00:17:38): „Frauen- vs. Männerstimmen“
Tabelle 46: Beispiel S34 (0046, 00:18:30-00:18:43): „Mehr Griff“
Tabelle 47: Beispiel S35 (0074, 00:14:00-00:14:26): „Das ist so ein Aushängeton“
Tabelle 48: Beispiel S36 (0052, 00:16:18-00:17:46): „Abgedunkelt und ausgewichen“
Tabelle 49: Beispiel S37 (0149, 00:00:35-00:01:45): „Stimme ist dreidimensional“
Tabelle 50: Beispiel S38 (0057, 00:07:29-00:08:02): „Langsam umbauen“
Tabelle 51: Beispiel S39 (0083, 00:06:20-00:08:02): „Positiv belegte Luftigkeit“
Tabelle 52: Beispiel S40 (0080, 00:02:00-00:02:35): „Am Stimmschluss bleiben“
Tabelle 53: Beispiel S41 (0080, 00:11:36-00:12:00): „Ein archaisches Stück“
Tabelle 54: Beispiel S42 (0129, 00:14:17-00:15:07): „Die Farbe hat etwas Trauriges“
Tabelle 55: Beispiel S43 (0125, 00:09:25-00:01:45): „Eine Vokallinie“
Tabelle 56: Beispiel S44(0169, 00:13:45-00:14:35): „Du greifst zu sehr“
Tabelle 57: Beispiel S45 (0027, 00:01:32-00:01:44): „Ein kleiner Colpo“
Tabelle 58: Beispiel S46 (0027, 00:01:56-00:02:27): „An der Stütze bleiben“
Tabelle 59: Beispiel S47 (0057, 00:09:50-00:10:49): „Dunkle Leichtigkeit“
Tabelle 60: Beispiel S48 (0082, 00:06:22-00:08:06): „Da meckere ich jetzt rein“
Tabelle 61: Beispiel S49 (0029, 00:12:38-00:12:55): „Zuckerhut“
Tabelle 62: Beispiel S50 (0142, 00:13:00-00:14:22): „Das ist zu guttural“
Tabelle 63: Beispiel S51 (0161, 00:05:10-00:05:29): „Trau dich zu einem hupenden Ton“
Tabelle 64: Beispiel S52 (0138, 00:14:15-00:15:11): „Luftdruck prozentual anpassen“
Tabelle 65: Beispiel S53 (0079, 00:00:02-00:10:59): „Eine u-Länge“
Tabelle 66: Beispiel S3 (0127, 00:04:30-00:08:06): „Bleib drin“
Tabelle 67: Beispiel S51 (0161, 00:05:10-00:05:29): „Trau dich zu einem hupenden Ton“
Tabelle 68: Beispiel S52 (0138, 00:14:15-00:15:11): „Luftdruck prozentual anpassen“
Tabelle 69: Beispiel S19 (0129, 00:05:15-00:07:39): „Such den Klang“
Tabelle 70: Beispiel S24 (0052, 00:06:25-00:07:09): „Randstimme schließt nicht“
Tabelle 71: Beispiel S41(0080, 00:11:36-00:12:00): „Ein archaisches Stück“
Tabelle 72: Beispiel V8 (0142, 00:01:32-00:01:41): „Aber nicht zusammen“
Tabelle 73: Beispiel V9 (0160, 00:06:17-00:06:36): „Resonatorisch zu denken“
Tabelle 74: Beispiel V10a (0041, 00:10:05-00:10:11): „Dach“
Tabelle 75: Beispiel S24 (0052, 00:06:25-00:07:09): „Randstimme schließt nicht“
Tabelle 76: Beispiel B2 „Dach, Kappe, Kuppel, Glocke“
Tabelle 77: Beispiel V11 (0126, 00:10:52-00:11:05): „Mehr gesprochen“
Tabelle 78: Beispiel V12 (0170, 00:00:33-00:00:44): „Eine Kappe aufsetzen“
Tabelle 79: Beispiel V13 (0170, 00:07:20-00:07:46): „Spazierstock“
Tabelle 80: Beispiel V10a (0041, 00:10:05-00:10:11): „Dach“
Tabelle 81: Beispiel V10b (0161, 00:18:15-00:18:22): „Kuppel“
Tabelle 82: Beispiel V14 (0041, 00:10:11-00:10:24): „Ein vorderer Anteil dazu“
Tabelle 83: Beispiel V15 (0158, 00:15:20-00:15:50): „Dichte Stimmlippenschluss 1“
Tabelle 84: Beispiel V16a (0041, 00:09:30-00:09:57): „Bow and arrow 1“
Tabelle 85: Beispiel V16b (0056, 00:01:25-00:01:40): „Bow and arrow 2“
Tabelle 86: Beispiel V10c (0160, 00:15:00-00:15:18): „Kuppel“
Tabelle 87: Beispiel V17 (0125, 00:06:50-00:06:55): „Da machst du einen Albatros“
Tabelle 88: Beispiel V18 (0125, 00:10:51-00:11:03): „Perfekt geführtes Vibrato“
Tabelle 89: Beispiel V3a (Aufnahme 0092): „Hohe Resonanz 1“
Tabelle 90: Beispiel V19 (0160, 00:01:17-00:01:36): „Das ist es“
Tabelle 91: Beispiel V20 (0158, 00:14:50-00:15:03): „Du haust ein bisschen ab“
Tabelle 92: Beispiel V15b (0150, 00:12:20-00:11:36): „Dichte Stimmlippenschluss 2“
Tabelle 93: Beispiel V21 (141, 00:05:40-00:06:00): „Man will es so hier haben“
Tabelle 94: Beispiel V22 (0056, 00:10:35-00:10:40): „Verbindung zum tiefen Atem“
Tabelle 95: Beispiel V23 (0125, 00:03:40-00:05:20): „Mach das h oben“
Tabelle 96: Beispiel V24 (0170, 00:00:20-00:00:35): „Drüber haben“
Tabelle 97: Beispiel V3b (0142, 00:03:10-00:03:14): „Hohe Resonanz 2“
Tabelle 98: Beispiel V3c (Aufnahme 0104): „Obertonbündelung“
Tabelle 99: Beispiel V19 (0160, 00:01:17-00:01:36): „Das ist es“
Tabelle 100: Beispiel V25 (0150, 00:02:00-00:02:09): „Bisschen länger“
Tabelle 101: Beispiel V10a (0041, 00:10:05-00:10:11): „Dach“
Tabelle 102: Beispiel V11 (0126, 00:10:52-00:11:05): „Mehr gesprochen“
Tabelle 103: Beispiel V1 (0150, 00:16:56-00:17:58): „Robbe“
Tabelle 104: Beispiel V22 (0056, 00:10:35-00:10:40): „Verbindung zum tiefen Atem“
Tabelle 105: Beispiel V26a (0125, 00:14:45-00:14:58): Streichen eines Cello-Bogens 1“
Tabelle 106: Beispiel V20 (0158, 00:14:50-00:15:03): „Du haust ein bisschen ab“
Tabelle 107: Beispiel V25 (0150, 00:02:00-00:02:09): „Bisschen länger“
Tabelle 108: Beispiel V5 (0150, 00:08:02-00:02:13): „Anzeigen des Resonanzortes“
Tabelle 109: Beispiel S2 (0141, 00:03:10-00:03:57): „Mit der Ölkanne drüber“
Tabelle 110: Beispiel V26a (0125, 00:14:45-00:14:58): „Streichen eines Cello-Bogens 1“
Tabelle 111: Beispiel V26b (0124, 00:05:10-00:06:41): „Streichen eines Cello-Bogens 2“
Tabelle 112: Beispiel S4 (0169, 00:12:15-00:12:28): „Cello“
Tabelle 113: Verwendungshäufigkeit der Wörter aller Befragten
Tabelle 114: Verwendungshäufigkeit der Wörter innerhalb der Gruppe der Sänger/Sängerinnen
Tabelle 115: Verwendungshäufigkeit der Wörter innerhalb der Gruppe der Professoren für Gesang
Tabelle 116: Cluster 1 (oben), Cluster 2 (Mitte), Cluster 3 und 4 (unten)
Tabelle 117: Cluster 5 (oben) und 6 (unten)
Tabelle 118: Cluster 7, 8 (oben), 9, 10 und 11 (unten)
Tabelle 119: Cluster 12 (oben), Cluster 13 und 14 (unten)
Tabelle 120: Cluster 15, 16, 17, 18, 19 und 20
Tabelle 121: Cluster 21 (oben), 22 (Mitte), 23 und 24 (unten)
Tabelle 122: Cluster 25 (oben) und Cluster 26 (unten)
Tabelle 123: Cluster 27 (oben), Cluster 28 (Mitte), Cluster 29 und 30 (unten)
Tabelle 124: Cluster 31 (oben) und Cluster 32 (unten)
Tabelle 125: Cluster 33 (oben) und Cluster 34, 35 und 36 (unten)
Tabelle 126: Cluster 37, 38, 39, 40 (oben) und Cluster 41 und 42 (unten)
Tabelle 127: Ausschnitt ohne Cluster (oben) und Cluster 43 (unten)
Tabelle 128: Cluster 44 (oben) und Cluster 45 (unten)
Tabelle 129: Cluster 46 (oben) und Cluster 47 (unten)
Tabelle 130: Cluster 48 (oben) und Cluster 49 (unten)
Tabelle 131: Cluster 50 (oben) und Cluster 51 und 52 (unten)
Tabelle 132: Cluster 53 (oben) und Cluster 54 (unten)
Tabelle 133: Cluster 55 und 56 (oben) und Cluster 57 (unten)
Tabelle 134: Cluster 58 (oben) und Cluster 59 (unten)
Tabelle 135: Cluster 60 (oben) und Cluster 61 und 62 (unten)
Tabelle 136: Cluster 63 (oben), Cluster 64 (Mitte), Cluster 65 (unten)
1 Auf der Suche nach Beschreibungen der Singstimme: Die Recherchen und ihre Rahmen
1.1 Das Interesse am Thema
Auf der Suche nach Beschreibungsmöglichkeiten der Singstimme trifft man immer wieder auf die weitverbreitete Auffassung von professionell Schreibenden, Experten/Expertinnen, Lehrenden, Studierenden, Sängern/Sängerinnen und Schülern/Schülerinnen, es sei unmöglich, über den Klang von Singstimmen zu sprechen, es gäbe keine Wörter, keine Terminologien mit festen Regeln, bzw. es stünden nur wenige kodifizierte Begriffe dafür zur Verfügung. Der Widerspruch zwischen dieser Auffassung und der Tatsache, dass privat und institutionell sehr häufig über die Stimme kommuniziert wird und kommuniziert werden muss, war Anlass, zu untersuchen, wie diese Kommunikation in unterschiedlichen Rahmen1 geschieht – mit Wörtern, mit Sprachbildern, mit Gestik und Mimik, mit Vormachen und Nachmachen.
1.2 Zielsetzung
In vorliegender Arbeit geht es um Beschreibungen der Singstimme und stimmlicher Klangphänomene in unterschiedlichen Rahmen. Anhand verschiedener Texte von professionell Schreibenden, Experten/Expertinnen, Lehrenden, Studierenden, Sängern/Sängerinnen2 und Schülern/Schülerinnen über Qualitäten von Stimmen unter Einbezug spontan formulierter, usueller, kodifizierter, sprachwissenschaftlicher und gesangspädagogischer sowie didaktischer Redeweisen zur Beschreibung der menschlichen Singstimme sollen die praktische Verfügbarkeit und semantische Reichweite von Beschreibungsmöglichkeiten klanglicher Phänomene, gesangstechnischer Aspekte sowie diverse Formen multimodalen Zeigens systematisiert präsentiert werden.
Eine sprachwissenschaftliche und gleichzeitig musikwissenschaftlich und gesangspädagogisch informierte Studie zur Beschreibung der Singstimme fehlt bisher. Der gewählte sprachwissenschaftliche Ansatz ermöglicht es, Verwendung und Bedeutungskonstitution terminologischer und nicht-terminologischer, sprachlicher (verbaler) und nicht-sprachlicher (non-verbaler) Zeichen zu beschreiben, was alleine aus der Musikwissenschaft, Musik- oder Gesangspädagogik heraus nicht zu leisten wäre.3
1.3 Aufbau und Methoden der Untersuchung
„Sonne überm Hochnebel“, „das Streicheln einer warmen Hand“, „Sinken in einen samtenen Sessel“, „Eis im Glas“, „rohes Hackfleisch“4, „ein depressiver Roboter“, „nicht wie tönend Erz, sondern eine vokal fein ziselierte Schmiedearbeit“5: Zu Beginn der Untersuchung fand sich ein Arsenal an extravaganten Formulierungen zur Beschreibung von Singstimmen in musikjournalistischen Texten und eine breite stilistische Varianz im tatsächlichen Sprechen über die Stimme. Daraus ergab sich der Wunsch nach einer systematisierten Präsentation von Beschreibungsmöglichkeiten der menschlichen Singstimme.
Wenn Personen, in Alltagssituationen gefragt nach Möglichkeiten, Singstimmen zu beschreiben, allerdings antworten, dafür gäbe es keine Wörter, andererseits privat und institutionell sehr häufig über die Stimme kommuniziert wird und kommuniziert werden muss, zeigt das, dass Menschen kurzschlüssig bereit sind, Grenzen des Sprachsystems zu sehen, wie Ludwig Wittgenstein im „Tractatus“, als er noch auf der Suche nach der „idealen Sprache“ war. Wittgenstein meinte 1918, er könne dieses ethisch-philosophische Problem mit dem Verdikt: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“6 lösen oder mit dem apodiktischen Satz: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“.7
Der Tatsache, dass in unterschiedlichen Handlungsrahmen ganz unterschiedlich über Singstimmen gesprochen wird, wurde bei den Recherchen dadurch Rechnung getragen, dass unterschiedliche Verfahren zur Datenerhebung zum Einsatz kamen. Sie werden in den entsprechenden Abschnitten detailliert begründet. Die Daten, die auf diese Weise in qualitativen Forschungsverfahren sichtbar wurden, sind in dieser Untersuchung als Beispiele relevant und werden exemplarisch interpretiert.
Basis dieser Untersuchung ist ein großes, eigens für diese Untersuchung erstelltes Korpus.
Es reicht von pressetextlichen Beschreibungen über spontane und in leitfadengesteuerten Interviews mit Experten/Expertinnen gefundene Formulierungen bis hin zu Aussagen aus Befragungen von über einhundert Schülern/Schülerinnen, Sängern/Sängerinnen und Gesanglehrenden über die Beschreibbarkeit von Singstimmen. Die Daten der Erhebungen liegen vor in mündlicher und schriftlicher Form und in Videographien.
In den Videographien der Beobachtung von professionellem Gesangsunterricht zeigten sich weitere Möglichkeiten der Kommunikation über die Stimme. Mittels der daraus erstellten Transkriptionen der verbalen, non-verbalen und para-verbalen Handlungen in Kombination mit aussagekräftigen Video-Stills und Erläuterungen der jeweils spezifischen Situation im Gesangsunterricht wird demonstriert, auf welche Stimmbeschreibungen in der Praxis zurückgegriffen wird, welche neu generiert werden, und generell, welche Formen des Zeigens und Erklärens (verbal, musikalisch und/oder gestisch) bei der Kommunikation über gesangstechnische Aspekte, den Klang der Stimme und künstlerische Elemente im professionellen Gesangsunterricht eingebracht werden. Es wurde, wo möglich, neben der Einordnung des Gestenstatus und der Gestenfunktion, ein Bezug zwischen den in der jeweilig abgebildeten Situation verwendeten Beschreibungen und Gesten zur alphabetischen Wortliste und der Kategorisierung der Wörter hergestellt.
Mit dem Korpus, basierend auf den erhobenen Daten, ließen sich 393 Wörter belegen, die zur Beschreibung der Singstimme verwendet werden. Ihre Bedeutungen wurden aus sprachwissenschaftlicher und gesangspädagogischer Perspektive rekonstruiert: anhand umfangreicher korpusbasierter Recherchen der Kontexte, in denen sie gebraucht werden mit KorAP8 und LexisNexis9, anhand von Erklärungen, die in Interviews erfragt wurden, und anhand des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (DWDS)10.
Die Befunde werden ausführlich erörtert und die Ergebnisse in einer alphabetischen Wortliste übersichtlich dargestellt. Außerdem wurden alle Wörter danach kategorisiert, ob sie als Bezeichnungen für Stimmgattung, Stimmtyp, Stimmfach, Stimmumfang oder zur Beschreibung von Physiologie und Funktionalität (z. B. Artikulationsort, Artikulationsart, Stimmregister, Stimmführung, Vibrationsart/-form, Einstellung Ansatzrohr, Dynamik) verwendet werden. Eine Datenanalyse (Clusteranalyse) zeigt, in welcher Beziehung die Wörter aufgrund ihrer Merkmale zueinander stehen.
Diese Wortliste mit den knapp 400 Lemmata ist als Nachschlagewerk für Unterrichtende, Studierende, Schreibende und alle gedacht, die Beschreibungsmöglichkeiten der Singstimme brauchen. Durch die belegten Definitionen und Kategorisierungen sowie durch die nachgewiesenen Anwendungsbeispiele erhält man einen Überblick über deren Verwendung.
1.4 Der Unsagbarkeitstopos und die Verwendung von Metaphoriken
Wie eingangs beschrieben, trifft man, auf der Suche nach Beschreibungsmöglichkeiten der Singstimme, immer wieder auf die weitverbreitete Auffassung, es sei unmöglich, über Stimmen zu sprechen. Befragte aller Gruppen teilen die Auffassung, es gäbe keine Wörter, keine Terminologien mit festen Regeln, bzw. es stünden nur wenige kodifizierte Begriffe dafür zur Verfügung.
Wie aber wird nun in den unterschiedlichen untersuchten Rahmen – in musikjournalistischen Texten, in der Schule, in wissenschaftlichen Fächern, wo man sich hauptberuflich mit der Stimme beschäftigt sowie im professionellen Gesangsunterricht –, in denen über Singstimmen gesprochen wird und gesprochen werden muss, über das vermeintlich Unsagbare kommuniziert?
Um Bedeutungen von Wörtern/Wortverbindungen zu verstehen, muss man Verwendungsregeln und aktuelle Kontexte kennen.11 Verwendungsregeln und Bedeutungen sowie Bedeutungsdifferenzierungen können dann thematisiert werden, wenn sie Ergebnis „praktischer Koordination“ und „gemeinsamer sprachlich getroffener Kategorisierungen, Klassifizierungen und Unterscheidungen“12 sind. Menschen bringen ihre „Welt gemeinsam durch kongruente Unterscheidungen hervor“13. Demnach lässt sich Erkenntnis als „wirksames Handeln“ beschreiben, welches „in kultureller Tradition gelebt“14 wird, „in der Koppelung der sozialen Gruppe“15.
In dieser Arbeit werden folgende Verwendungen von Wörtern/Wortverbindungen unterschieden: Zum einen gibt es Verwendungen, die in Lexika kodifiziert sind und die man mit dem Erlernen der Sprache lernt. Henn-Memmesheimer (1991) führt an dieser Stelle das Beispiel der lachenden Sonne an:
So lernt man, wann man sagt die Sonne scheint, und spätestens im Kindergarten und in den Bilderbüchern sieht man, daß die Sonne auch lachen kann.16
Zum anderen gibt es usuelle Verwendungen von Wörtern/Wortverbindungen. Dabei handelt es sich um Verwendungen, die nicht kodifiziert, jedoch in einem Rahmen für eine Gruppe gebräuchlich (usuell) sind. Des Weiteren existieren singuläre (innovative) Verwendungen von Wörtern/Wortverbindungen. Sie werden spontan kreiert.
Für das Sprechen über die Singstimme kommen häufig sogenannte Metaphern und metaphorische Beschreibungen zum Einsatz, die sich sowohl innerhalb fachterminologischer als auch nicht-fachterminologischer Beschreibungen finden. Bei dieser Form der Beschreibungen kann es sich um kodifizierte, usuelle oder um mehr oder weniger innovative Verwendungen von Wörtern/Wortverbindungen handeln, die wörtlich genommen keine konsistente Lesart zulassen. Solche Metaphoriken verlangen Modifikationen vorhergehender Anschauungen.
Obwohl die Verwendung der Wörter/Wortverbindungen keine konsistente Lesart zulässt, haben Lesende den Eindruck, die Aussage zu verstehen, denn
der Text ist durch die Art der Veröffentlichung, durch die verschiedenen sprachlichen und nichtsprachlichen Kontexte legitimiert, so daß der Leser sich schon durch die gegenwärtige Redeinstanz veranlaßt sieht, nach Möglichkeiten zu suchen, den Text so zu lesen, daß er zu diesem Satz Stellung nehmen kann mit ja oder nein. Mit anderen Worten: man versucht, den Satz so sinnvoll zu machen, daß man ihn akzeptieren oder ablehnen kann.17
Ungewöhnliche Wortverbindungen können erstarren und zu kodifizierten Kollokationen werden.
In den folgenden Beispielen, Singstimmen beschreibend, werden Wörter/Wortverbindungen verwendet, die unter Beachtung aller kodifizierten Verwendungsregeln der vorkommenden Wörter im DWDS keine konsistente Lesart der Sätze zulassen.
- Beispiel 1: „Man erlebt hier nicht tönend Erz, sondern eine vokal fein ziselierte Schmiedearbeit.“18
- Beispiel 2: „Seine Stimme kann bei Barockmusik jubelnd in die Höhe fahren und ein Licht ausgießen, das so intensiv leuchtet wie Neon.“19
- Beispiel 3: „Das ist ein Ölbadklang.“20
In Beispiel 1 wird der Stimmklang mit einem Mineral verglichen, aus dem durch Verhüttung Metall gewonnen wird21, das durchaus tönen kann. Allerdings geht es auch um kunstvoll verarbeitetes Metall. In Beispiel 2 werden Töne mit Licht metaphorisiert und in Beispiel 3 wird die Viskosität des Ölbads in Beziehung gesetzt zur Stimme. In allen drei Beispielen entspricht die syntaktische Struktur zwar der Norm der deutschen Sprache, die in Beziehung gesetzten und verglichenen Gegenstände stammen jedoch aus unterschiedlichen Bereichen, was eine wörtliche Interpretation unmöglich macht. „Ölbad“ wird in der Bedeutungsübersicht des DWDS folgendermaßen umschrieben:
medizinisches Bad, dem (besonders zur Behandlung trockener Haut) Öl zugesetzt ist22
Die Distanz der einzelnen Wörter wird bei allen Versuchen der Interpretation, die auf das „Sein-wie“23 gerichtet sind, bestehen bleiben.24 Dies ist das zentrale Kennzeichen des metaphorischen Ausdrucks, wie Henn-Memmesheimer (1991) feststellt: „Die unmögliche wörtliche Interpretation [wird] nicht einfach durch eine metaphorische aufgehoben […], sondern [gibt] ihr nur widerstrebend nach […].25 Goodman (1973) formuliert: Diese „Affaire zwischen einem Prädikat mit Vergangenheit und einem Objekt, das sich unter Protest hingibt“26, nennt sich Metapher.
Wie aber kann es nun sein, dass man die vorliegenden ungewöhnlichen Wortverbindungen, und generell die Sätze, verstehen will und kann? Hilfreich für ein Verständnis ist hierfür die Definition von Lausberg (1967), der beschreibt, dass die Metapher „der Ersatz eines verbum proprium [z. B. Krieger] durch ein Wort, dessen eigene proprie-Bedeutung mit der des ersetzen Wortes in einem Abbild-Verhältnis (similitudo […]) steht“27, ist. Er nennt dazu das Beispiel: „Achill war ein Löwe in der Schlacht.“ Löwe28 attribuiert an dieser Stelle den Krieger. Bei Lausberg heißt es: „Die Metapher wird […] auch als „gekürzter Vergleich“ definiert, in dem das Verglichene mit dem Abbild in eins gesetzt wird“29. Das In-eins-Setzen ohne einen Vergleichspartikel macht metaphorische Beschreibungen prinzipiell prägnanter und intensiver als Vergleiche.
Für einen Interpretationsversuch von Ölbadklang wird die Beschreibungen aus dem DWDS herangezogen: „medizinisches Bad, dem (besonders zur Behandlung trockener Haut) Öl zugesetzt ist“. Nun kann eine Stimme weder medizinisch sein, noch trockene Haut kurieren. Die Assoziationen, die mit dieser Metapher einhergehen, sind deshalb zuerst unscharf. Man verbindet unproblematisch etwas Geschmeidiges, angenehm Warmes und Wohliges damit. Eventuell hat man ein konkretes Ölbad-Erlebnis vor Augen. Der Begriff „Ölbadklang“ erfährt so eine Ausdifferenzierung, über das im Lexikon Kodifizierte hinausgehend. Die Merkmale eines Ölbads und die damit einhergehenden, persönlichen und kulturell geprägten Erfahrungen werden auf die Stimme, den Stimmklang, übertragen. Beim Versuch der Interpretation kommt man zu usuellen Wörtern/Wortverbindungen mit Stimme und Klang. Ein als angenehm („unaufdringlicher, dezenter Klang“), schön („als in allen Ausprägungen ästhetisch ansprechend empfundener Klang“) und warm („ausgewogene Registermischung, die harmonische Obertonbündelungen bevorzugt und einen als angenehm und wohlig empfundenen Klang erzeugt“) empfundener Stimmklang, der durch ein günstiges Atemmanagement als fließend wahrgenommen wird.30
Diese Ausdifferenzierung kann aber, so Henn-Memmesheimer (1991), „immer weiter getrieben werden […], weil notwendig ein Rest von Unpassendheit bleibt, eine Spannung zwischen der wörtlichen Bedeutung und der in der Metapher erzeugten Bedeutung.“31 Neue soziale Koordinationen, neue Redeweisen sind dann geschaffen (auch wenn diese nur in speziellen Rahmen goutiert werden), wenn die Metapher oder das ganze Feld akzeptiert werden.32
In den Beispielen 1 und 2 ist dies ebenso der Fall: Unter Heranziehung aller kodifizierten Verwendungsregeln der vorkommenden Wörter, der in Beziehung gesetzten und verglichenen Gegenstände, ergibt sich keine konsistente Lesart des Textes. Gemäß unseren erlernten und sozial koordinierten Unterscheidungen sind die Zuordnungen von „feinziseliert“ und „Schmiedearbeit“ in Beispiel 1 „und eine Stimme, die Licht ausgießt“ in Beispiel 2 außergewöhnlich. Die verglichenen Gegenstände stammen aus unterschiedlichen Bereichen. Dennoch haben Rezipienten nicht den Eindruck von Nonsens. „Der Text ist durch die Art der Veröffentlichung, durch die verschiedensten sprachlichen und nichtsprachlichen Kontexte legitimiert.“33 Lesende versuchen, durch die gegenwärtige Redeinstanz veranlasst, die Sätze (Beispiele 1, 2 und 3) so sinnvoll zu machen, dass man sie akzeptieren oder ablehnen kann. Im Fall von Beispiel 1 werden der Stimme nicht die Eigenschaften des Metalls („hell-dunkel klingend, hochgradig qualitätsvoll.“34) zugeschrieben, sondern die, einer „vokal fein ziselierten Schmiedearbeit“. Experten/Expertinnen können dies interpretieren als eine „fein konturierte Stimme, die zwar einen kernigen Klang hat, jedoch von eher limitiertem Material ist, aus welchem sich aber eine dominante hochfrequente Obertonzusammensetzung ergibt“35. „Fein ziseliert“ kann andererseits auch den Aspekt der Ausgearbeitetheit betonen.
Bei Beispiel 2 kann die lichtausgießende Stimme für Experten/Expertinnen eine Stimme sein, deren „Strahlkraft von luzidem Klang geprägt“36 ist. Durch den Vergleich mit einem Licht, „das so intensiv leuchtet wie Neon“ wird ein kühler, technischer Aspekt hinzugefügt. Eine Technik, die in gesangspädagogischer Terminologie als ein „obertonlastiger“, „strahlender“ Klang „mit kraftvoll definierten Obertönen“ beschrieben werden kann.37
Alle drei Beispiele zeigen, dass Metaphoriken neue Formulierungen sein können, innovative Vergleiche, aber dennoch nie voraussetzungslose Erzeugnisse. Sie sind kulturell motiviert.38 Rezipienten/Rezipientinnen können Metaphoriken nicht ohne Berücksichtigung des eigenen kulturellen Hintergrunds angehen.39 Ein eindrückliches Beispiel für die Notwendigkeit den kulturellen Zusammenhang zu rekonstruieren, bietet ein Text aus dem Alten Testament:
Deine Zähne sind wie eine Herde Schafe mit beschnittener Wolle, die aus der Schwemme steigen.40
Umberto Eco beschreibt dies als ein nicht unmittelbar überzeugendes Bild, weil man, wie er formuliert, dazu neigt „aus dem Wasser kommende Schafe als zottige, tropfende Kreaturen zu sehen (blökend und übelriechend darüber hinaus)“41. Die kulturelle Gemeinschaft zu Zeiten des Dichters war in der Lage, dieses Bild zu akzeptieren und die „großartige Einheit in der Verschiedenheit – und ihre weiße Farbe“42 hinzunehmen. Auch zeitgenössische Metaphern sind teilweise nicht ohne weiteres zugänglich und es kann sein, dass sie nur in einer bestimmten Gruppe funktionieren. Sie können einem Stil (z. B. dem Genre Musikkritik) oder einer sozialen Gruppe zugeordnet sein.
Metaphern und metaphorische Beschreibungen haben daneben auch eine kognitive Funktion: Sie schaffen neue Sichtweisen. Indem man sich Metaphoriken erklärt, lernt man etwas über den Gesprächsgegenstand und etwas über den Bereich, aus dem die Metapher entnommen ist.43 Sie „stellen die Regeln der Sprache, die man im Rahmen der bisherigen sozialen Koordination gelernt hat, in Frage und modifizieren sie (bis zu einem gewissen Grad)“44. Dies zeigen oben aufgeführte Beispiele deutlich.
Hörende und Lesende müssen bei Metaphoriken flexibel reagieren und können die Wörter teilweise nur als „Anhaltspunkte für die Erfahrung […] nehmen“45. Überraschende Metaphern eröffnen notwendig einen Interpretationsspielraum. Ob sie funktionieren, hängt vom „intertextuellen Universum des Autors und des Lesers/Hörers [ab]“46.
Das Einbringen von Metaphoriken ist, in allen untersuchten Rahmen, ein Ausweis der sprachlichen Kompetenz, des kreativen und wagemutigen Umgangs mit Sprache und der Erfahrung mit Bildern und mit Musik. Die Wahl der Wörter ist in dieser Weise lebensform-, situations- und repertoireabhängig und ist deshalb immer auch Selbstdarstellung und Beziehungsgestaltung zwischen Schreibenden/Sprechenden und Lesenden/Hörenden.47
In vorliegender Untersuchung wird unterschieden zwischen kodifizierten Metaphern (auch tote Metaphern oder Katachresen), usuellen Metaphern (auch festgewordene Metaphern, die sich in vergleichbaren Zusammenhängen immer wieder finden) und singulären Metaphern (auch innovative oder lebendige Metaphern).48 Alle diese Typen werden in allen untersuchten Rahmen gefunden.
1.5 Fachterminlogische und nicht-fachterminologische Stimmbeschreibungen
Mit der Äußerung des Unsagbarkeitstopos wird übersehen, dass neben Metaphern und metaphorischen Beschreibungen auch weitere fachterminologische Beschreibungen und nicht-fachterminologische Beschreibungen für das Kommunizieren über Singstimmen verwendet werden können.
1.5.1 Fachterminologische Stimmbeschreibungen
Beim Sprechen über Singstimmen kommen in allen in dieser Studie untersuchten Rahmen, vermehrt jedoch im professionellen Rahmen, beispielweise im Gesangsunterricht, bei Gutachten und Prüfungen oder in der Kommunikation von Experten/Expertinnen, fachterminologische Beschreibungen zum Einsatz. Diese Beschreibungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Gruppe derjenigen, die sie verwendet, über ein spezifisches gemeinsames Wissen verfügt. Oft werden fachterminologische Beschreibungen dort verwendet, wo es keine passendere Bezeichnung gibt oder eine nicht-fachterminologische Beschreibung zu ausufernd wäre. Sie werden situations- und kontextabhängig und in Ergänzung zu nicht-terminologischen Beschreibungen eingesetzt. Bei Beschreibungen, die Singstimme betreffend, kann zurückgegriffen werden auf Fachtermini aus musikwissenschaftlichen, gesangspädagogischen, sprachwissenschaftlichen und medizinischen Fachgebieten. Fachtermini sind in einschlägigen Lexika und Wörterbüchern aufgeführt und als solche gekennzeichnet. Sie gelten damit als kodifiziert.49 Bei kodifizierter Verwendung von Wörtern/Wortverbindungen kann es sich um Metaphern und metaphorische Beschreibungen handeln.
1.5.2 Nicht-fachterminologische Beschreibungen
Unter nicht-fachterminologischen Beschreibungen werden in dieser Studie Verwendungen von Wörtern/Wortverbindungen verstanden, die im täglichen Umgang beim Sprechen über Singstimmen benutzt werden. Sie sind in Lexika nicht als Fachtermini ausgewiesen. In ihrer Verwendung können sie usuell oder innovativ sein. Usuell gebrauchte Wörter/Wortverbindungen sind in der Liste der zur Beschreibung der Singstimme verwendeten Wörter (siehe Kapitel 10) aufgeführt oder wurden in Gesprächen mit Experten/Expertinnen als usuell eingestuft. Sowohl bei usueller als auch bei innovativer Verwendung von Wörtern/Wortverbindungen kann es sich um Metaphern und metaphorische Beschreibungen handeln.
1.6 Aufbau der Arbeit
Für die Arbeit ergibt sich folgender Aufbau: Kapitel 2 widmet sich dem Sprechen über Singstimmen im Rahmen musikjournalistischer Texte. Im Anschluss wird in Kapitel 3 und 4 untersucht, wie im schülersprachlichen und expertensprachlichen Rahmen über Singstimmen kommuniziert wird, bevor in Kapitel 5 Kommunikationen über die Singstimme im Rahmen professionellen Gesangsunterrichts analysiert werden. Die in den unterschiedlichen Rahmen gefundenen Wörter werden in Kapitel 10 in der Liste der zur Beschreibung der Singstimme verwendeten Wörter zusammengeführt, aus sprachwissenschaftlicher und gesangspädagogischer Perspektive definiert, kategorisiert und mit nachgewiesenen Anwendungsbeispielen belegt. Eine Datenanalyse in Kapitel 6 clustert die Wörter nach Ähnlichkeiten.
1 Vgl. Esser 2001, der die Rahmentheorie als generelle Handlungstheorie versteht. Weitere Erläuterungen finden sich in Abschnitt 1.3.
2 Sänger/Sängerinnen und Gesanglehrende gehören zur Gruppe der Experten/Expertinnen. Sie werden jedoch gesondert aufgeführt, da sie sich aufgrund ihrer Tätigkeit auf je spezifische Weise mit der Singstimme beschäftigen.
3 Im Gegensatz zu Merrill 2018 beschäftigt sich diese Arbeit nicht mit Bewertung und Wirkung (Wirkungsästhetik) vokalen Ausdrucks.
4 Vgl. Romberg 1998, S. 50.
5 Die Beispiele sind dem Korpus musikjournalistischer Texte entnommen (siehe Abschnitt 2.3).
6 Wittgenstein 1963, Abschnitt 7.
7 Wittgenstein 1963, Abschnitt 5.6.
8 KorAP ist die neue Analyseplattform des Leibnitz-Instituts für deutsche Sprache (IDS). Mit diesem Analyse-Tool lässt sich kostenlos auf das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo), die mit 53 Milliarden Wörtern weltweit größte linguistisch motivierte Sammlung elektronischer Korpora mit geschriebenen deutschsprachigen Texten aus der Gegenwart und der neueren Vergangenheit, zugreifen, vgl. https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpusrecherchesystem/, (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).
9 LexisNexis ist ein kommerzielles Recherche-Tool, welches Zugriff auf eine Online-Datenbank mit mehr als 40.000 Nachrichtenquellen mit über fünf Milliarden Volltexten internationaler Periodika, Presse- und Wirtschaftsinformationen bietet, vgl. https://www.lexisnexis.de/unternehmen/ueber-uns, (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).
10 Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), auch „Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart“, ist ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das DWDS-Kernkorpus des 20. Jahrhunderts ist ein nach Textsorten und zeitlich über das gesamte Jahrhundert ausgewogenes Korpus. Es besteht aus den vier Textsorten Belletristik, Gebrauchsliteratur, Wissenschaft und Zeitung und umfasst aktuell etwa 100 Millionen Textwörter. Das Korpus basiert auf dem Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache und auf Teilen des Großen Wörterbuchs der deutschen Sprache, vgl. www.dwds.de/d/hintergrund, (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).
11 Vgl. Henn-Memmesheimer 1991, S. 21.
12 Henn-Memmesheimer 1991, S. 21.
13 Maturana/Varela 1987, S. 261.
14 Maturana/Varela 1987, S. 261.
15 Henn-Memmesheimer 1991, S. 21.
16 Henn-Memmesheimer 1991, S. 21.
17 Henn-Memmesheimer 1991, S. 27.
18 Brug, Manuel, Die Welt, 23.06.2017.
19 Goertz, Wolfram, Die Zeit, 04.03.2015.
20 Zitat aus dem Chatverlauf während des hybriden Konzertformats „Let´s play: Connection loading“ (Godot Komplex) von Peter Anton Ling, 29.09.2022.
21 Vgl. https://www.dwds.de/wb/Erz, (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).
22 https://www.dwds.de/wb/%C3%96lbad, (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).
23 Ricoeur 1986, S. 251.
24 Vgl. Henn-Memmesheimer 1991, S. 25.
25 Ricoeur 1987, S. 25.
26 Goodman 1973, S. 79.
27 Lausberg 1967, S. 78.
28 Der König der Tiere ist ein großes, katzenartiges Raubtier, das seiner Kraft und Kühnheit wegen als Sinnbild der Stärke und des Mutes gilt, vgl. https://www.dwds.de/wb/L%C3%B6we#d-1-1-1, (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).
29 Lausberg 1967, S. 78.
30 Vgl. Wortliste (Kapitel 10) s. v. angenehm, schön, warm, geölt und fließend.
31 Henn-Memmesheimer 1991, S. 27, m. w. N.
32 Vgl. Henn-Memmesheimer 1991, S. 27.
33 Henn-Memmesheimer 1991, S. 25.
34 Vgl. Wortliste s. v. erzen.
35 Ling, im Gespräch, 26.10.2022.
36 Ling, im Gespräch, 26.10.2022.
37 Siehe Wortliste s. v. hell: „Meist in Verbindung mit einer hohen Stimme ausgestrahlter obertonlastiger Klang“ und strahlend: „kraftvoll definierte Obertöne“.
38 Vgl. Henn-Memmesheimer 1991, S. 27.
39 Vgl. Henn-Memmesheimer 1991, S. 30.
40 Das Hohelied Salomos 4,2.
43 Vgl. Henn-Memmesheimer 1991, S. 31.
44 Henn-Memmesheimer 1991, S. 31.
45 Henn-Memmesheimer 1991, S. 33.
46 Henn-Memmesheimer 1991, S. 34.
47 Vgl. Fix 2004 und Sandig 1986.
48 Vgl. u. a. Henn-Memmesheimer 1991, Lakoff/Johnson 1996, Peil 2004, Ricoeur 1986.
49 Konsultiert wurden u. a. DWDS, Richter 2018, Kloiber 2016 und Friedrich/Bigenzahn/Zorowka 2008.
2 Beschreibungen der Singstimme im Rahmen musikjournalistischer Texte
Großes Interesse weckten zu Beginn der Untersuchung auffällige Beschreibungen von Singstimmen in musikjournalistischen Texten und es stellte sich die Frage, weshalb manche Beschreibungen die Aufmerksamkeit in dieser Weise auf sich ziehen.
Die Recherchen zu den Beschreibungen der Singstimme im Rahmen musikjournalistischer Texte wurden mithilfe des Recherchetools LexisNexis realisiert, um einen ersten Überblick darüber zu erhalten, wie durch professionell Schreibende in unterschiedlichen Zeitungen und Magazinen über Singstimmen kommuniziert wird. Aufgrund der Zielsetzung war für diese Arbeit die Zusammenstellung eines thematisch einschlägigen Korpus notwendig.
2.1 Methodisches Vorgehen zur Korpuserstellung
Bei der Erstellung des Korpus wurde für alle Anfragen mit LexisNexis der Untersuchungszeitraum auf die fünf Jahre 2013 bis 2018 begrenzt. Die so erhaltene Datenmenge ist groß genug, um eine fundierte Analyse durchzuführen. Der Übersichtlichkeit halber wurden die 5 Jahre in 5 Perioden unterteilt, die jeweils 12 Monate umfassen.
Um an eine ausreichende Menge Texte zu kommen, die sich mit der Beschreibung der menschlichen Stimme beschäftigen, fiel die Wahl auf eine digital zugängliche und elektronisch verfügbare Materialquelle. Mit dem Recherche-Tool LexisNexis bot sich die Möglichkeit, für die festgelegten fünf Jahre lückenlos auf die ausgewählten Zeitungen und Magazine zugreifen zu können.
Details
- Seiten
- 708
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631922170
- ISBN (ePUB)
- 9783631922187
- ISBN (Hardcover)
- 9783631922163
- DOI
- 10.3726/b22018
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (März)
- Schlagworte
- Clusteranalyse Korpusrecherche Deutsch Unterricht Musik Wortliste Nachschlagewerk Lexikon Beschreibungen Journalismus Gesangsunterricht Schule Pressetexte Stimmbeschreibungen Singstimme Stimme
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 708 S., 23 farb. Abb., 6 s/w Abb., 137 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG