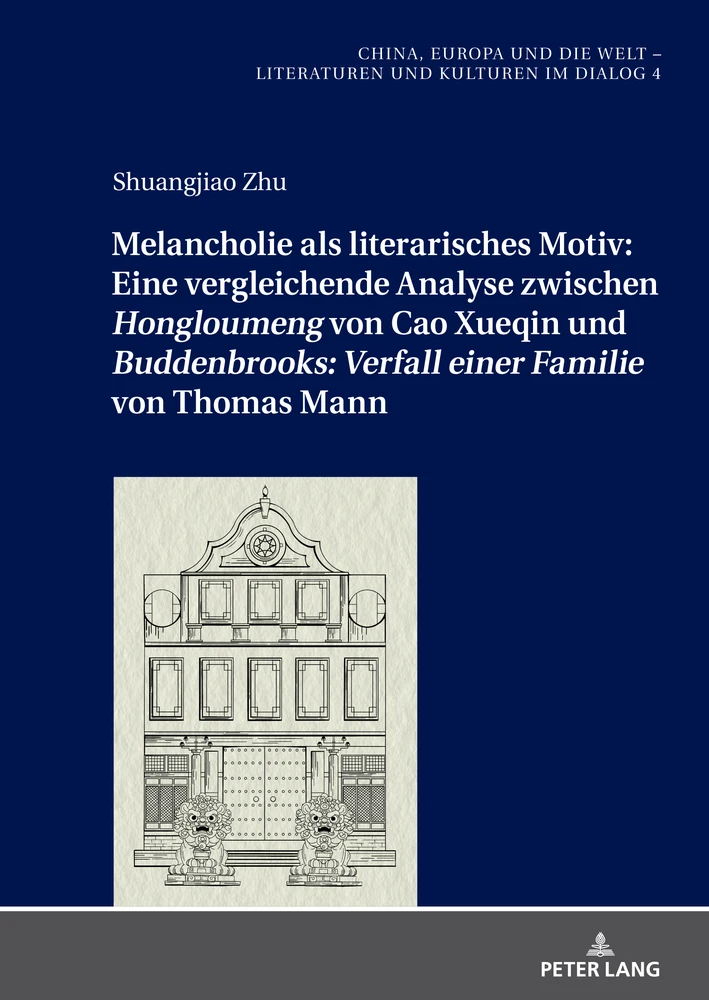Melancholie als literarisches Motiv: Eine vergleichende Analyse zwischen «Hongloumeng» von Cao Xueqin und «Buddenbrooks: Verfall einer Familie» von Thomas Mann
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Theoretische Grundlage
- 3.1 Die Perspektive der Kulturgeschichte
- 3.2 Die Perspektive der Soziologie
- 3.3 Die Perspektive der Philosophie
- 3.4 Die Perspektive der Literaturwissenschaft
- 4.Methodische Vorüberlegungen
- 5.Über die Autoren und die Werke
- 5.1 Cao Xueqin und Hongloumeng
- 5.2 Thomas Mann und Buddenbrooks: Verfall einer Familie
- 5.3 Verfall als Motiv
- 5.4 Das Bürgertum im 19. Jahrhundert
- 6.Literaturanalysen
- 6.1 Krankheit und Tod
- 6.1.1 Die Ärzte in Buddenbrooks
- 6.1.1.1 Dr. Grabow
- 6.1.1.2 Dr. Langhals
- 6.1.1.3 Herr Brecht
- 6.1.2 Die Ärzte in Hongloumeng
- 6.1.2.1 Der Hofarzt vs. der Volksarzt
- 6.1.2.2 Der konfuzianische Arzt
- 6.1.2.3 Der inkompetente Arzt
- 6.1.2.4 Der Wunderarzt
- 6.1.3 Die Krankheits- und Todesfälle in Buddenbrooks
- 6.1.3.1 Thomas: Der imaginäre Arzt
- 6.1.3.2 Christian: Der eingebildete Patient
- 6.1.3.3 Hanno: Weder krank noch gesund
- 6.1.3.4 Krankheit: Zwischen Individuum und Kollektiv
- 6.1.3.5 Melancholie: Zwischen krank und gesund
- 6.1.3.6 Melancholie: Zwischen Leben und Tod
- 6.1.4 Die Krankheits- und Todesfälle in Hongloumeng
- 6.1.4.1 Nicht-Melancholie: Entweder krank oder gesund
- 6.1.4.2 Krankheit: Zwischen Individuum und Kollektiv
- 6.1.4.3 Daiyu als Ausnahme: Zwischen krank und gesund
- 6.1.4.4 Der Tod im Diesseits
- 6.2 Männlichkeit und Weiblichkeit
- 6.2.1 Feminisierung und Vermännlichung in Buddenbrooks
- 6.2.1.1 Auflösung der Männlichkeit
- 6.2.1.2 Aufstieg der Weiblichkeit?
- 6.2.1.3 Tony als Ausnahme: Zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit
- 6.2.2 Feminisierung und Vermännlichung in Hongloumeng
- 6.2.2.1 Mann und Frau statt Mann vs. Frau
- 6.2.2.2 Frauen nur als Opfer der patriarchalischen Ordnung?
- 6.2.2.3 Melancholie: Über Männlichkeit und Weiblichkeit hinaus
- 6.2.3 Paarbeziehungen und Sexualität in Buddenbrooks
- 6.2.3.1 Der Verzicht auf Liebe
- 6.2.3.2 Die abwesende Sexualität
- 6.2.3.3 Liebe, Sexualität und Tod
- 6.2.4 Paarbeziehungen und Sexualität in Hongloumeng
- 6.2.4.1 Die Neuerfindung der Liebe
- 6.2.4.2 Melancholie: Zwischen Ordnung und Gefühl
- 6.2.4.3 Hinwendung zum Alltag
- 6.2.4.4 Der Verfall der Aura des Eros
- 6.2.4.5 Geschlecht, Sexualität und Liebe
- 6.2.4.6 Hanno vs. Baoyu
- 6.3 Zeit und Ort
- 6.3.1 Zwischen Anderswann und Anderswo in Buddenbrooks
- 6.3.1.1 Der alte Johann: Desinteresse an der Vergangenheit
- 6.3.1.2 Johann: Gewissheit über die Vergangenheit
- 6.3.1.3 Thomas: Erstarrung in der Gegenwart
- 6.3.1.4 Hanno: Unterm Rad der Zeit
- 6.3.1.5 Die Herrschaft der Zeit
- 6.3.1.6 Die Verräumlichung der Zeit
- 6.3.1.7 Melancholie: Zwischen Anderswann und Anderswo
- 6.3.2 Zwischen Anderswann und Anderswo in Hongloumeng
- 6.3.2.1 Das „Bewusstsein von Nöten“
- 6.3.2.2 Die Zeitwahrnehmung als Ausdruck innerer Gefühle
- 6.3.2.3 Nirgendwo im Daguan Yuan
- 6.3.2.4 Melancholie: Zwischen Anderswo und Anderswann
- 6.3.2.5 Baoyu im Schnee vs. Thomas am Meer
- 6.4 Melancholie und Heiterkeit
- 6.4.1 Buddenbrooks: Ironie als Erheiterung
- 6.4.2 Hongloumeng: Humor als Erheiterung
- 6.4.3 Zur Erheiterung: Humor vs. Ironie
- 7.Schlussbetrachtungen
- 7.1 Der Melancholische Erkennende vs. der Melancholische Erfahrende
- 7.2 Melancholie als Motiv und Analysekategorie
- Literaturverzeichnis
- Register
- Personenregister
- Sachregister
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit der literarischen Darstellung von Melancholie in verschiedenen kulturellen Kontexten. Das Thema Melancholie hat mich schon seit dem Masterstudium fasziniert. Die Verbindung zweier bedeutender Werke, Buddenbrooks: Verfall einer Familie von Thomas Mann und Hongloumeng von Cao Xueqin, erschien mir als besonders fruchtbar, um die unterschiedlichen und doch miteinander verwobenen Facetten dieses komplexen Phänomens zu beleuchten.
In den vergangenen drei Jahren habe ich viel Zeit damit verbracht, Texte zu lesen, Theorien zu studieren und Konzepte zu entwickeln, die es mir ermöglichten, Melancholie in ihrer ganzen Breite und Tiefe zu erfassen. Diese Arbeit spiegelt meine Bemühungen wider, eine Brücke zwischen den literarischen Traditionen Deutschlands und Chinas zu schlagen und neue Perspektiven für die vergleichende Literaturwissenschaft zu eröffnen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die mich auf diesem Weg unterstützt haben. Zunächst habe ich Prof. Dr. Weiping Huang und Prof. Dr. Wolfgang Kubin zu danken, die mich bei der Anfertigung dieser Arbeit mit fachlichen Hinweisen betreut haben.
Ein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin während des Masterstudiums, Frau Dr. Annett Jubara. Sie hat mich auf das Thema Melancholie gebracht. Ihre aufschlussreichen Unterrichtsstunden bleiben bis heute bei mir präsent.
Auch allen Freunden möchte ich danken, die mir durch ihre Freundschaft und Unterstützung geholfen haben.
Abschließend danke ich meiner Mutter, die stets an mich geglaubt hat. Ihr ist dieses Buch gewidmet.
1. Einleitung
Seit über zwei Jahrtausenden wird über Melancholie diskutiert. Die bisherigen Forschungsergebnisse zur Melancholie stellen schon eine große Breite an Auffassungen darüber dar, was unter Melancholie zu verstehen ist. Was aber ist an Melancholie so besonders? „Warum sind alle hervorragenden Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, offenbar Melancholiker gewesen?“1 Diese schon lange Aristoteles zugeschriebene Aussage, die als Grundlage der langen Kulturgeschichte der Melancholie angesehen werden kann, lässt auch die Komplexität und Ambivalenz der Melancholie erkennen. Über eines sind sich die meisten Forscher, die Melancholie aus ihrer jeweiligen unterschiedlichen Perspektive betrachten, jedoch einig: Melancholie ist nicht mit einer Definition zu fassen und speist sich aus ihrer eigenen Ambiguität.
Im Hinblick auf die Tatsache, dass Melancholie nicht abschließend zu definieren ist, ist das Konzept „Melancholie“ in der heutigen, von Globalisierung geprägten Welt zu einem der wichtigsten Paradigmen geworden, durch das die Interaktion in den Diskursen verschiedener Bereiche, darunter Medizin, Psychoanalyse, Literatur, Kunst und Philosophie, zwischen unterschiedlichen Kulturen untersucht wird. Angesichts der wachsenden deutsch-chinesischen Beziehungen drängen sich in diesem Zusammenhang die Fragen auf, inwieweit sich die moderne Form der Melancholie auf die vormoderne Kultur Chinas übertragen lässt, inwiefern sie sich von traditioneller Traurigkeit unterscheidet und in welcher Weise sie einen neuen Blickwinkel darstellt, unter dem man die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der deutschen und chinesischen Kultur betrachten und analysieren kann.
Die bisherige Diskussion, die vor allem in der deutschen Sinologie stattfand, lieferte zwei Ergebnisse: Erstens wurde Melancholie erst seit den 1920er-Jahren Bestandteil literarischen Schaffens, während man in der chinesischen Literatur der vormodernen Zeit vorwiegend das Phänomen Trauer beobachten kann.2 Zweitens gibt es in der vormodernen chinesischen Literaturgeschichte eine Ausnahme, nämlich den Roman Hongloumeng 红楼梦 (1792) von Cao Xueqin. Dieser sollte nach Wolfgang Kubin unter dem Zeichen der Melancholie neu betrachtet werden.3 Laut Marián Gálik gilt Cao Xueqin als der erste, der eine vielschichtige und detailliert beschriebene melancholische Figur in der chinesischen Literatur schuf.4 Allerdings wird bis dato auf das Thema Melancholie in der chinesischen Kultur- bzw. Literaturgeschichte nicht näher eingegangen: Wie äußert sich die Melancholie in Hongloumeng konkret? Wie lässt sich die Melancholie in Hongloumeng von der traditionellen Traurigkeit unterscheiden? Aus welchem Grund werden die Welt und das menschliche Leben aus einer melancholischen Perspektive betrachtet? Ist die Melancholie bei Cao nur ein Einzelfall? Es ist auch zu fragen, was es überhaupt bedeutet, zu Caos Zeit melancholisch zu sein. Kurzum, es fehlt in der Hongloumeng-Forschung bis jetzt eine ausführliche Analyse und Interpretation in Bezug auf das Motiv der Melancholie.
Um die Unterschiede und Berührungspunkte zwischen dem chinesischen Melancholie-Konzept und dem deutschen herauszuarbeiten, eignet sich meiner Meinung nach keine Darstellung von Melancholie besser als die des Romans Buddenbrooks: Verfall einer Familie (1901) von Thomas Mann, der in China als „der deutsche Hongloumeng“5 bezeichnet wird, während der Letztere in Deutschland „die chinesischen Buddenbrooks“6 heißt. Bislang ist noch kein umfassender Vergleich zwischen beiden Romanen vorhanden, obwohl in der chinesischen Germanistik immer wieder angesprochen wird, dass sich die beiden in vielerlei Hinsicht ähneln.7 Untersuchungen zum Aspekt der Melancholie, die gleichzeitig beide Werke behandeln, sind bisher nicht vorhanden. Ferner fehlt in der deutschen Sinologie bislang eine umfassende Bearbeitung der Melancholie in Hongloumeng. Der Überblick über die Forschungsfelder der jeweiligen Romane befindet sich im Kapitel „Forschungsstand“. Mit diesem Ansatz versuche ich, diese Lücke zu schließen, indem die zwei gewichtigen literarischen Werke aus Deutschland und China in Verbindung gesetzt werden.
Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei Ziele: Über die Literatur soll ein Einblick in die Darstellung der Melancholie und den Umgang der spezifischen Kultur damit gewonnen werden. Zugleich wird ein Zwischenraum geschaffen, in dem eine interkulturelle Verbindung zwischen der deutschen und chinesischen Kultur stattfindet, indem Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen beiden Kulturen zuerst strategisch herausgearbeitet und dann miteinander verglichen werden. Anders gesagt: Es wird nicht der Frage nachgegangen, was die Melancholie in Hongloumeng oder Buddenbrooks ist, sondern den Fragen, wer melancholisch ist, worüber, wie die sozialen Umstände sind usw. Somit wird das Phänomen Melancholie von einem Untersuchungsgegenstand zu einer neuen Analysekategorie. Das heißt, die verschiedenen Komponenten von Melancholie in Hongloumeng (1792) von Cao Xueqin und die in Buddenbrooks: Verfall einer Familie (1901) von Thomas Mann werden zuerst deutlich gemacht, dann wieder in ihre jeweiligen kulturellen, geschichtlichen und literarischen Kontexte eingebettet und vergleichend untersucht. Dabei wird auch die darin enthaltene sozial-politische Kritik an den jeweiligen Gesellschaften berücksichtigt. Es geht nicht nur um das Melancholie-Phänomen anhand der literarischen Thematisierung des Verfalls und die damit einhergehenden soziologischen und gesellschaftlich-politischen Verflechtungen, sondern auch um die kulturspezifischen Dimensionen im Denken und Verhalten der beiden Länder. Mit der vorliegenden Arbeit wird versucht, sowohl eine neue Interpretation der zwei komplex strukturierten kanonischen Texte als auch eine interkulturelle Verbindung zwischen der deutschen und chinesischen Wissenschaft zu leisten.
Um diese Ziele zu erreichen, werden als Erstes die klassische Melancholie-Forschung in der Philosophie und Literatur bis hin zu den neueren Betrachtungen in der Soziologie und Kulturwissenschaft zusammengefügt und dann als theoretische Grundlage für die spätere kulturvergleichende Analyse herangezogen. Auf dieser Basis beschäftige ich mich mit den Themenkomplexen, in denen sich die Melancholie äußert. Hinzu gehört das Thema Krankheit und Tod. Es ist bemerkenswert, dass in Hongloumeng niemand geboren wird. Im Gegenteil – die Figuren sterben nacheinander nur. In Buddenbrooks begleitet den Verfall der Familie auch der sich verschlechternde körperliche Zustand der Familienmitglieder. Ein zweiter Themenkomplex ist die Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit sowie die damit verbundenen Phänomenen wie Liebe und Sexualität. Von Sexualität ist in Buddenbrooks kaum die Rede. In Hongloumeng sind zwar mehrere Szenen zu finden, aber sie beziehen sich aus meiner Sichtweise nicht auf die Liebe, während unter den Liebespaaren eigentlich nur unerfüllte Sexualität herrscht. Drittens geht es um die Zeit und den Ort in der Darstellung der Melancholie. Es kommt in beiden Romanen vor, dass die Melancholiker beim Umgang mit dem Jetzt und Hier Probleme haben. Die Dichotomie von Melancholie und Heiterkeit wird als viertes Thema behandelt. Die Melancholie bedarf auch des Hintergrundes der Heiterkeit. Ohne diesen polaren Wechselbezug versänke die Melancholie in die Abgründe. Damit gemeint sind beispielsweise die komischen Szenen und Figuren in den Romanen. Methodisch wird dies erreicht durch die Auswahl relevanter Textpassagen aus beiden Romanen und deren Interpretation.
Die vorliegende Arbeit setzt sich aus vier Teilen zusammen. Der erste Teil stellt den Forschungsstand und eine theoretische Einführung dar. Der Komplex der Melancholie in der Moderne bildet den Schwerpunkt, der als Grundlage für die folgende vergleichende Analyse dient. Ferner wird ein Blick auf die Rezeption der zwei literarischen Werke in Bezug auf das Motiv der Melancholie geworfen. Der zweite Teil liefert eine Biografie von Cao Xueqin und Thomas Mann. Außerdem gibt dieser Teil einen Überblick über den Hintergrund der beiden Romane. Der dritte Teil widmet sich den literarischen Analysen der Themenbereiche der Melancholie. Im Schlussteil erfolgt eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewählten Werke aufgrund des weit zurückliegenden Erscheinungsdatums intensiv erforscht worden sind; insbesondere der Roman Hongloumeng, dessen zahlreiche Forschungsarbeiten zur Entstehung eines eigenen Wissenschaftszweiges in China führten. Mir ist die Überfülle der Sekundärliteratur wohl bewusst. Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, eine neue Perspektive anzubieten, aus der die zwei Klassiker betrachtet werden können.
In dieser Arbeit wird hauptsächlich vereinfachtes Chinesisch verwendet, es sei denn, die Originaltexte bestimmter Zitate sind in traditionellem Chinesisch. Die deutschen Übersetzungen von Textpassagen aus dem Roman Hongloumeng stammen ausschließlich von mir. So auch die Übersetzungen anderer chinesischer Zitate, soweit es nicht anders vermerkt ist.
1 Klibansky, R., Panofsky, E., Saxl, F., Buschendorf, C.: Saturn und Melancholie: Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. S. 59.
2 Huang, Weiping: Melancholie als Geste und Offenbarung: zum Erzählwerk Zhang Ailings. Bern: Peter Lang, 2001. S. 99.
3 Vgl. Kubin, Wolfgang: „Von der Traurigkeit eines Chinesenmenschen. Versuch einer Grundlegung“. In: Elberfeld, Rolf (Hrsg.): Komparative Philosophie: Begegnungen zwischen östlichen und westlichen Denkwegen. München: Fink, 1998. S. 159–170. Hierzu: S. 167.
4 Vgl. Gálik, Marián: „Melancholie und Melancholiker“. In: Kubin, Wolfgang (Hrsg.): Hongloumeng: Studien zum „Traum der roten Kammer“. Bern: Peter Lang, 1999. S. 194.
5 Yan, Baoyu 严宝瑜: „Buddenbrooks – Ein deutscher Hong lou meng?“. In: Neohelicon. 18.2 (1991). S. 273–293.
6 Debon, Günther: „Thomas Mann und China“. In: Thomas Mann Jahrbuch. 3 (1990). S. 149–174.
7 Vgl. dazu exemplarisch Huang, Liaoyu 黄燎宇: „Jinhua de wange yu songge – ping budengboluoke yijia 进化的挽歌与颂歌——评《布登勃洛克一家》“. In: Waiguo wenxue 外国文学. 2 (1997). S. 63–69.
2. Forschungsstand
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Roman Hongloumeng in China kann auf eine Geschichte von mehr als 200 Jahren zurückblicken. Es bestehen mehrere Forschungsrichtungen. Skizziert wird das gesamte Forschungsfeld beispielsweise in der Abhandlung über den Übergang von den alten Schulen zu den bedeutenden neuen Strömungen in der Hongloumeng-Forschung von Zhao Jianzhong 赵建忠.8 Genannt werden an dieser Stelle drei Schulen daraus als Beispiel: Die „Bewerter“ (Pingdian Pai 评点派), die „Entschlüssler“ (Suoyin Pai 索隐派) und die Schule der philologischen Untersuchung (Kaozheng Pai 考证派). Die erste macht wertende Anmerkungen zu bestimmten Textstellen der Fassung in 120 Kapiteln. Die zweite liest den Roman nicht textimmanent, sondern betrachtet ihn als Anspielung auf historische Gegebenheiten. Die dritte beschäftigt sich mit der autobiographischen Prägung des Romans sowie mit dessen verschiedenen Ausgaben. Des Weiteren wird Hongloumeng zunehmend aus literaturwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Sicht erforscht, z. B. hinsichtlich Schreib- und Erzähltechniken9 sowie bestimmter literarischer Motive.10
Trotz der Bedeutsamkeit des Romans für die chinesische Literatur sind wissenschaftliche Arbeiten zu Hongloumeng11 in der deutschen Sinologie unterrepräsentiert. Unter den bis dato verfassten Forschungsarbeiten sind einige Dissertationen besonders nennenswert. Eine davon ist In der Sackgasse oder auf dem Weg zu einem neuen Paradigma? Die Erforschung des Romans „Der Traum der roten Kammer“ (Rotologie) im 21. Jahrhundert12 von Cao Juan, in der sie sich schwerpunktmäßig mit der Rezeptionsgeschichte der Hongloumeng-Forschung im China des 21. Jahrhunderts auseinandersetzt und damit einen aktuellen Einblick in das Forschungsgebiet bietet. Ferner behandeln die Dissertationen Die deutschen Übersetzungen des „Hongloumeng“13 von Yao Junling und „Der Traum der roten Kammer“: Die erzählerische Komplexität eines chinesischen Meisterwerks14 von Wei Ling diesen chinesischen Romanklassiker. Die Habilitationsschrift „Das Lyrische und das Prosaische im Roman Hongloumeng“15 von Huang Weiping befindet sich in Vorbereitung zum Druck. Es gibt noch einen komparatistischen Versuch von Yao Tong mit ihrem Werk Die Vielfältigkeit der Literatur: Ein Vergleich zwischen den „Wahlverwandtschaften“ von Johann Wolfgang von Goethe und dem klassischen chinesischen Roman „Der Traum der roten Kammer“ von Cao Xueqin und Gao E.16 Zusätzlich zu diesen Werken gibt es eine Reihe von Artikeln oder Kapiteln über Hongloumeng, die sich mit Übersetzungskritik,17 Entstehungsgeschichte und Autorenschaft,18 Literaturanalysen in Bezug auf Motive wie Traum19 sowie dem Verhältnis zwischen Krankheit und Schönheit20 befassen.
Der Roman Buddenbrooks hat in Deutschland seit Langem eine Fülle von Interpretationen hervorgerufen. Einige Themen wurden inzwischen abgearbeitet und verhandelt. Das gilt z. B. für die Frage der literarischen Einflüsse auf Buddenbrooks, ebenso wie für das Verhältnis des Autors zu seinen Rollenbildern und die Problematik der Dekadenz. Außerdem haben die Germanistik in Deutschland Debatten über die Bürger- und Künstlerproblematik, über den Einfluss von Nietzsche, Schopenhauer und Richard Wagner und über Manns Vorliebe für das Kranke bzw. das Krankhafte lange beschäftigt. Neuerdings wird versucht, Mann in kulturwissenschaftliche oder andere jüngere, namentlich dem Poststrukturalismus oder der Postmoderne verpflichtete Forschungsnetze einzubinden. Eine fundierte wissenschaftliche Erforschung der Rezeption des Romans Buddenbrooks bietet das von Nicole Mattern und Stefan Neuhaus herausgegebene Werk Buddenbrooks-Handbuch,21 wobei eine Reihe von alten und aktuellen Veröffentlichungen zu den oben genannten Forschungsrichtungen vorgestellt und deren thematische Schwerpunktsetzungen besprochen werden.
Ähnlich wie es der Hongloumeng-Forschung in Deutschland ergeht, wird Buddenbrooks in der chinesischen Germanistik nur wenig erforscht. Die Forschungsarbeiten dazu sind hauptsächlich in Form von einzelnen Aufsätzen und Masterarbeiten zu finden, die sich mit bestimmten literarischen Motiven wie Krankheit22 oder Religion23 befassen.
Über den Vergleich zwischen Hongloumeng und Buddenbrooks sind keine Dissertationen oder Bücher, sondern nur vereinzelte Artikel vorhanden. Yan Baoyu unternimmt mit dem Beitrag Buddenbrooks – Ein deutscher Hongloumeng?24 einen komparatistischen Versuch an diesen zwei zeitlich und kulturräumlich verschiedenen Romanen. Sie werden unter den Aspekten des Motivs Verfall, der widergespiegelten Weltanschauungen, der künstlerischen Gestaltungsweise usw. vergleichend betrachtet. Darüber hinaus gibt es noch einen Beitrag von Cecily Cai mit dem Titel The Fall of a Family,25 der sich im Lichte des Begriffs der Tragödie bei Aristoteles auf das Thema Familienverfall konzentriert und zu dem Schluss kommt, dass jeder Roman auf seine Art und Weise Spuren einer aristotelischen Tragödie trägt, indem er die Katastrophe durch eine ausführliche Vorahnung entfaltet, die in die gesamte Handlung eingepflanzt ist. Bis dato gibt es noch keinen Vergleich unter dem Aspekt des Motivs Melancholie. Jedoch sind einige Studien zu finden, in denen das melancholische Thema in jeweils einem der beiden Romane behandelt wird.
Die Diskussionen über Melancholie in der chinesischen Literatur bzw. in Hongloumeng wurden vor allem von Wolfgang Kubin geführt. In seiner Forschung zur Thematik der Melancholie in der chinesischen Literatur betont Kubin die enge Verbindung zwischen Modernität und Melancholie. Die Schwarzgalligkeit im modernen westlichen Kontext setzt die Subjektivität und Individualität auf der Grundlage der Selbstreflexion voraus und vermittelt das Dilemma der Menschen, die erkennen, dass das von der entgötterten Welt versprochene Glück nicht in Erfüllung gehen wird. Mit diesem Blick sind die möglichen Momente der Melancholie in der vormodernen chinesischen Literatur in hohem Maße interpretationsabhängig, nicht zuletzt aufgrund der Begriffslücke in der chinesischen Kultur.26 Hinsichtlich des begrifflichen Problems behandelt Kubin beispielsweise in seinem Beitrag Von der Traurigkeit eines Chinesenmenschen. Versuch einer Grundlegung27 die Begriffe you 忧, chou 愁 und youhuan 忧患 im alten China und vergleicht diese mit dem Konzept Melancholie in Europa.
Das Konzept der Melancholie lässt sich dagegen leichter in Einklang mit der chinesischen Literatur nach der Bewegung des vierten Mai im Jahr 1919 bringen. Einerseits war diese stark vom Westen beeinflusst, wobei z. B. die westliche Wissenschaft und die damit verbundenen linearen Zeitvorstellung übernommen wurden. Andererseits entstand sie in China im 20. Jahrhundert, wo laut Kubin die Totalität wegen des Untergangs des Kaiserreichs und des klassischen Bildungskanons verloren ging.28
Nennenswert ist an dieser Stelle auch die Dissertation Melancholie als Geste und Offenbarung: Zum Erzählwerk Zhang Ailings von Huang Weiping. Sich auf die Werke von Zhang Ailing konzentrierend, zeigt Huang uns, wie sich Trauer und Melancholie in der modernen chinesischen Literatur äußern. Ferner werden bei ihrer Interpretation die Hindernisse für die Entstehung und Entwicklung der Melancholie als individuelle Gefühlswahrnehmung in der chinesischen Kultur auf die über Jahrtausende geschulte kollektive Verhaltensweise und das Einordnen des Individuums in einen kosmischen ewigen Kreislauf zurückgeführt.29
Der Tagungsband Hongloumeng: Studien zum „Traum der roten Kammer“,30 dessen Herausgeber auch Wolfgang Kubin ist, beinhaltet einige Artikel von Literaturwissenschaftlern aus verschiedenen Ländern zum Motiv der Melancholie. Bei deren Analyse des Romans Hongloumeng gehen sie von Narratologie, Sprache und Stil, kulturgeschichtlichen Substraten und Rezeptionsgeschichte aus. Darunter scheint der Beitrag von Marián Gálik, Melancholie und Melancholiker,31 vornehmlich von Relevanz zu sein, wobei er mehrere Figuren als Melancholiker identifiziert.
Erwähnt werden soll hier zudem der von Wolfang Kubin herausgegebene Band Symbols of Anguish: In Search of Melancholy in China,32 der auf eine Tagung zurückgeht, bei der mehrere deutsche Sinologen und chinesische Germanisten über die Melancholie in China berichteten. Als Beispiel ist Wong Kamings Beitrag The Allure of Melancholy: The Anxiety of Allusion in Hongloumeng33 zu nennen. Dabei befasst Wong sich mit den Anspielungen auf das tragische Ende des Romans, indem er die verschiedenen Theaterstücke analysiert, die in der Handlung während der festlichen Veranstaltungen aufgeführt wurden.
Im Hinblick auf die Melancholie in den Werken von Thomas Mann ist vor allem die Dissertation Die Dinge sehen, wie sie sind: Melancholie im Werk Thomas Manns34 von Ulrike Prechtl-Fröhlich bemerkenswert. Sie beschäftigt sich intensiv mit dem Phänomen Melancholie im Erzählwerk Thomas Manns. Untersucht wird von ihr auch Buddenbrooks. Wissenschaftliche Aufsätze, die das Thema der Melancholie bei Thomas Mann zumindest anschneiden und sich hier anführen lassen, sind z. B. „… Sorgfältig gekleidete Herren mit sinnenden blauen Augen“ und andere Melancholiker im Werk Thomas Manns35 von Jürgen Eder sowie Henriette Herwigs Der melancholische Jüngling in Hermann Hesses „Peter Camenzind“ und „Unterm Rad“ und Thomas Manns „Buddenbrooks“ und „Tonio Kröger“.36 Die bisherigen Forschungsarbeiten über die Darstellung der Melancholie bei Thomas Mann weisen meines Erachtens folgende Merkmale auf. Zum einen lässt sich Manns Auffassung von Melancholie auf die Philosophie von Schopenhauer und Nietzsche oder Freuds Psychoanalyse zurückführen. Oft wird Thomas Mann selbst als Melancholiker interpretiert. Zum anderen wird die Aufmerksamkeit jedoch ausschließlich auf einzelne Figuren wie Hanno, Kai oder Hannos Vater Thomas gelenkt, während die weiblichen Figuren im Vergleich mit den männlichen oft nur Gegenstand flüchtiger Betrachtungen sind. Auch wird den Nebenrollen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was es schwer macht, einen hinreichend vollständigen Kontext für das Verständnis der Melancholie in den jeweiligen Romanen zu erhalten. Dies versuche ich durch die kulturwissenschaftliche Ausrichtung meiner Untersuchung und den starken Einbezug des Diskurses über Melancholie in verschiedenen Forschungsgebieten zu bewältigen.
Details
- Pages
- 294
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631925553
- ISBN (ePUB)
- 9783631925560
- ISBN (Hardcover)
- 9783631925546
- DOI
- 10.3726/b22252
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Buddenbrooks Hong lou meng Cao Xueqin Thomas Mann Deutschland China Interdisziplinäre Forschung die deutsche Literatur die chinesische Literatur Vergleichende Literaturwissenschaft Komparatistik Der Traum der roten Kammer Melancholie
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 294 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG