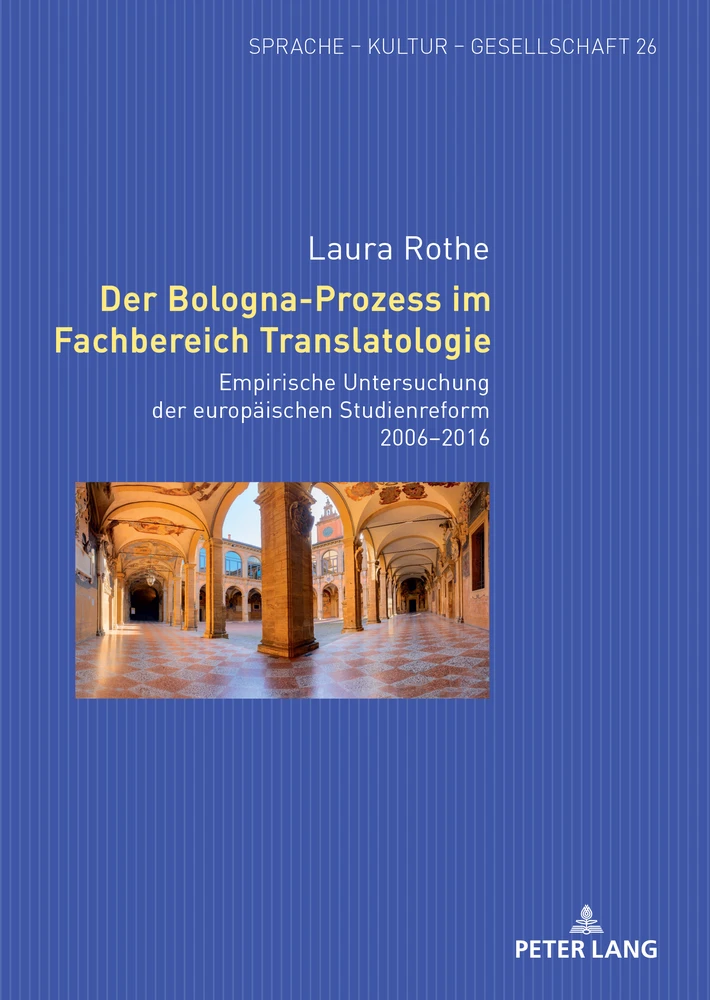Der Bologna-Prozess im Fachbereich Translatologie
Empirische Untersuchung der europäischen Studienreform 2006–2016
Summary
Staaten werden mittels dieser Reform besser koordinierbar.
In diesem Band wird die Reformsituation bis zum Jahr 2016 als Zwischenergebnis des Bologna-Prozesses speziell im Fachbereich der Translation eingeschätzt.
Die Studie beinhaltet einen hochschulhistorischen und bildungspolitischen Teil sowie eine empirische Untersuchung. Dabei werden sowohl der Bologna-Prozess als auch nationale Umsetzungen untersucht. Auf dieser Basis werden Hypothesen über das Fortschreiten des Reformprozesses aufgestellt. Im empirischen Teil werden eine Korpusstudie sowie eine Interviewstudie durchgeführt.
Der Vergleich der beiden Studien führt zu Schlussfolgerungen, auf deren Basis die Hypothesen über das Fortschreiten und Gelingen des Bologna-Reformprozesses geprüft und Vorschläge zu einer weiterführenden Untersuchung eingebracht werden.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1 Hintergrund
- 1.2 Forschungsziel
- 1.3 Vorgehensweise und Gliederung
- 2 Der Bologna-Prozess – Fluch oder Segen?
- 2.1 Historische Darstellung der Hochschulentwicklung
- 2.1.1 Gesamteuropäische Hochschulentwicklung
- 2.1.2 Die neuhumanistische Bildungsidee in Deutschland
- 2.1.3 Die deutschen Hochschulen bis zur Wiedervereinigung
- 2.1.4 Aktuelle Entwicklungen im 21. Jahrhundert
- 2.1.5 Zusammenfassung
- 2.2 Reformsituation und Problemdarstellung
- 2.2.1 Hochschulstudium und Berufsausbildung im Widerstreit
- 2.2.2 Exzellenz in der Forschung, Masse in der Lehre?
- 2.2.3 Wechselwirkungen von Wissenschaft und Gesellschaft
- 2.2.4 Konfliktpunkte und Umdeutungen zwischen Geisteswissenschaften und Wirtschaft
- 2.2.5 Zwischenfazit zum Bologna-Prozess
- 2.3 Begriffsklärung, Konzepte und Definitionen der Hochschulreform
- 2.3.1 Die Bologna-Erklärung
- 2.3.2 Die Folgekonferenzen
- 2.3.3 Strukturelle und Übergeordnete Ziele und deren Umsetzung
- 2.3.4 Zusammenfassung und Zwischenfazit
- 2.4 Der Bolognaprozess in weiteren EU-Ländern
- 2.4.1 Bologna im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland
- 2.4.2 Bologna in Frankreich
- 2.4.3 Bologna in Italien
- 2.4.4 Zusammenfassung zur Reform in den Teilnehmerstaaten
- 2.5 Historische und politische Zusammenhänge
- 2.5.1 Politische Hintergründe
- 2.5.2 Wettbewerbsfähigkeit – ein passendes Bildungsziel?
- 2.5.3 Employability als Kriterium der Abschlussqualität
- 2.5.4 Hinweise auf ein mögliches Scheitern der Bildungsreform
- 2.5.5 Konkrete Problemfälle und Gegenreformen
- 2.5.6 Zwischenfazit zum politischen Hintergrund
- 2.6 Betrachtungen zum Bologna-Prozess im Übersetzungsbereich
- 2.6.1 Rollenbilder der Studierenden bei der Bildungsreform
- 2.6.2 Translatologische Forschungsschwerpunkte im Studium
- 2.6.3 Akademische Berufsausbildung – Fokus auf Praxis und marktrelevante Aspekte
- 2.6.4 Zwischenfazit: Transfer zwischen Theorie und Praxis
- 2.7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur Historie
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Theoretische Grundlagen der empirischen Untersuchung
- 3.1.1 Die Verbindung zwischen Qualitativer und Quantitativer Forschung
- 3.1.2 Didaktische Aspekte der vorliegenden Studie
- 3.1.3 Lerntheoretische Aspekte der vorliegenden Studie
- 3.1.4 Vergleich mit der Studie von Hagemann (2005)
- 3.1.5 Zusammenfassung der theoretischen Forschungsgrundlagen
- 3.2 Forschungskonzeption
- 3.2.1 Forschungsziel und Operationalisierung
- 3.2.2 Hypothesenbildung
- 3.2.3 Planung und Vorbereitung der Erhebung
- 3.2.4 Zusammenfassung der Forschungskonzeption
- 3.3 Umsetzung des Forschungsvorhabens
- 3.3.1 Korpusuntersuchung
- 3.3.2 Durchführung der Befragung
- 3.4 Zwischenfazit zum ersten Teil der empirischen Untersuchung
- 4 Ergebnisanalyse und Auswertung der Studie
- 4.1 Erläuterung der Datenauswertung
- 4.1.1 Datenerfassung und Fehlerkontrolle
- 4.1.2 Darstellung – Datenanalyse als Inhaltsanalyse
- 4.2 Datenanalyse
- 4.2.1 Auswertung nach Themenschwerpunkten Bologna-Prozess
- 4.2.2 Auswertung nach Themenschwerpunkten der Translatologie
- 4.2.3 Zusammenfassung der Analyseergebnisse
- 5 Synthese empirischer Ergebnisse und theoretischer Betrachtungen
- 5.1 Rückbezug auf die aufgestellten Hypothesen
- 5.1.1 Auswertung der Hypothesen
- 5.1.2 Zusammenfassung der Hypothesenüberprüfung
- 5.2 Vorschläge für eine weiterführende Forschungskonzeption
- 6 Schlussbetrachtung
- Anhang
- Interviewleitfaden Version I– Pretest
- Interviewleitfaden Version 2– Gesamterhebung Translatolog:innen
- 7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hintergrund
49 Staaten bemühen sich seit inzwischen 25 Jahren um die Realisierung der Ziele der Bologna-Erklärung. Damit soll ein europäischer Hochschulraum geschaffen werden (HRK 2008, S. 7). Die Bildungssysteme von 27 EU-Staaten und 22 Nicht-EU-Staaten sollen mittels dieser Strukturreform besser koordinierbar werden. Nationale Universitäten haben bisher zur Bildung nationaler Identität große Beiträge geleistet (Hörner 2014, S. 7 f.). Nun sollen europäische Universitäten bestenfalls die Bildung von EU-Identität befördern. Ein erster Überblick über die Sekundärliteratur zeigte: Viele Autor:innen äußerten sich teilweise extrem kritisch zur Reform, auf jeden Fall aber skeptisch (vgl. Bollenbeck und Wende 2007a). Einige wenige untersuchten sie wirklich objektiv und zogen durchaus positive Bilanzen (vgl. Schwarz-Hahn und Rehburg 2004).
Dies hat verschiedene Gründe. Zuvorderst wirkt sich der Reformprozess vor allem auf die Studiengangstrukturen, aber auch auf die Studiengangsinhalte, die Organisationsabläufe der Hochschulen (HS), die Verwaltungsprozesse und nicht zuletzt auf die Entscheidungen der Studierenden aus (HRK 2008, S. 7). Diese Reform ist die größte seit Jahrzehnten, auch wenn mit ihrer Vorläuferin, der Magna Charta Universitatum bereits der Grundstein gelegt wurde (Banscherus 2007, S. 76). Das Entstehen von Kontroversen ist daher in diesem komplexen Prozess nicht überraschend.
Mit Hilfe des Bologna-Prozesses (BP) sollte sich die Studiendauer verkürzen, es sollte weniger Studienabbrecher:innen geben, die Absolventen:innen1 sollten für den Arbeitsmarkt besser qualifiziert werden und die Studiengänge und Abschlüsse sollten international kompatibel werden. Die duale Struktur sieht eine Gliederung in zwei Abschlüsse vor: Bachelor und Master (HRK 2008, S. 11). In der vorliegenden Arbeit findet eine Auseinandersetzung mit der praktischen Umsetzung dieser Strukturen im übersetzungswissenschaftlichen2 Bereich und deren Auswirkung auf die Lehrinhalte im Zuge des Bologna-Prozesses statt. Das Studiengebiet der Translatologie wird mit der brisanten Reformbewegung der Hochschulen in Verbindung gebracht. Die Translatologie ist eine der wichtigsten Grundlagen im Rahmen der Übersetzer:innenausbildung und unerlässlich für das spätere professionelle Arbeiten. Unter den Studierenden stellt sie eher einen umstrittenen Bereich dar. Es werden immer wieder Meinungen laut, die ihre Existenzberechtigung in Zweifel ziehen und die Übersetzerbildung eher an praktisch orientierten Fachhochschulen sehen. Dieses Thema wird im Weiteren ebenfalls aufgegriffen.
1.2 Forschungsziel
Die Reformsituation bis zum Jahr 2016 soll als Zwischenergebnis des bis dahin durchlaufenen Bologna-Prozesses eingeschätzt werden. Dies kann im Folgenden zur Bewertung des Internationalisierungsprozesses dienen. Der erste Abschnitt dazu stellt eine historische Untersuchung auf Makroebene dar. Anhand der genaueren Untersuchung der Lehrveranstaltungen und Curricula im Bereich Translatologie wurde anschließend mittels einer Korpusstudie und einer vertiefenden sozialwissenschaftlichen Interviewstudie festgestellt, ob und wie die Vergleichbarkeit der Studiengänge an den einzelnen Universitäten beurteilt werden kann. Diese empirische Untersuchung wurde auf Mikroebene durchgeführt. In diesem Zuge wird die Struktur im Vergleich zur inhaltlichen Ausgestaltung betrachtet. Die Wahrnehmung der Studierenden wird dabei für die Ermittlung des Reformstandes einbezogen.
1.3 Vorgehensweise und Gliederung
Die vorliegende Arbeit ist in einen theoretischen Teil, auf Basis der Textarbeit, und einen empirischen Teil gegliedert. Im theoretischen Teil werden sowohl der Bologna-Prozess als solches sowie einzelne nationale Ausprägungen untersucht. Auf dieser Basis werden Hypothesen über das Fortschreiten des Reformprozesses aufgestellt. Im empirischen Teil werden eine Korpusstudie sowie eine qualitative Erhebung in Form einer Interviewstudie durchgeführt. Der Vergleich der theoretischen und der empirischen Untersuchungen führt zu Schlussfolgerungen, auf deren Basis die Hypothesen geprüft und Vorschläge zu einer weiterführenden Untersuchung eingebracht werden können. Die Aufteilung der Kapitel wurde wie folgt gestaltet:
Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretische Untersuchung der Bologna-Reformprozesse und deren politisch-wirtschaftliches Spannungsfeld umrissen. Damit wird die Forschung verortet und die Relevanz belegt. Dazu wird unter 2.1.1 die gesamteuropäische Hochschulentwicklung als Ausgangspunkt betrachtet und unter 2.1.2 die neuhumanistische Bildungsidee in Deutschland im Besonderen vertieft. Es folgen die Entwicklungen an den deutschen Hochschulen bis zur Wiedervereinigung unter Punkt 2.1.3 und darauf die aktuellen Hochschulentwicklungen im 21. Jahrhundert unter Punkt 2.1.4.
Im zweiten Unterkapitel wird im Detail auf die Reformlage des Bologna- Prozesses eingegangen. Dabei findet unter 2.2.1 eine Betrachtung des Widerstreits zwischen wissenschaftlicher Orientierung und universitärer Berufsausbildung statt. Im Folgenden wird unter 2.2.2 auf die Problematik von Massenstudium im Gegensatz zu aktuellen Exzellenzbestrebungen eingegangen. Punkt 2.2.3 behandelt die Vergesellschaftung der Wissenschaftsbereiche und im letzten Unterpunkt 2.2.4 wird die heikle Thematik der Einflussnahme von Wirtschaftsakteuren auf Wissenschaft und Hochschulen im Rahmen der Hochschulreform diskutiert.
Im Anschluss werden im dritten Unterkapitel die Bologna-Erklärung selbst (2.3.1) und deren Realisierung im Zuge der Folgekonferenzen (2.3.2) erläutert und schließlich die Ziele der Reformbewegung sowie deren Umsetzung klassifiziert und im Detail unter 2.3.3 dargestellt.
Es folgt eine nationale Vertiefung von drei Teilnehmerstaaten als Ergänzung zur Darstellung der Reformlage in Deutschland, und zwar zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland (2.4.1), zu Frankreich (2.4.2) und zur Situation in Italien (2.4.3). Dies bildet die Verstehensvoraussetzungen für die Untersuchungsergebnisse aus den Ländern, die neben Deutschland am häufigsten von den befragten Proband:innen im Rahmen ihrer Auslandsstudien besucht wurden, oder die deren Herkunftsländer und Heimatuniversitäten darstellten.
Eine Vertiefung zu den historischen und politischen Zusammenhängen, die zur Bologna-Erklärung geführt haben und deren Ausgestaltung bedingen, findet sich im fünften Unterkapitel. Zu diesem Zweck werden zuerst die Idee des Europäischen Hochschulraums in Verbindung mit dem Europäischen Wirtschaftsraum unter Punkt 2.5.1 geschildert. Es folgen Vertiefungen zur Wettbewerbsfähigkeit unter 2.5.2 und zur Beschäftigungsfähigkeit unter 2.5.3. Dabei wird bereits Bezug auf die Situation in den translatologischen Studiengängen genommen.
Details
- Pages
- 250
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631925638
- ISBN (ePUB)
- 9783631925645
- ISBN (Hardcover)
- 9783631925621
- DOI
- 10.3726/b22265
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Hochschulentwicklung Bildungspolitik Sozialwissenschaftliche Forschung Übersetzen Translatologie Europäischer Wirtschaftsraum Europäischer Hochschulraum Bologna-Prozess Hochschulreform
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 250 S., 1 s/w Abb., 2 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG