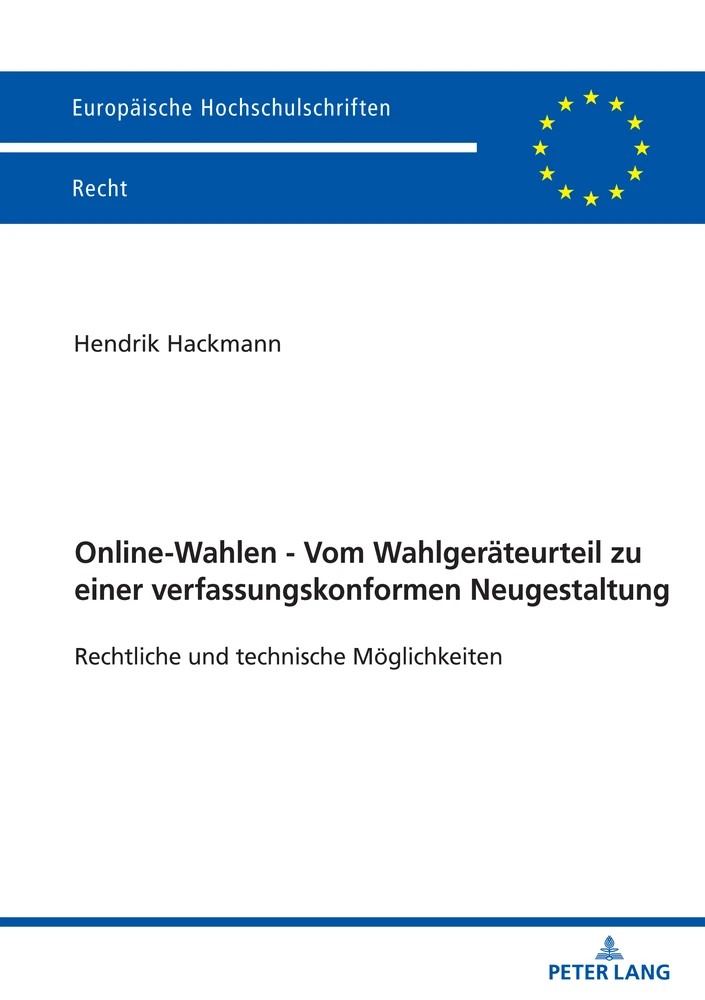Online-Wahlen - Vom Wahlgeräteurteil zu einer verfassungskonformen Neugestaltung
Rechtliche und technische Möglichkeiten
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Glossar
- Abbildungsverzeichnis
- Blockchain – goes public.
- I. Die Einbindung des Bürgers in Sachfragen
- II. Reallabore als Inkubatoren
- 1. Gründe für den Einsatz der Blockchain-Technologie
- 2. Exkurs: Behördenübergreifende Kommunikation
- III. Blockchain-Strategie der Bundesregierung
- B.Blockchain als technologische Basis
- I. Technische Einführung in die Blockchain-Technologie
- 1. Die Prüfsumme
- 2. Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren
- 3. Die Signatur
- 4. Das dezentrale Netzwerk
- 5. Eine Transaktion
- 6. Mining
- II. Fachliche Beurteilung der Blockchain-Technologie
- 1. Unterschiedliche Blockchain-Ansätze
- 2. Anforderungen an die Blockchain-Technologie
- 3. Die Konsensalgorithmen aus fachlicher Sicht
- 4. Forks in Blockchain-Netzwerken
- III. Kritische Bewertung
- C.Wahlen nach deutschem Recht
- I. Die unterschiedlichen Wahlanwendungstypen
- 1. Wahlen zu Volksvertretungen
- 2. Wahlen zu Selbstverwaltungen
- 3. Wahlen zu Sozialversicherungen
- 4. Hochschulwahlen
- 5. Kammerwahlen
- 6. Mitbestimmungswahlen
- 7. Wahlen zu privaten Körperschaften
- 8. Wahlen in Parteien
- II. Verschiedene Wahlformen
- 1. Fernwahlen
- 2. Präsenz- oder Urnenwahl
- 3. Exkurs zum Benfordschen Gesetz
- III. Unterschiedliche Wahlrelevanz
- 1. Obligatorische Online-Wahl
- 2. Fakultative Online-Wahl
- 3. Begrenzt fakultative Online-Wahl
- IV. Die unterschiedlichen Wahlrechtsgrundsätze
- 1. Die Freiheit der Wahl
- 2. Die Allgemeinheit der Wahl
- 3. Die Gleichheit der Wahl
- 4. Die Unmittelbarkeit der Wahl
- 5. Die Geheimheit der Wahl
- 6. Die Öffentlichkeit der Wahl
- 7. Informationelle Selbstbestimmung
- 8. Fernmeldegeheimnis
- 9. Zwingende Gründe zur Einschränkung von Wahlrechtsgrundsätzen
- V. Die Rolle der Parteien
- D.Das Wahlgeräte-Urteil und dessen Anwendbarkeit auf Online-Wahlen
- I. Die Kritik an den verwendeten Wahlgeräten der Firma Nedap
- II. Erfolgreiche Manipulation der eingesetzten Wahlgeräte
- III. Gesellschaftlicher Diskurs zum Einsatz von Wahlcomputern
- IV. Zulassung von Wahlcomputern
- V. Verfassungswidrigkeit der Bundeswahlgeräteverordnung
- VI. Beeinträchtigung von Schutzrechten durch die §§ 13–16 Bundeswahlgeräteverordnung
- VII. Anwendbarkeit des Wahlgeräteurteils auf Online-Wahlen
- E.Online-Wahlen: Rechtliche Möglichkeiten
- I. Online-Wahlen während der Pandemie
- II. Die Grundlage für Online-Wahlen in Deutschland
- III. Rechtliche Bewertung von Online-Wahlen
- F.Online-Wahlen – Soziokulturelle Einordnung
- I. Soziokulturelle Bewertung von Online-Wahlen
- 1. Online-Wahlen als Möglichkeit von mehr direkter Demokratie
- 2. Soziokulturelle Funktion der Wahl
- 3. Entgrenzung und Digitalisierung
- 4. Gemeinsames Wissen als Basis einer Demokratie
- II. Rechtsrahmen für das Modellprojekt Sozialwahlen: Ein Fallbeispiel
- 1. Rechtsrahmen im Sozialgesetzbuch V
- 2. Kritik am Rechtsrahmen für die Sozialwahlen
- 3. Die Online-Wahl-Verordnung sowie die technische Richtlinie (TR03162) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik
- 4. Online-Wahlverfahren
- 5. Kritik an dem Online-Wahlverfahren und der technischen Richtlinie
- a. Clash Attacken
- b. Öffentlichkeitsgrundsatz
- c. Schwachstellen virtueller Hauptversammlungen
- d. Schutzprofil nach Common Criteria
- e. Kritik an der technischen Richtlinie
- G.Technischer Realisierungsvorschlag
- I. Exkurs zu den Mining-Verfahren
- II. Wähler-Chain (WCB)
- III. Exkurs Self-Sovereign-Identity
- IV. Stimmen-Chain (WSB)
- V. Wahllokal-Chain (WLB)
- VI. Selbstüberwachendes Netzwerk
- H.Software-Patentanmeldung
- I. Patentantrag
- 1. Deutscher Patentantrag
- 2. Europäischen Patentantrag
- 3. US-Patentantrag
- II. Patentrechtliche Unterschiede zwischen den USA und der EU/Deutschland
- I.Rechtliche Bewertung des technischen Realisierungsvorschlags
- I. Set the scene: Der Prüfgegenstand
- II. Wiederholung der Ausführungen zum Wahlgeräteurteil
- III. Ausführungen zur Öffentlichkeit der Wahl
- IV. Ausführungen zur Laienkontrolle
- V. Andere verbleibende Probleme bei der Verwendung von Online-Wahlverfahren
- VI. Die rechtliche Basis der Prüfung
- 1. Prüfkriterium 1: Freiheit der Wahl
- 2. Prüfkriterium 2: Allgemeinheit der Wahl
- 3. Prüfkriterium 3: Gleichheit der Wahl
- 4. Prüfkriterium 4: Unmittelbarkeit der Wahl
- 5. Prüfkriterium 5: Geheimheit der Wahl
- 6. Prüfkriterium 6: Informationelle Selbstbestimmung
- 7. Exkurs: Datenschutz
- 8. Prüfkriterium 7: Fernmeldegeheimnis
- J.Ergebnis der Arbeit
- Literaturverzeichnis
A. Blockchain – goes public.
Der deutsche Staat steht in den kommenden Jahrzehnten vor massiven Herausforderungen. Der Bürger erwartet vom Staat eine dienstleistungsorientierte, flexible Verwaltung, die seine Anliegen ernst nimmt und zeitnah bearbeitet, ohne dass er diese in einem komplizierten Verwaltungsverfahren beantragen und hierfür in ein Verwaltungsgebäude einer Stadt oder Gemeinde gehen muss. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass heutzutage viele Vorgänge des täglichen Lebens online stattfinden und abgewickelt werden können, ist es nicht mehr vermittelbar, dass diese Verwaltungsvorgänge weiterhin persönlich beantragt werden müssen.
Hierfür muss die Arbeitsweise in den Verwaltungen stärker, als dies bisher der Fall ist, von einem antragsbezogenen hin zu einem datengetriebenen Ansatz weiterentwickelt werden. Es wird einem „digital denkenden Bürger“ immer schwerer zu vermitteln sein, dass er nach einem Umzug diesen sowohl dem Einwohnermeldeamt als auch dem Straßenverkehrsamt melden, gleichzeitig selbst einen Kindergartenplatz suchen, eine neue Hundemarke und einen Anwohnerparkausweis am neuen Wohnort beantragen und den beteiligten Ämtern gleich mehrfach seine neue Wohnanschrift mitteilen muss.
Derartige Verwaltungsvorgänge wirken bereits heute anachronistisch, finden jedoch täglich tausendfach in deutschen Verwaltungen statt. Darüber hinaus existieren unterschiedliche Möglichkeiten, Verwaltungsverfahren durch künstliche Intelligenzen zu automatisieren, wie dies bereits heute durch den § 35a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)1 zulässig ist, wenn weder ein Ermessens- noch ein Beurteilungsspielraum existiert.
Für die Konzeption neuer, digitaler Verwaltungsprozesse eignet sich insbesondere die Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Mithilfe dieser Technologie gelingt es, Verwaltungsregister zu digitalisieren und so in ihrer herkömmlichen Form zu ersetzen. Register wie das Zentrale Fahrerlaubnisregister (ZFER) des Kraftfahrtbundesamts enthalten beispielsweise die Information, ob ein Bürger das Recht hat, ein Fahrzeug einer bestimmten Art zu einem definierten Zeitpunkt zu führen. Wichtig ist, dass diese Information nur durch Berechtigte verändert werden darf und die Veränderungen an dem Register nachvollzogen werden können.
Details
- Pages
- 168
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631925324
- ISBN (ePUB)
- 9783631925331
- ISBN (Softcover)
- 9783631925232
- DOI
- 10.3726/b22235
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Wahlverfahren Patent eVoting Online-Wahlen Blockchain
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 168 S., 20 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG