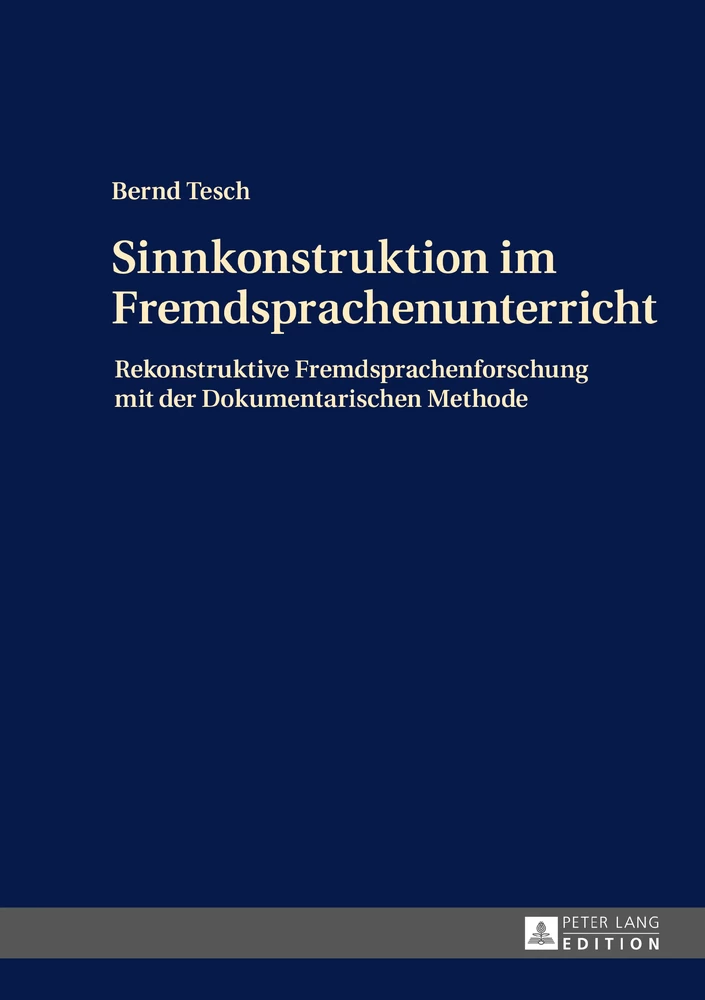Sinnkonstruktion im Fremdsprachenunterricht
Rekonstruktive Fremdsprachenforschung mit der Dokumentarischen Methode
Summary
Der Autor illustriert das Verfahren an konkreten Beispielen aus der ‚Fallwerkstatt‘, so dass das Buch auch als methodisch-methodologisches Lehr- und Arbeitsbuch verwendet werden kann.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Der rekonstruktive Zugang zum Fremdsprachenlehren und -lernen
- 2 Sinnkonstruktion im Fremdsprachenunterricht
- 2.1 Methodologische Grundlagen
- 2.1.1 Methodisch kontrolliertes Fremdverstehen
- 2.1.2 Diskursentwicklung im Fremdsprachenunterricht
- 2.1.3 Die Indexikalität der Verständigung
- 2.1.4 Rahmenorientierungen
- 2.1.5 Typenbildung
- 2.1.6 Lernersprache
- 2.1.7 Lerngruppenmilieus und konjunktive Erfahrungsräume
- 2.1.8 Ein sozial-interaktionales Lehr-Lernmodell des Fremdsprachenunterrichts
- 2.2 Verständigung durch Texte
- 2.2.1 Verständigung durch literarische Texte
- 2.2.2 Verständigung durch Bildtexte
- 2.3 Verständigung über Texte
- 2.3.1 Bild-Text-Aufgabe
- 2.3.2 Aufgabe Personenbeschreibung
- 2.4 Verständigung über erlebten Fremdsprachenunterricht, über das Lehren und über das Lernen von Sprachen
- 3 Arbeitsschritte der Dokumentarischen Methode
- 3.1 Gruppendiskussion und Unterrichtsgespräch
- 3.1.1 Teilnehmende Beobachtung, Audioaufzeichnung und Transkription
- 3.1.2 Formulierende Interpretation
- 3.1.3 Reflektierende Interpretation
- 3.1.4 Fallbeschreibung
- 3.1.5 Typenbildung
- 3.2 Narratives Interview
- 3.2.1 Formale Interviewanalyse
- 3.2.2 Inhaltliche Interviewanalyse
- 3.2.3 Fallbeschreibung und Fallvergleich
- 4 Fallwerkstatt
- 4.1 Der Comic Ne me quitte pas im Spanischunterricht
- 4.1.1 Forschungsfragen und Forschungsrahmen
- 4.1.2 Jordi Lafebre, Ne me quitte pas: Analyse des Textsinns
- 4.1.3 Ne me quitte pas: Analyse des Aufgabensinns
- 4.1.4 Vom Was zum Wie: Wechsel der Analyseeinstellung
- 4.1.5 Fallvergleich und Typenbildung
- 4.2 Die Verständigung über das Lehren von Sprachen. Narrative Interviews mit Bianca und Anne
- 4.2.1 Interview mit Bianca
- 4.2.2 Interview mit Anne
- 4.3.3 Fallvergleich narrativer Interviews
- 5 Ausblick
- Bibliographie
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Glossar
- Schlagwortverzeichnis
1 Einleitung: Der rekonstruktive Zugang zum Fremdsprachenlehren und -lernen
Auf der Suche nach einem methodologischen Referenzrahmen
Unter Mark Twains recht bekannten und in der Regel wenig schmeichelhaften Zitaten über das Erlernen der deutschen Sprache fällt eines in Auge, in dem der Autor das Erlernen des Deutschen mit dem Erlernen des Englischen und dem Erlernen des Französischen vergleicht:
My philological studies have satisfied me that a gifted person ought to learn English (barring spelling and pronouncing) in thirty hours, French in thirty days, and German in thirty years. It seems manifest, then, that the latter tongue ought to be trimmed down and repaired. If it is to remain as it is, it ought to be gently and reverently set aside among the dead languages, for only the dead have time to learn it.
(Appendix D von A Tramp Abroad, “That Awful German Language”)
Meine philologischen Studien haben mich darin bestätigt, dass eine begabte Person Englisch (mit Ausnahme von Orthografie und Aussprache) in dreißig Stunden, Französisch in dreißig Tagen und Deutsch in dreißig Jahren lernen sollte. Es scheint somit auf der Hand zu liegen, dass die letztere Sprache heruntergestutzt und repariert werden sollte. Sollte sie allerdings so bleiben, wie sie ist, so sollte sie sanft und ehrfürchtig zu den toten Sprachen beiseite gelegt werden, da nur die Toten die Zeit haben, sie zu lernen. (Übers. BT)
Ganz offensichtlich waren Mark Twains Lernerlebnisse mit dem Deutschen negativ besetzt. Man könnte nun – Twain folgend – die Ursachen dafür vorwiegend in der deutschen Sprache suchen: zu schwer (mühsam, kompliziert, …) zum Lernen. Man könnte Twain mit einem Augenzwinkern freilich auch als einen Probanden für rekonstruktive Fremdsprachenforschung heranziehen, spiegeln seine Betrachtungen doch, bei aller beabsichtigten Ironie, sozial geteiltes Wissen bzw. sozial geteilte Muster, vor allem das Muster der schweren deutschen Sprache im Vergleich zu anderen Sprachen. Twain verarbeitete seine Frustration beim Fremdsprachenlernen (das „Was“ seiner Aussage) mit dem Mittel der Ironie (das „Wie“). Diese könnte den tieferen Ursprung seiner Frustration verbergen, nämlich das Bedürfnis nach Lernerfolg und Effizienz. Beides blieb ihm beim Versuch, die deutsche Sprache zu lernen, möglicherweise versagt.
Natürlich könnte man die Geschichte einer Begegnung mit der deutschen Sprache auch ganz anders erzählen. Worauf ich mit diesem Beispiel abziele, ist Folgendes: Das Fremdsprachenlernen entspricht genauso wie jedes Lernen einer ← 11 | 12 → Sinnkonstruktion1. Diese ist individuell und kollektiv zugleich. Kollektiv ist sie insofern, als jeder Mensch bestimmte Lebensumstände und somit Erfahrungen, Hoffnungen und Erwartungen mit anderen Menschen teilt. Individuell ist sie, insofern der Einzelne seine Erfahrungen, Hoffnungen und Erwartungen in individuelle Lernentscheidungen gießt. Gelingendes Fremdsprachenlernen folgt also auch einer gelingenden Sinnkonstitution, z. B. in Form einer individuellen Identifikation mit Texten und kulturellen Erwartungen, mit Lehrpersonen und Lernarrangements, mit persönlichen Kompetenz- oder Effizienzerwartungen. Diese sinnstiftenden Identifikationen können freilich auch ausbleiben und dadurch das Erlernen einer Sprache verhindern. Lernen als Sinnkonstruktion kann dieser Schrift als anthropologische Grundannahme vorangestellt werden.
Nach wie vor fällt es schwer, die außerordentliche Komplexität des Fremdsprachenlehrens und -lernens und insbesondere des fremdsprachlichen Unterrichtsalltags empirisch zu erforschen. Neben einigen forschungspraktischen Herausforderungen – erforderlich sind die Bereitschaft von Lehrkräften und Lernenden2, u. U. auch die Genehmigung der Eltern, der Schulleitung, der Schulkonferenz sowie der Schulbehörden – stellt sich elementar die Frage nach einem geeigneten methodologischen Referenzrahmen. Bei standardisierten bzw. quantifizierenden Verfahren besteht das Problem, dass es bei messtechnisch hohen Standards (z. B. quasi-experimentelle Studien mit Kontrollgruppen) oft nicht möglich ist, die natürliche Lernumgebung und die Komplexität der Faktoren sowie die Dynamik der Unterrichtsprozesse adäquat zu erfassen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wie könnte mit einem standardisierten Verfahren die ganze Komplexität des literarischen Textverstehens bei einer Gruppenarbeit adäquat erfasst werden, wo es offensichtlich zu einer Vielzahl individueller und unvorhersehbarer Aushandlungsprozesse kommt? ← 12 | 13 →
Diese und ähnliche Überlegungen veranlassten mich bereits in den Jahren 2006 bis 2009 bei der Arbeit an einer Studie zum Unterricht mit bildungsstandardbasierten Lernaufgaben, mich für offenere methodische Zugänge zu interessieren. Angeregt durch die Begegnung mit Barbara Asbrand, die bereits seit längerem mit der Dokumentarischen Methode arbeitete und zum damaligen Zeitpunkt das globale Lernen an schulischen und außerschulischen Lernorten (Asbrand 2009) erforschte, entschloss ich mich, mit dieser Methode weiterzuarbeiten und entdeckte nach und nach ihr Potential auch für die Fremdsprachenforschung. Von 2006 bis 2007 hatte ich die Gelegenheit, an der Forschungswerkstatt Ralf Bohnsacks, des Mitbegünders der Dokumentarischen Methode, teilzunehmen. Mir wurde bald klar, dass rekonstruktive Verfahren den von mir gesuchten Referenzrahmen für die Verständigungsprozesse im Kontext des Fremdsprachenlehrens und -lernens darstellen könnten. Und die bekannten spezifischen Verfahren der Konversationsanalyse, Narrationsanalyse, objektiven Hermeneutik sowie Dokumentarischen Methode wiesen offensichtlich große Übereinstimmungen in den methodologischen Kernfragen des interpretativen Verstehens von Verständigung auf. Mir wurde überdies deutlich, dass mein Interesse ein fundamental praxeologisches war: Worin besteht eigentlich die Praxis des Fremdsprachenlehrens und -lernens? Welche Sinnkonstruktionen finden in der Praxis des Fremdsprachenunterrichts statt? Welche Sinnebenen konstituieren eine Lernsituation in der Praxis (z. B. Bewältigung einer gestellten Aufgabe, individuelles Leseinteresse, soziale Erwartungen des Elternhauses, Position in der Hierarchie der Peers)? Mein Forscherinteresse lag bald nicht mehr bei der Suche nach gelingender oder nicht gelingender Aufgabenbearbeitung, nach guten oder weniger guten3 Lernaufgaben, sondern bei ganz anderen Fragestellungen, die sich nämlich auf die Verstehens- und Verständigungspraxen in einer Fremdsprache und im Fremdsprachenunterricht sowie auf Praxen der Verständigung über das Lehren und Lernen von Fremdsprachen richteten. ← 13 | 14 →
Praxeologische Fremdsprachenforschung
Dokumentarische Fremdsprachenforschung (z. B. Bonnet 2004, 2009; Bracker 2015; Tesch 2009; fächerübergreifend: Ballis et al. 2014) ist empirisch-praxeologische Forschung. Sie untersucht nicht, was alles beim Fremdsprachenlehren und -lernen stattfinden sollte oder könnte, also die Welt des Konzeptionellen, Normativen oder Potentiellen, und auch nicht die messbaren Resultate des Fremdsprachenlehrens und -lernens, sondern sie richtet den Blick auf die Praxis, auf das, was in der Praxis des Fremdsprachenlehrens- und -lernens geschieht und vor allem darauf, wie es geschieht. Sie nimmt gleichzeitig eine veränderte, nämlich an sozialen Verständigungsprozessen orientierte Perspektive bzw. Analyseeinstellung zum Unterricht ein und hat ein eigenes Erkenntnisinteresse. Somit wiederum stellt sie auch eine ganz natürliche und zugleich notwendige Ergänzung zur fachdidaktischen Aufgabenforschung dar (für die Fremdsprachen z. B. Ellis 2003; Finkbeiner 2008, 2013; Müller-Hartmann & Schocker-v.-Dithfurth 2011; Tesch et al. 2016), die z. T. sehr detailliert Aufgabenkonstituenten und Faktoren der Aufgabenbearbeitung beschreibt und analysiert. Diese Verortung der rekonstruktiven Fremdsprachenforschung ist an das Angebot-Nutzungs-Modell Helmkes (Helmke 2002) anschlussfähig: Aufgaben können als Teil des unterrichtlichen Angebots, ihre praktische Umsetzung als Nutzung betrachtet werden. Rekonstruktive Fremdsprachenforschung ist also – soweit sie das Unterrichtsgeschehen selbst untersucht – auch Aufgabennutzungs- bzw. Aufgabenbearbeitungsforschung. Diese wiederum ist nicht mit der Aufgabenwirkungsforschung – etwa in Form standardisierter Messungen zu Kompetenzständen – zu verwechseln. Und nicht zuletzt sind sowohl die Aufgabenforschung als auch die Aufgabenbearbeitungsforschung einzubetten in eine umfassende Theorie des fremdsprachlichen Klassenzimmers, die allerdings erst in Konturen sichtbar ist (vgl. Breen 1985; Esteve 2010; Legutke 2006) und die die Komponenten Lehrende, Lernende, Themen, Texte, Medien, Interaktion und Diskurse umfasst (s. Kap. 5).
Darüberhinaus lassen sich aber auch die formale Gestaltung fremdsprachiger Texte (im weiteren Sinne Schrifttexte, Bilder, Filme etc.) und deren Wirkung auf den Rezipienten empirisch-rekonstruktiv erforschen. Als Sprach- und Handlungspraxis untersucht die rekonstruktive Fremdsprachenforschung somit die Verständigung durch (fremdsprachige) Texte (s. Kap. 2.2, 3.1, 4.1), die Verständigung durch Aufgaben über Texte (s. Kap. 2.3, 3.1, 4.1) und schließlich auch die Verständigung über den Fremdsprachenunterricht sowie das Lehren und Lernen von Sprachen (s. Kap. 2.4, 3.2, 4.2). Für die Untersuchung der Verständigung über das Lehren und Lernen von Sprachen lässt sich die Dokumentarische Methode überdies mit der Technik des narrativen Interviews verbinden (s. Kap. 3.2, 4.2). ← 14 | 15 →
Die Praxis des Fremdsprachenunterrichts wird von mir als soziale und individuelle Sinnkonstruktion verstanden, eingebunden in kommunikatives Handeln in Gruppen oder im Klassenplenum, aber auch in Einzel- bzw. Stillarbeit.4 Rekonstruktive Fremdsprachenforschung, die diese Praxis untersucht, kann nach Bohnsack (2014: 25) als „Konstruktion zweiten Grades“ bezeichnet werden oder als die Re-Konstruktion einer (sozial) konstruierten Praxis.
Aber auch die Forschungspraxis selbst wird wieder Gegenstand von Rekonstruktion. So leitet Bohnsack (2014: 19–21) aus der Tatsache, dass sie denselben Produktionsgesetzmäßigkeiten unterliegt wie die Praxis, die sie erforscht, Validitätsansprüche der rekonstruktiven Sozialforschung ab5 (s. Kap. 2.1). Unter der Formel „Rekonstruktion der Rekonstruktion“ (ibd. 27) versteht er die Untersuchung der rekonstruktiven Forschungspraxis selbst bzw. der Standortgebundenheit des Forschenden.
Mit welchen Daten arbeitet rekonstruktive Fremdsprachenforschung? Es handelt sich meist um gesprochene oder geschriebene fremdsprachliche (die Fremdsprachen betreffende) oder fremdsprachige (in der fremden Sprache verfasste) Texte aller Art, ferner Bildtexte oder mehrmodale Texte. Es handelt sich häufig um aufgezeichnete Gespräche über Fremdsprache(n) und über das Lernen von Fremdsprachen, Gespräche über das Lehren von Fremdsprachen und sogar Gespräche über das Lernen vom Lehren von Fremdsprachen. Kurzum, alle erdenklichen Texte, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Lernen und Lehren von Fremdsprachen generiert worden sind, können Gegenstand rekonstruktiver Fremdsprachenforschung sein. Die Gesprächstexte sind real: Sie werden ‚im Feld‘ produziert, und müssen daher zur forschenden Verarbeitung gesichert (z. B. audiografiert) und dann ausgewertet werden. In allen ← 15 | 16 → Fällen mündlicher Textdaten beginnt die Auswertung mit der Transkription. In zahlreichen Fällen handelt es sich zudem um Daten, die ‚im Feld’ des Fremdsprachenunterrichts und damit in einer natürlichen oder relativ natürlichen Lernumgebung erhoben wurden und nicht um Daten, die aus Experimenten oder experimentellen Anordnungen hervorgingen.
Konstruktionsprozesse
Was macht das Besondere der Dokumentarischen Methode aus, was unterscheidet sie von anderen nicht standardisierten Untersuchungsmethoden, die ebenfalls Unterrichtsdaten erheben? Eine der grundlegenden Erkenntnisse der Wissenssoziologie Karl Mannheims (1922, 1980), auf die sich die dokumentarisch Forschenden stets beziehen, aber auch des auf George Herbert Mead (1934) zurückgehenden symbolischen Interaktionismus sowie der phänomenologischen Soziologie von Alfred Schütz (1974) liegt darin, dass Verständigung – vor dem Hintergrund sozial geteilter bzw. „konjunktiver Erfahrungsräume“ (Mannheim 1980: 272) – kollektiv erzeugt wird. Individuen erzeugen, in der Terminologie der Dokumentarischen Methode, sozial geteilte „Orientierungsmuster“ (Bohnsack 2014: 39). Diese Orientierungsmuster sind meist unbewusst und werden als vortheoretisches bzw. in der Terminologie Karl Mannheims als „atheoretisches Wissen“ (Mannheim 1980: 73 ff.) bezeichnet. So äußert eine Gruppe im Rahmen eines Gesprächs oder ein Einzelner im Rahmen eines Interviews unbewusst Sinngehalte, die notiert und anschließend rekonstruiert bzw. gedeutet werden können. „Atheoretisches“ Wissen der Beforschten wird auf diese Weise zu theoretischem Wissen der Forschenden.
Die Verständigung innerhalb einer Gruppe impliziert jedoch nicht, dass die rekonstruierten Orientierungen auch im selben Rahmen liegen müssen, was heißt: Sie können kongruent ebenso wie inkongruent sein. Przyborski (2004) unterschied im Bereich kongruenter Rahmungen drei „inkludierende Modi“ und auf der Seite der inkongruenten Rahmungen zwei „exkludierende Modi“ (s. Kap. 3.1.3). In letzterem Falle redet man sozusagen „aneinander vorbei“.
Details
- Pages
- 191
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631675564
- ISBN (ePUB)
- 9783631695425
- ISBN (MOBI)
- 9783631695432
- ISBN (PDF)
- 9783653070835
- DOI
- 10.3726/978-3-653-07083-5
- Open Access
- CC-BY-NC-ND
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (September)
- Keywords
- Sinnebenen Fremdsprachenforschung Unterrichtsforschung Rekonstruktion Interaktion praxeologisch
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 191 S., 3 farb. Abb., 9 s/w Abb., 4 farb. Tab., 8 s/w Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG