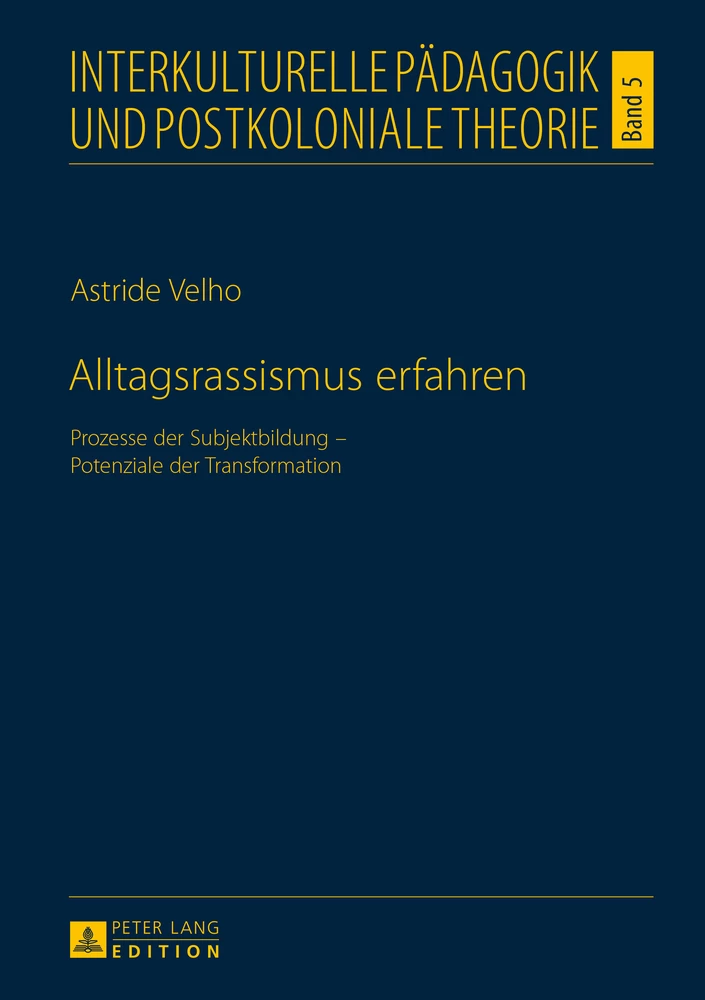Alltagsrassismus erfahren
Prozesse der Subjektbildung – Potenziale der Transformation
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Alltagsrassismus erfahren: Qualitative Forschung im deutschsprachigen Raum
- 2. Produktivität von Macht als Perspektive auf Rassismuserfahrungen
- 2.1 Governmentality Studies
- 2.2 Rassifizierung und Differenzierung
- 2.3 Vielfacher Tod, Ausgrenzung und Auslöschung der Anderen
- 2.4 Fragen nach der psychischen Form der Macht und nach der Konzeption von Handlungsfähigkeit und Widerstand
- 3. Subjektorientierung als Forschungsansatz - Forschungsdesign, Forschungsmethode und Methodologie
- 4. Prozesse der Subjektbildung - zwischen Othering, Internalisierung und Bekenntnis
- 4.1 Die Anderen herstellen
- 4.2 Interkulturelle Pädagogik als Praxis des Othering – ein Beispiel
- 4.3 Othering – theoretische Annäherungen
- 4.4 Othering als Dispositiv
- 4.5 Hegemoniale Subjektivierung
- 4.6 Die Frage nach den Erfahrungen und Subjektivierungen der Anderen
- 4.7 Internalisierung des Selbst als Anderes und Praxen der Assimilierung
- 4.8 Kindheitserfahrungen – Wie die Absenz von Wissen über Rassismus die Internalisierung der Andersheit befördert
- 4.9 Internale, globale und stabile Attributionen und erlernte Hilflosigkeit
- 4.10 Mentalisierungsfähigkeit und das kindliche Wissen um Rassismus
- 4.11 Artikulationen als Perspektive auf Erfahrungen von Alltagsrassismus
- 4.12 Bekenntnisse der rassifizierten Anderen – Technologien des Selbst
- 4.13 Weitere methodologische Fragen zu den Erfahrungen und Subjektivierungen der Anderen
- 5. Potenziale der Transformation - zwischen Schaulust, Involvierung, Exotisierung, Handlungsfähigkeit und Widerständigkeit
- 5.1 Fixierung auf die Position der Anderen: Widerständige Entgegnungen, aber auch Involvierungen
- 5.2 Repräsentationsregime, Voyeurismus, historische Grammatiken und die Zurschaustellung der Anderen
- 5.3 Binaritäten von Stereotypisierungen: Über das Befinden zwischen Exotisierung, Sexualisierung und Dezivilisierung
- 5.4 Begehren, Verschiebung und Fetischisierung
- 5.5 Verstrickungen in Erfahrungen der Exotisierung und Sexualisierung
- 5.6 Bekenntnis und Artikulation als Praxen der Handlungsfähigkeit, Widerständigkeit und solidarischen Intervention und Unterstützung
- 5.7 Rassismus bildet: Materialisierungen der Körper / der Anderen
- 5.8 Resignifizierungen, Identifizierungen, Handlungsfähigkeit und Transformationen der Selbst- und Weltverhältnisse
- 6. Zusammenfassung
- 7. Ausblick - psychosoziale und pädagogische Arbeit, Bildungspraxen, der Zugang zu Ressourcen und Potenziale der Transformation
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Diese Studie fragt nach der Wirkung der durchdringenden Macht des Rassismus, die oft dadurch beschrieben wird, dass diejenigen, welche diese Erfahrungen an den eigenen Körpern und Seelen machen, die rassifizierten Anderen, sich selbst als solche Andere wahrnehmen und empfinden (vgl. Hall 1994: 20 ff.). Rassismus ist auch innerhalb der dominierten Subjekte wirksam (ebd.). Diese können im Kontext von Alltagsrassismus dazu gebracht werden, sich selbst als die Minderwertigen zu erfahren (ebd.). Dabei will diese Studie aber nicht stehenbleiben. So wird danach gefragt, wie Subjekte unter diesen Bedingungen Handlungsfähigkeit und Widerständigkeit herstellen können und Prozesse der Transformation begünstigt werden. Welche Prozesse der Subjektbildung und Potenziale der Transformation können im Zusammenhang mit Rassismuserfahrungen beschränkt oder möglich werden?
Rassismuserfahrungen machen krank. Sie marginalisieren und belasten Menschen auch gesundheitlich, was sich auf ihre Befindlichkeit, Subjektivität und Handlungsmöglichkeiten auswirkt (vgl. Velho 2011; Mecheril & Velho 2013). In manch anderen westlichen Staaten gibt es eine rege und jahrzehntelange Forschungstätigkeit zu den seelischen und körperlichen Auswirkungen von Rassismuserfahrungen. In der Bundesrepublik wird das Thema Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung aber häufig ausgeblendet. Vorwiegend wird über die Auswirkungen von Migration und kulturellen Differenzen, beispielsweise auf die Gesundheit oder Kommunikation, geforscht und interkulturelle Konzepte für die berufliche Praxis werden entwickelt. Diese gehen selten auf die diskriminierende Lebensrealität ein und versäumen häufig, die Dimensionen gesellschaftlicher Machtverhältnisse zu berücksichtigen, in denen Begegnungen, die als interkulturell verstanden werden, stattfinden.
Die Normalität rassistischer Diskriminierung stellt Lebensbedingungen her, die als prekär und potenziell krisenhaft bezeichnet werden können, auch wenn viele unter diesen Bedingungen handlungs- und widerstandsfähig sind und bleiben. Nicht nur für die Gesundheit bedenkliche alltägliche Erfahrungen von Unterwerfung und Herabwürdigung, sondern auch Erfahrungen von Angebot und Anrufung, durch die sich sowohl Restringierungs- als auch Ermöglichungsprozesse entwickeln (Mecheril 2006: 125), erschaffen Subjektivität. Rassismuserfahrungen wirken durch ihren repressiven Gehalt nicht lediglich unterdrückend, ausgrenzend oder krankmachend, sondern sind zudem als Angebote auf gewisse Subjektpositionen zu verstehen, die wiederum Konsequenzen für die Verfasstheit und das Handeln der Betroffenen haben. Es geht deshalb in der vorliegenden Studie um die Annäherung an eine Antwort auf die komplexe Frage, wie die ← 15 | 16 → psychischen Effekte von Macht als einer ihrer „heimtückischsten Hervorbringungen“ (Butler 2001: 12) Bindung an Unterordnung im Kontext von Rassismuserfahrungen in der Bundesrepublik herstellen. Aber auch darum, dass sich das Subjekt durchaus so denken lässt, „dass es seine Handlungsfähigkeit von eben der Macht bezieht, gegen die es sich stellt, so unangenehm und beschämend das insbesondere für jene sein mag, die glauben, Komplizenschaft und Ambivalenz ließen sich ein für allemal ausrotten“ (ebd.: 22).
Rassismuserfahrungen sind alltäglich, aber heterogen und widersprüchlich. Für ein Verständnis über das Geworden-Sein innerhalb der herrschenden rassistischen Machtverhältnisse erscheint es mir bedeutsam, den Gegenstand „Rassismus“, wie auch „Rassismuserfahrungen“, mit Hilfe der Ausführungen anderer Autor_innen zu erläutern und auf im deutschsprachigen Raum vorliegende qualitative Studien und Forschungsergebnisse dazu einzugehen.
Im Fokus des zweiten Kapitels steht die Produktivität von Macht als Perspektive auf Rassismuserfahrungen. Hierzu wird mithilfe der Analysen Michel Foucaults zu Macht und Subjekt, dem Konzept der Gouvernementalität und seiner Frage nach den Funktionen von Rassismus eine Annäherung an Subjektivierungen geschaffen, die im Gegensatz zu der häufig üblichen Vorstellung eines den gesellschaftlichen Bedingungen vorgelagerten autonomen Subjekts steht.
Im vierten und fünften Kapitel wird mit Hilfe der empirischen Analyse auf die psychischen Effekte der Macht eingegangen. Die spezifischen Mechanismen der Subjektbildung werden genauer betrachtet und so die von Foucault ausgesparte Erfahrungsebene im Kontext von Rassismuserfahrungen zum Ausgangspunkt der Betrachtungen gemacht, wie es die Ausführungen von Judith Butler nahelegen. Hierzu wird im dritten Kapitel auf den subjektorientierten Forschungsansatz dieser Studie eingegangen. Es werden aber auch Widersprüchlichkeiten in diesem Ansatz offengelegt. Für die nun in Ihren Händen liegenden Studie wurden Personen, die im Kontext von rassistischen Unterscheidungen in der Bundesrepublik als Andere gelten, sich in Selbstorganisationen engagieren und sich als kritisch gegenüber Rassismus sehen, nach ihren biographischen Erfahrungen und ihrem Gewordensein innerhalb dieser Machtverhältnisse befragt.
Textpassagen aus den biographischen Interviews zu Rassismuserfahrungen werden vor dem Hintergrund theoretischer Zugänge gerahmt und es werden eigenmächtige Modellierungen an ihnen vorgenommen. Von Interesse ist hierbei einerseits, welche phänomenalen Qualitäten Erfahrungen von Othering (zum bzw. zur Anderen machen / gemacht werden) und Rassismus aufweisen. Im Fokus liegen dabei alltägliche, häufig subtile Interaktionen, innerhalb derer rassistische Normalität Wirklichkeit wird – nicht so sehr die offen gewalttätigen, ex ← 16 | 17 → kludierenden und entrechtenden Formen des Rassismus und ihre (in anderer Weise und anderer Existenzialität) gravierenden Effekte.
Andererseits liegt der Fokus der Interviews darauf, wie Subjektivität durch diese Bedingungen mit erschaffen wird; die Auswirkungen dieser Erfahrungen auf Prozesse der Subjektbildung werden in der Analyse der Interviewsequenzen deutlich. Es steht zur Disposition, inwiefern Rassismuserfahrungen, die mit anderen Ungleichheitsdimensionen einhergehen, sowohl unterwerfende als ermöglichende Erfahrungen sind: Erfahrungen, die Macht verinnerlichende und sich den Normen der Macht angleichende Subjektpositionen nach sich ziehen. Zugleich ist zu fragen, in welcher Weise Handlungsfähigkeit beibehalten und Kritikfähigkeit und Widerständigkeit entwickelt werden können. Der theoretische Zugang wird hier mit den Begriffen der Artikulation und Repräsentation von Stuart Hall, zusammen mit jenen des Dispositivs und der selbsttechnologischen Praxis des Bekenntnisses von Michel Foucault sowie der Konzeption der erlernten Hilflosigkeit von Martin P. Seligman erarbeitet. Eine Analyse von Othering- und Rassismuserfahrungen und ihren Auswirkungen auf Subjektivierungen, die auf Auswertungsergebnisse der biographischen Interviews, vorliegenden qualitativen Studien zu Rassismuserfahrungen und auf theoretische Bezüge rekurriert, führt zu der zentralen Fragestellung, wie Subjekte unter diesen Bedingungen Handlungsmächtigkeit und Widerständigkeit herstellen.
Im Kapitel 5.7 und 5.8 wird das Zurückgreifen der Macht auf die Körper in den Fokus genommen und, mit Rekurs auf Judith Butlers Ausführungen zu Mechanismen der Materialisierung als Restringierung und Ermöglichung der rassifizierten Körper und Subjektivierungen, mit psychodynamischen Eigenlogiken zusammengedacht. In Kapitel 6 wird ein Resümee gezogen. Abschließend werden in Kapitel 7 aus bildungswissenschaftlicher Perspektive Möglichkeiten transformatorischer Bildungsprozesse im Kontext von Rassismuserfahrungen und die Rolle des sozialen Umfeldes und pädagogischer und psychosozialer Praxis erörtert. Es wird die Frage gestellt, wie angesichts der Effekte dieser Erfahrungen auf Selbst- und Weltverhältnisse kritische Handlungsfähigkeit entstehen kann, wie deren Entstehung theoretisch gefasst werden kann und wie Bildungsprozesse, die das Subjekt transformieren, unterstützt werden können. Hierbei sind Bildungsprozesse gemeint, die andere Subjektentwürfe als Unterwerfung, internalisierte Andersheit, Assimilierungsbestrebung oder die Reproduktion von Macht eröffnen und unterstützen. Eine Idee von Bildung wird favorisiert, die Subjektivierung unter den Bedingungen von Rassismuserfahrungen als empowernde transformatorische Praxis bedeutsam werden lässt, die Überlebenskunst, Kritikfähigkeit und Widerständiges stärkt und vermehrt – so wie es auch die Interviewten beschreiben. ← 17 | 18 → ← 18 | 19 →
1. Alltagsrassismus erfahren: Qualitative Forschung im deutschsprachigen Raum
Alltagsrassismus erfahren – diese Studie versteht sich als Spurensuche, als Versatzstück oder Baustein einer Analyse, die (inzwischen) auch im deutschsprachigen Raum begonnen wurde. Einer Spurensuche, die einerseits der Alltäglichkeit der Rassismuserfahrungen in diesem Land nachgeht und andererseits versucht, dies aus einer konsequent subjektorientierten Position zu tun, die die Perspektive und das Eingebundensein derer, die Alltagsrassismus erfahren, zum Ausgangspunkt der Analyse macht. Ziel der Analyse ist, die prekären Lebenswirklichkeiten der zu Anderen Gemachten deutlich werden zu lassen und Prozessen der Subjektbildung und der Entwicklung von Handlungsfähigkeiten sowie Potenzialen der Transformation und des Widerstands auf die Spur zu kommen. Nennen möchte ich in diesem Zusammenhang beispielsweise die Studien von Encarnación Gutièrrez Rodríguez (1999), Paul Mecheril (2003), Mark Terkessidis (2004), Claus Melter (2006), Susanne Spindler (2006), Maria do Mar Castro Varela (2007), Grada Kilomba (2008), Tina Spies (2010), Zülfukar Çetin (2012), Nadine Rose (2012) und Wiebke Scharathow (2014).
Rassistische Praxen schaffen machtvolle Differenzierungen zwischen Menschen. Sie positionieren Subjekte nach dem Kriterium der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit. Sie schaffen und legitimieren soziale Ungleichheit. Die vorliegende Studie befasst sich mit der Erfahrung derer, denen Positionen im Außerhalb, in der Nichtzugehörigkeit zugewiesen werden. Die Positionen ergeben sich nicht nur aus Zuweisungen und Viktimisierungen, sondern werden auch durch Selbstpositionierungen hergestellt, denen Praxen von Überlebenskunst, Handlungsfähigkeit und Widerständigkeit zugrunde liegen.
Rassistische Macht wirkt als differenzierende Macht (Miles, 1999), die als Ideologie auftritt und Rassifizierungs- und Ausgrenzungspraxen zeitigt. Sie entfaltet sich sowohl in individuellen Begegnungen, in institutionalisierter und struktureller Form als auch im Kulturellen (Hall 1994, Kalpaka/ Räthzel 1990, Mecheril 2003, Terkessidis 1998 & 2004). Rassismus unterscheidet Menschen, indem wesenhafte Differenzen über „Abstammung“, „Religion“ oder „Kultur“ konstruiert und herstellt werden (Mecheril / Melter 2010: 156): Diese Zeichen der Andersheit werden in unveränderlicher Verbindung zu stabilen Dispositionen auf der Ebene von „Charakter“, „Intelligenz“ oder „Temperament“ gesehen (ebd.). „Mentalitäten“ der eigenen, dominanten und fraglos zugehörigen Gruppe – beispielsweise die Mehrheitsbevölkerung in einem Nationalstaat – werden in Abgrenzung zu den Eigenschaften der Anderen als positiv angesehen, während ← 19 | 20 → die Anderen als minderwertig und nicht-zugehörig betrachtet und positioniert werden (ebd.).
Im Folgenden möchte ich weiter auf theoretische Ausführungen rekurrieren, die deutlich machen, um welchen Gegenstand und welche Erfahrungen es sich handelt, wenn von Erfahrungen des Alltagsrassismus gesprochen wird. All dies möchte ich als Bemühung verstanden wissen, die der Wegbereitung einer Analyse von Prozessen der Subjektbildung und Potenzialen der Transformation im Kontext dieser Erfahrungen dienen kann (vgl. nachfolgendes Kapitel).
Details
- Seiten
- 234
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (Hardcover)
- 9783631651889
- ISBN (PDF)
- 9783653046175
- ISBN (MOBI)
- 9783653985771
- ISBN (ePUB)
- 9783653985788
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04617-5
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (November)
- Schlagworte
- Rassismuserfahrungen Diskriminierung Subjektivierung Bildungsprozesse Empowerment Handlungsfähigkeit
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 234 S., 11 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG