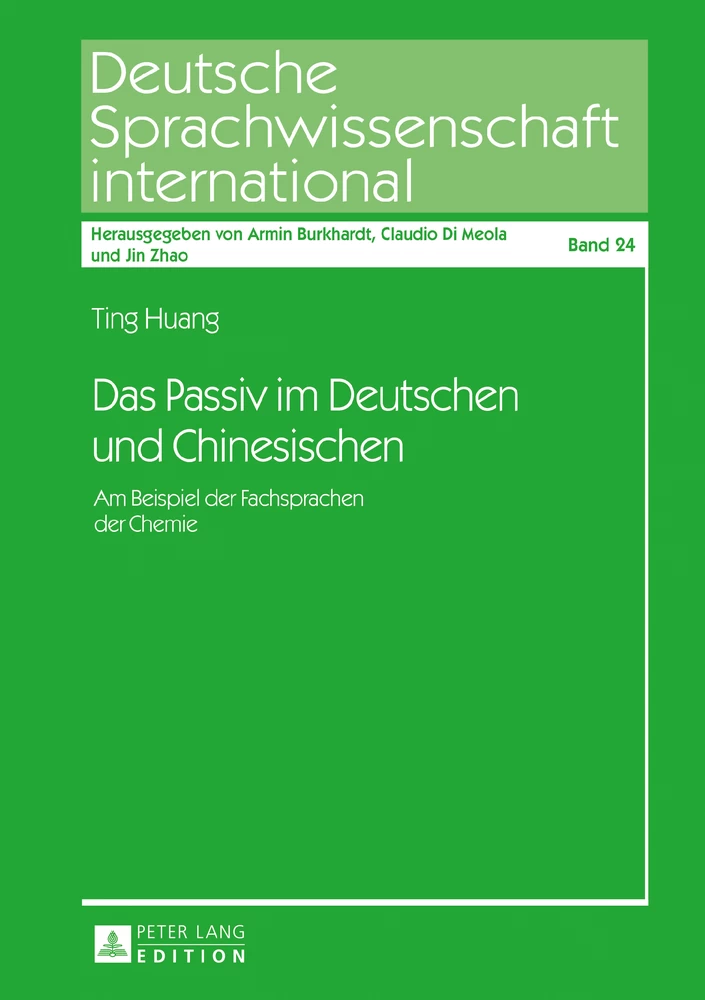Das Passiv im Deutschen und Chinesischen
Am Beispiel der Fachsprachen der Chemie
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Abbildungen und Tabellen
- 1. Einleitung
- 1.1. Zum Forschungsgegenstand
- 1.2. Überblick zu Forschungsstand, Methode und Gliederung
- 1.2.1. Zum Forschungsstand
- 1.2.1.1. Forschungsstand des Passivs im Deutschen
- 1.2.1.2. Forschungsstand des Passivs im Chinesischen
- 1.2.1.3. Forschungsergebnisse der herkömmlichen vergleichenden Studie
- 1.2.2. Untersuchungsmethode und Korpusvorstellung
- 1.2.2.1. Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2.2.2. Das Korpus: Vorstellung und Untersuchungsschritte
- 1.2.3. Gliederung der Arbeit
- 2. Fachsprachen
- 2.1. Fachsprache und Gemeinsprache
- 2.2. Gliederungen der deutschen Fachsprachen
- 2.3. Besonderheiten der deutschen Fachsprachen
- 2.3.1. Allgemeine Eigenschaften des wissenschaftlichen Schreibens
- 2.3.2. Fachsprachliche Lexik
- 2.3.2.1. Bestandteile der Lexik
- 2.3.2.2. Lexikalische Eigenschaften
- 2.3.3. Syntaktische Besonderheiten
- 2.3.3.1. Passiv in Fachtexten
- 2.3.3.2. Andere syntaktische Mittel für Deagentivierung
- 2.3.4. Textuelle Besonderheiten
- 2.4. Begründung für die Wahl der chemischen Sprache
- 2.5. Fazit
- 3. Das Passiv im Deutschen
- 3.1. Definition des deutschen Passivs
- 3.2. Festlegung grundlegender Begriffe
- 3.2.1. Agens und Subjekt
- 3.2.2. Patiens und Objekt
- 3.2.3. Rezipient-Experiencer-Benefaktiv
- 3.2.4. Argument und Argumentstruktur
- 3.3. Vorgangspassiv
- 3.3.1. Die morphosyntaktische Form
- 3.3.2. Das unpersönliche Passiv
- 3.3.3. Werden-Passiv mit transitiven Verben (Vt)
- 3.3.3.1. Verben mit Od
- 3.3.3.2. Agens der Handlung und subjektfähige Ergänzung der Präpositionen
- 3.3.3.3. Patiens der Handlung
- 3.3.3.4. Weitere Argumente des Prädikats
- 3.3.4. Bildungsrestriktionen des deutschen Vorgangspassivs
- 3.4. Zustandspassiv
- 3.4.1. Grundlegende Struktur und deren syntaktische Funktion
- 3.4.2. Zustandspassiv und Vorgangspassiv
- 3.4.3. Zustandspassiv und allgemeine Zustandsformen
- 3.4.3.1. Das Zustandspassiv bei Zifonun et al.
- 3.4.3.2. Die allgemeine sein-Konverse
- 3.4.3.3. Die allgemeinen Zustandsformen
- 3.4.4. Bildungsrestriktionen des Zustandspassivs
- 3.5. Es
- 3.6. Rezipientenpassiv
- 3.7. Passivähnliche Konstruktionen
- 3.8. Aktiv und Passiv
- 3.9. Das deutsche Passiv im Korpus
- 3.9.1. Unpersönliches Passiv im Korpus
- 3.9.1.1. Unpersönliches Passiv bei intransitiven Verben
- 3.9.1.2. Unpersönliches Passiv bei der intransitiven Verwendung transitiver Verben
- 3.9.1.3. Unpersönliches Passiv mit einer subjektfähigen Ergänzung in PP
- 3.9.1.4. Unpersönliches Passiv ohne subjektfähige Ergänzung in PP
- 3.9.1.5. Funktionen des unpersönlichen Passivs in der chemischen Sprache
- 3.9.2. Zweitakt-Passiv im Korpus
- 3.9.2.1. Vorgangspassiv mit einer subjektfähigen Ergänzung in PP
- 3.9.2.2. Vorgangspassiv ohne subjektfähige Ergänzung in PP
- 3.9.2.3. Zustandspassiv mit einer subjektfähigen Ergänzung in PP
- 3.9.2.4. Zustandspassiv ohne subjektfähige Ergänzung in PP
- 3.9.2.5. Verben beim Zweitakt-Passiv
- 3.9.2.6. Funktionen des Zweitakt-Passivs in der chemischen Sprache
- 3.9.3. Die sein + zu + Inf.-Konstruktion
- 3.9.4. Reflexiv mit und ohne lassen
- 3.9.5. Funktionen des Pronomens es im Korpus
- 3.10. Fazit
- 4. Das Passiv im Chinesischen
- 4.1. Definition des chinesischen Passivs
- 4.2. Darlegung einiger Begriffe
- 4.2.1. Subjekt und Objekt
- 4.2.2. Agens und Patiens
- 4.2.3 Shící 实词 „Vollwort“ und xūcí 虚词 „synsemantische Wörter“
- 4.2.3.1. Chinesische Präpositionen und bèi 被
- 4.2.3.2. Chinesische temporale Adverbiale
- 4.2.3.3. Dòngtài zhùcí 动态助词 „Aspect-Partikel“
- 4.3. Passiv mit Markierung
- 4.3.1. Passivsatz und Passivstruktur
- 4.3.2. Passiv mit bèi 被
- 4.3.3. Passiv mit shòu 受
- 4.3.4. Passiv mit zāo 遭
- 4.3.5. Passiv mit wéi 为 und wéi…suŏ 为…所
- 4.4. Passiv ohne Markierung
- 4.5. Lesarten des chinesischen Passivs
- 4.6. Bildungsrestriktionen des chinesischen Passivs
- 4.6.1. Xíngwéi dòngcí 行为动词 „Aktionsverben“
- 4.6.1.1. Unabhängige Aktionsverben
- 4.6.1.2. Unfreiwillige Aktionsverben
- 4.6.2. Zhuàngtài dòngcí 状态动词 „Zustandsverben“
- 4.6.3. Guānxì dòngcí 关系动词 „Relationsverben“
- 4.6.4. Néngyuàn dòngcí 能愿动词 „Willensverben“ oder „Hilfsverben“
- 4.6.5. Telische und atelische Verben
- 4.7. Das chinesische Passiv im Korpus
- 4.7.1. Passiv mit Markierung und mit Agens
- 4.7.1.1. Menschliches Agens
- 4.7.1.2. Nicht-personales Agens
- 4.7.2. Passiv mit Markierung und ohne Agens
- 4.7.3. Passiv ohne Markierung und ohne Agens
- 4.7.4. Lesarten des Passivs in der chemischen Fachsprache
- 4.8. Fazit
- 5. Vergleich des Passivs im Deutschen und im Chinesischen
- 5.1. Vergleich in Grundform und Typologie
- 5.2. Vergleich der Verben
- 5.3. Vergleich Agens und Patiens
- 5.4. Syntaktische und semantische Funktionen des Passivs
- 5.5. Quantitativer Vergleich des Passivs in chemischen Fachsprachen
- 5.6. Wiedergabe des chinesischen Passivs im Deutschen
- 5.6.1. Allgemeine Übersetzungsmöglichkeiten von Passiv mit Markierung
- 5.6.1.1. Übersetzung beim Passiv mit bèi 被
- 5.6.1.2. Übersetzung bei Passiv mit anderen Markierungen
- 5.6.2. Übersetzungsmöglichkeiten des Passivs mit Markierung aufgrund des Korpus
- 5.6.3. Allgemeine Übersetzungsmöglichkeiten für Passiv ohne Markierung
- 5.6.4. Übersetzungsmöglichkeiten des Passivs ohne Markierung anhand des Korpus
- 5.6.5. Einfluss der westlichen Sprachen auf das chinesische Passiv
- 5.7. Fazit
- 6. Didaktische Möglichkeiten
- 6.1. Der Lernzustand des Chinesischen in Deutschland und des Deutschen in China
- 6.2. Passiv in Lehrbüchern
- 6.3. Unterrichtsgedanken über das Passiv
- 6.3.1. Die didaktisch-methodische Perspektive nach Kempter
- 6.3.2. Lehren und Lernen von bèi 被-Sätzen nach Sun et al.
- 6.3.3. Fachsprachliche didaktische Perspektive nach Zhu et al.
- 6.4. Fazit
- 7. Schlussfolgerung
- Literatur
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Online-Resourcen
Ting Huang
Das Passiv im Deutschen
und Chinesischen
Am Beispiel der Fachsprachen der Chemie
![]()
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zugl.: Bochum, Univ., Diss., 2016
D 294
ISSN 1862-653X
ISBN 978-3-631-72410-1
E-ISBN 978-3-631-72457-6 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-72458-3 (EPUB)
E-ISBN 978-3-631-72459-0 (MOBI)
DOI 10.3726/b11278
© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2017
Alle Rechte vorbehalten.
Peter Lang Edition is an Imprint of Peter Lang GmbH.
Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
This publication has been peer reviewed.
Autorenangaben
Ting Huang studierte Germanistik an der East China Normal University und der Tongji-Universität in Shanghai. Sie war Stipendiatin des CSC (China Scholarship Council) und wurde an der Fakultät für Philologie der Universität Bochum promoviert.
Über das Buch
Dieses Buch befasst sich mit dem Passiv im Deutschen und Chinesischen und führt einen korpusgestützten Sprachvergleich durch. Passiv als eine Sub-kategorie des Genus Verbi tritt häufig in Fachtexten auf, deshalb liegt der Untersuchung eine Sammlung der Passivsätze aus chemischen Fachzeitschriften zugrunde. Durch parallele Analysen zum Passiv im Deutschen und Chinesischen analysiert die Autorin, welche Unterschiede und Übereinstimmungen das Passiv in beiden Sprachen bei den lexikalisch-semantischen und syntaktischen Perspektiven besitzt. Die Ergebnisse dienen so auch dem Sprachlehren und der Fachdidaktik.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Vorwort
Sprachvergleich ist ein interessantes Thema, aber zugleich wird darum gestritten, ob Sprachen unterschiedlicher Sprachsysteme überhaupt vergleichbar sind. Deutsch und Chinesisch sind zwei sehr unterschiedlichen Sprachsystemen zuzuordnen. Sie unterscheiden sich deutlich voneinander, es bestehen jedoch auch viele Gemeinsamkeiten in etwa syntaktischer Perspektive.
In der vorliegenden Arbeit wird das Passiv im Deutschen und Chinesischen mit der Unterstützung eines Korpus – einer Sammlung der Passivsätze aus Fachzeitschriften der Chemie – hinsichtlich der morphosyntaktischen Struktur und semantischer Lesarten analysiert. Der Analyse des Passivs im Deutschen liegt hauptsächlich die Grammatik bzw. Theorie von Zifonun et al. (1997) und Helbig (1996) zugrunde. Der chinesische Teil basiert vor allem auf der Grammatik von Liu et al. (2010) und einige Begriffe in Reichardt (1990) werden von der vorliegenden Arbeit angenommen. Wegen des Hintergrundes der chemischen Fachsprache ist von Eigenschaften der Fachsprachen auch kurz die Rede. Dafür werden Ansätze etwa von Fluck (1996), Hoffmann (1998) und Roelcke (2010) erwähnt und vergleichend angenommen. Nach der korpusgestützten Analyse bzw. dem Vergleich des Passivs in beiden Sprachen werden einige Gedanken über didaktische Möglichkeiten beim Lehren des Passivs diskutiert. Auf Grund der vorhandenen Kursbücher und der didaktischen Überlegungen von Kempter (1996), Sun et al. (2006) und Zhu et al. (2003) wird kurz auf die Reihenfolge und Methoden des Lehrens für das Passiv bzw. die Fachsprache eingegangen.
Ich bedanke mich bei Prof. Dr. Karin Pittner für ihre Betreuung, uneingeschränkte Hilfe und Zutrauen. Mein herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Jianhua Zhu und Prof. Dr. Jin Zhao für ihre Verbesserungsvorschläge zu meiner Arbeit. Für die Hilfe beim Sammeln der chinesischen Aufsätze im Fach Chemie möchte ich Dr. Rongbiao Liu danken. Ich danke besonders meinem Ehemann Dr. Peirong Chen, meinen Eltern und Schwiegereltern für Verständnis und Unterstützung und meiner Tochter dafür, dass sie mich fast niemals störte, wenn ich arbeitete. Ein besonderer Dank gilt der Kita, die meiner Tochter einen Platz anbot. Darüber hinaus gilt mein Dank allen Verwandten, Freunden und Nachbarn, die uns halfen, verstanden und unterstützten.
Die Anfertigung der vorliegenden Arbeit wurde vom „China Scholarship Council“ finanziell unterstützt.←5 | 6→ ←6 | 7→
Inhaltsverzeichnis
1.2. Überblick zu Forschungsstand, Methode und Gliederung
1.2.1.1. Forschungsstand des Passivs im Deutschen
1.2.1.2. Forschungsstand des Passivs im Chinesischen
1.2.1.3. Forschungsergebnisse der herkömmlichen vergleichenden Studie
1.2.2. Untersuchungsmethode und Korpusvorstellung
1.2.2.1. Problemstellung und Zielsetzung
1.2.2.2. Das Korpus: Vorstellung und Untersuchungsschritte
Details
- Pages
- 204
- Publication Year
- 2017
- ISBN (Hardcover)
- 9783631724101
- ISBN (PDF)
- 9783631724576
- ISBN (ePUB)
- 9783631724583
- ISBN (MOBI)
- 9783631724590
- DOI
- 10.3726/b11278
- Language
- German
- Publication date
- 2017 (May)
- Keywords
- Sprachvergleich Korpusanalyse Fachdidaktik Syntax Genuis Verbi
- Published
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 204 S., 16 Abb., 6 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG