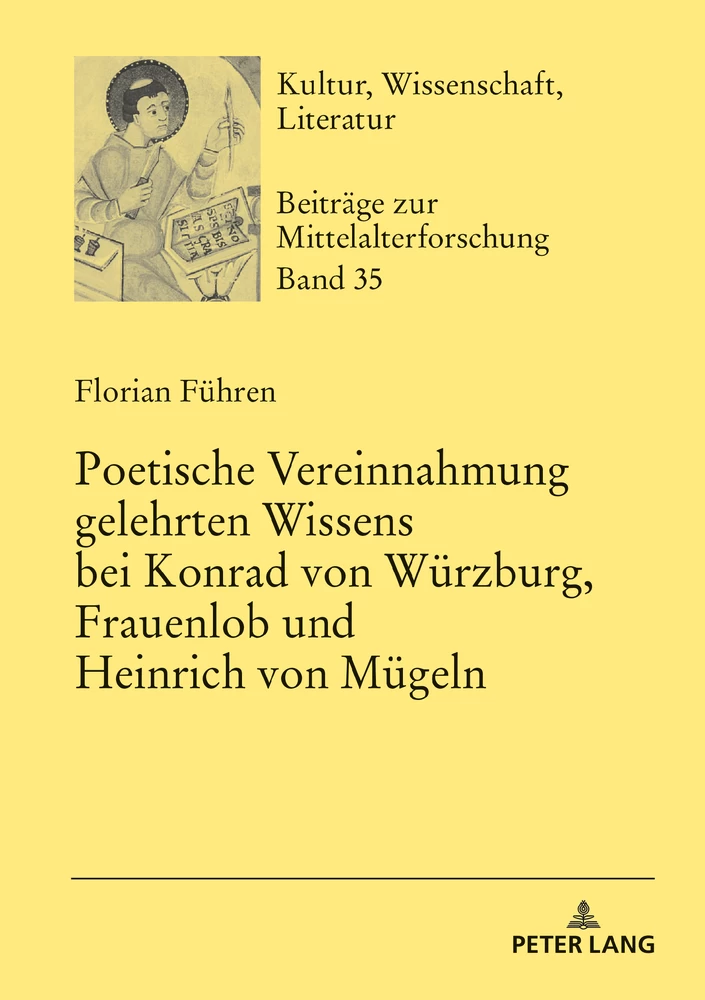Poetische Vereinnahmung gelehrten Wissens bei Konrad von Würzburg, Frauenlob und Heinrich von Mügeln
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Überlegungen und Zielsetzungen
- 1.1 Gedankenmodelle der Wissenschaft
- 1.2 Sinnbildung, Leserhaltung und Literaturverständnis
- 2. Konrad von Würzburg
- 2.1 ‚Messbares‘ Lob – Der poeta laudans nach Maß und Zahl
- 2.2 Mischen und Erfrischen
- 2.3 Trost durch Maria
- 2.4 Zwischen Fabel und Naturkunde
- 3. Frauenlob
- 3.1 Programmatik Frauenlobs
- 3.2 Maria versus Materie?
- 3.3 Fachsprachliche Klimax
- 3.4 Minne und Welt
- 3.5 Rezeptionsästhetische Betrachtung der Überlieferungssituation
- 4. Heinrich von Mügeln
- 4.1 Programmatik Heinrichs von Mügeln
- 4.2 Positionierung der Wissenschaften in Der Meide Kranz
- 4.2.1 Kranke Schrift und verarztende Künste
- 4.2.2 Messen als creatio und der Mensch als Tier
- 4.2.3 Mediale Reflexion über die Rolle der Musica
- 4.2.4 Astronomie als Augur der Vergangenheit
- 4.2.5 Alchemistische, poetische und rezeptionsästhetische imitatio
- 2.4.6 Die Theologie als Synthese
- 4.3 Mügelns Spruchdichtung
- 4.3.1 Poetischer Nutzen von Anatomie und Naturgesetzen
- 4.3.2 Alchemistische Sprüche
- 4.4 Prager Umfeld und Überlieferung
- 5. Resümee
- 6. Literaturverzeichnis
- 7. Stellenregister
- Reihenübersicht
1. Einleitende Überlegungen und Zielsetzungen
Die Feststellung, dass Fachwissen und Literatur – ganz gleich, welcher Epoche – sich im ständigen Austausch befinden, wird niemanden überraschen. Schon in der klassischen Literatur findet man Beispiele für die Thematisierung fachwissenschaftlicher Inhalte, für Lehr- oder Kataloggedichte, Merkverse – häufig gekoppelt an einen didaktischen Gestus – sowie weitere Kategorien, die über die Jahre in der Forschung eröffnet worden sind. Selbst für die lateinischen Autoren, an welchen sich das Mittelalter maßgeblich orientiert, sind aber Fragen nach der Gattungszugehörigkeit oder der hinter dem Thema stehenden Intention selten abschließend zu klären. So zeichnet sich schon im Übergang von Lukrez’ De rerum natura zu Vergils Georgica ein Gefälle ab, das trotz der ersten Konstatierung lehrhafter Züge schwer qualifizierbar bleibt. Die Unterschiede in didaktischer Haltung und Fiktionalität scheinen mit der bloßen Bestimmung als Lehrgedicht nicht abschließend erfasst zu sein.1 Daraus geht hervor, dass die Interdependenz von Dichtung und Wissen abhängig vom Einzelfall zu reevaluieren ist. Eindrucksvoll hat die bisherige Forschung gezeigt, dass dieser Gestus sich meist nur in Komposita erfassen lässt. So soll auch hier der Begriff der ‚Wissenschaftsdichter‘ eine gattungstheoretische und rhetorische Grauzone bezeichnen, die in Konrads von Würzburg kupfernem Willen erstmals aufglimmt und anschließend in Frauenlobs kosmologischer mische sowie in Heinrichs von Mügeln literarischer Position zwischen Alchemist und Dichter vertieft wird. Dieser in der Forschungsgeschichte schon mehrfach gebrauchte Terminus soll also hier diejenigen Literaten bezeichnen, die sich durch dichterische Aufarbeitung von Fachwissen und -sprache an der Schwelle zur Fachliteratur platzieren. Ihr habituelles Selbstverständnis schließt dabei die Reflexion über Fachsprache und Rhetorik genauso ein wie diejenige über den epistemischen Wert ihrer Dichtung und über die Abhängigkeit ihres Dichterstatus von fachlich verbriefter Wissenschaft. ← 9 | 10 →
Um die monströs anmutenden Begriffe ‚Dichtung‘ und ‚Wissen‘ inhaltlich gebrauchen zu können, ist eine Rekonstruktion von Dichterverständnis und Gattungsgeschichte ebenso unerlässlich wie eine Analyse der Überlieferung, Wissenschaftsgeschichte und des poetologischen Hintergrunds. Nur die Kombination all dieser Kriterien kann am Ende erlauben, derart komplexe Spiele mit dem Gattungsverständnis insoweit zu begreifen, dass ein keineswegs abschließendes Urteil über die bloße Identifikation bereits bekannten Fachwissens oder eines gelehrten Gestus hinausreicht.2 Auch ist nur so möglich, die Fragen zum Spiel zwischen poetologischen Reflexionen und wissenschaftlicher Denkweise für das (Spät-)Mittelalter zu klären, ohne die Ergebnisse zu stark durch diejenigen der neueren Germanistik, Romanistik oder der klassischen Philologie beeinflussen zu lassen.3 ← 10 | 11 →
Der Interpret jener Texte, die gerade unserer empirisch geprägten Zeit4 so fremd erscheinen müssen, erhält Hilfe aus jenen Jahrhunderten, welche die Brücke zu unserem bilden,5 sodass der poetische Gestus sich beständig weiterentwickelt, ohne jedoch realistisch unter einem Begriff subsumiert werden zu können.6 Nicht nur aufgrund der in den Textbeispielen verzahnten Disziplinen, die ihrerseits die unterschiedlichsten Definitionen gebrauchen, und deren Diskrepanz zur heutigen Wissenschaftsmethodik, erscheint eine Arbeitsdefinition des Begriffs ‚Wissen‘ wenig hilfreich: Anders als etwa bei Gebert soll hier nicht von einem philosophiegeschichtlichen oder rezeptionsästhetischen Wissensbegriff ausgegangen werden, zumal sich ein differenzierter Gebrauch der Begriffe ‚Wissen‘, ‚Wissenschaft‘, ‚conscientia‘ oder ‚ἐπιστήμη‘ ohnehin erst im Laufe der frühen Neuzeit ausmachen lässt.7 Vielmehr soll der Einfluss fachterminologisch geprägter Textgattungen – vereinfachend ‚Fachliteratur‘– auf diejenigen Texte, ← 11 | 12 → die ihrem Gegenstand und ihrer Gestaltung nach kein wissenschaftliches Ziel verfolgen, untersucht werden. Über die Diachronie und den komparatistischen Ansatz wird aus jenem sonst punktuellen Einfluss ein wechselseitiger Austausch zwischen beiden Diskursen. Damit wird nicht der Frage des epistemischen Gehalts der Literatur nachgegangen.8 Vielmehr wird untersucht, wie sich Fachwissenschaft – betrachtet man sie vereinfacht als Sammlung von Topoi – auf das bereits gegebene rhetorische und gattungsgeschichtliche Verständnis auswirkt und wie es dieses transformiert oder bereichert. Ein Abgleich der dichterischen Praxis mit den zugrundeliegenden rhetorischen Termini erschiene somit sinnvoller; allerdings gibt es keinen zentralen Begriff, der sich über die Rhetoriken und Poetiken hinweg verfolgen ließe und zudem die vielfachen Manifestationen dieses Stilgestus umfasst. Folglich sollen einleitend einige epistemisch oder fachsprachlich geprägte Begriffe aus den Rhetoriken Erwähnung finden, die man als Grundlage auch für das Schaffen mittelalterlicher Autoren voraussetzen darf, sodass an gegebener Stelle auf die dichterische Erweiterung konkreter Stilmittel verwiesen werden kann. Als gängige Autoritäten dürften auf diesem Gebiet zunächst (eingeschränkt) Cicero, weiterhin Quintilian sowie die Rhetorica ad Herennium und die Poetiken gelten.
Aufgrund ihrer vergleichsweise funktionsorientierten Ausrichtung am Briefwesen, der Predigt, etc. kann man letzteren nur bedingt Informationen zu den vom Redner oder gar Dichter zu erlernenden Wissenschaften entnehmen. Auch Begriffe, die sich mit Topoi wie der lêre, der meisterschaft oder der kunst in Verbindung bringen ließen, werden schon deshalb nicht diskutiert, da sich die Poetiken i. d. R. schon im Werkkonzept (und damit im ‚Titel‘) einer ars verschreiben.9 ← 12 | 13 →
Da der elocutio und den ihr zuzuweisenden Phänomenen hier besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, eignen sich die im Mittelalter rezipierten Schriften Ciceros, die sich mehrheitlich der inventio zuwenden, für dieses Thema nur bedingt. In der Topik etwa ist zwar sein Argumentbegriff eng an die ratio gekoppelt,10 seine Behandlung der similitudo hingegen ist dergestalt, dass rationaler Aufwand oder memoria für ihn keine Rolle spielen. Allerdings geht er auf das Vorkommen der translatio in der Dichtung ein, was auffallen muss, weil ihm diese sonst selten als Beispiel dient.11 Auch erlaubt ihm die feingliedrige Differenzierung die genauere Behandlung des extrinsischen Vergleichs, der Autoritäten hinzuzieht und den er „artis expertis“ nennt.12 In De Inventione spricht Cicero kurz die für die Belehrung notwendige Aufmerksamkeit des Rezipienten an,13 wenn auch nicht dessen Vorwissen, welches später eher im Fokus stehen soll. Man sollte aber anmerken, dass es sich dabei um Randbemerkungen handelt, die über das Werk verstreut sind, weniger um bündige Diskussionen, die den mittelalterlichen Dichtern eine konzeptionelle Vorlage hätten liefern können.
Anders verhält es sich bei Quintilian. Richtete sich die mittelalterliche Rezeption Ciceros hauptsächlich auf dessen Dialoge oder auf Kommentare wie den des Macrobius, so kann man für die Institutio Oratoria auch im Mittelalter Kenntnisse voraussetzen. Die Besonderheit dieses Werks liegt gegenüber anderen rhetorischen Schriften in seinem Umfang, den Quintilian einleitend damit begründet, dass er gegenüber anderen Autoren keine Allgemeinbildung voraussetzt.14 ← 13 | 14 →
Quintilian bettet nun die Behandlung jener Propädeutik nicht nur in sein Werk ein, sondern setzt auch pädagogisch für den Redner „omnis animi virtutes“15 voraus. Unter Verweis auf Ciceros De oratore knüpft er das Wesen der Philosophie eng an das der Rhetorik,16 was in dem Anspruch der Weisheit auch für den Redner mündet.17 Neben ausgezeichneten Lehrern hält er deshalb die Kenntnis mehrerer Wissenschaften für nötig.18 In einem Kapitel über die notwendige Kenntnis fremder Fächer betont Quintilian, dass er sich nicht an rednerischen Vorgaben der Vergangenheit orientiert, sondern ein Idealbild der rhetorischen Ausbildung zeichnet.19 Konkret erwähnt er dabei die Musik und die Geometrie.20 Auch die Frage, ob man die Redekunst einfach beherrscht und woraus ihr Status als ars oder doctrina erwächst, wird diskutiert.21 Interessanterweise ordnet Quintilian dieser Frage die Diskussion Ciceros unter, wovon es Wissen geben könne: „‚ars earum rerum est, quae sciuntur‘.“22 Diese weist Quintilian unter Verweis auf Astronomen und Ärzte zurück, die ebenfalls keinen abschließenden Wahrheitsanspruch erheben könnten, sodass die Rhetorik sich nach seinem Verständnis mit der gelungenen Rede selbst genügt. Schließlich warnt er vor dem trügerischen Anschein von Gelehrsamkeit in seiner Behandlung der obscuritas,23 verbindet Klarheit und Schmuck mit der Aufmerksamkeit des Zuhörers,24 und lässt in der Wahl der Gleichnisse trotz Warnung vor dunklem Ausdruck den Dichtern gegenüber den Rednern einen gewissen Spielraum.25 ← 14 | 15 →
Somit ist ersichtlich, dass die hier betrachteten Dichter Vorgaben hätten finden können, deren Verarbeitung in Begriffen wie lêre und meisterschaft oder auch im Exklusivitäts- und Kunstanspruch ihren Ausdruck finden könnten, wie er später behandelt werden soll. Damit setzt man allerdings eine selektive Betrachtung oder Kenntnis Quintilians voraus, was nur natürlich wäre, da jene Aussagen vom juristischen Kontext seines Werkes und erwarteten Publikums zu lösen wären und Quintilian über keinen zentralen Begriff verfügt, welcher dem der lêre oder meisterschaft vergleichbar ist.
Die Rhetorica ad Herennium behandelt unter dem Aspekt der similitudo in nur wenigen Worten deren Auswirkung auf die „[memoria naturalis]“ sowie die Übung des „ingenium“. Begründet wird die natürliche Erinnerung durch Wiederholung und eine Unterstützung der „[doctrina naturae]“. Ein gewisses Analogieverhältnis muss hier freilich schon aufgrund des auch andernorts bekannten „Imitetur ars igitur naturam […]“26 mitgedacht werden. Auch wird das Ausmaß des einer Person zuschreibbaren Kunstverstands an deren Fähigkeit bemessen, Lehre zu erkennen oder „ex arte“ zu schreiben, wobei der lehrkonformen Produktion mehr Bedeutung beigemessen wird als der erfolgreichen Rezeption.27 Setzte man eine Mäßigung im Gebrauch voraus, welche die sog. Blümer jedoch selten an den Tag legen, ließe sich auch die translatio, gerade deren Funktion „[o]rnandi causa“28 fruchtbar machen, die freilich auch anderswo thematisiert wird, etwa bei Quintilian. Die an viele Mittel des ornatus geknüpfte Zurückhaltung und Bescheidenheit suchen wir allerdings bei den mittelalterlichen Autoren vergebens; fast, als wollten sie diese Regeln pervertieren.
Diese Beispiele zeigen, dass die rhetorisch gebildeten Dichter sicherlich aus der Quellenlage heraus über die Abhängigkeit ihres Kunstverständnisses von wissenschaftlichem Vorwissen sowie über das vorauszusetzende Verständnis des Rezipienten reflektieren konnten. Allerdings wird genauso deutlich, dass eine abschließende Definition nur schwerlich mit einem Begriff wie dem des Ornats, des Blümens oder auch der Kunst erzielt werden kann. Jene einleitenden Anmerkungen geben also ein behelfsmäßiges Gerüst, das nun mit weiteren wissenschaftshistorischen ausgebaut werden muss: ← 15 | 16 →
Gerade das Spätmittelalter ist – u. a. bedingt durch den aufkommenden Nominalismus – einer wachsenden Modellbildung unterworfen und die neuen Modelle komplementieren die alten vielmehr als dass sie jene ersetzen.29 Auch liegen dem Interpreten, der den Einfluss astronomischen oder alchemistischen Vokabulars verfolgen will, die zwei wissenschaftshistorischen Extreme der Überlieferung vor; hier eine mehr als redundante Quellenlage samt Verbreitung in Enzyklopädien, dort ein spezielles Verhältnis zu den Volkssprachen und eine der Disziplin inhärente Tendenz zur Geheimhaltung, die deren umfassende schriftliche Verbreitung um ein bis zwei Jahrhunderte verzögert. Für den Interpreten der diese Quellen weiterverarbeitenden Dichtung bedeutet dies, dass eine Quellenanalyse im Stile Hubers30 meist nicht möglich ist. Daraus folgt für die weitere Entwicklung dieser These, dass die Zuweisung einer konkreten Theorie zum Wissensbestand eines Autors weniger im Fokus stehen wird als deren dichterische Vereinnahmung im kunstreflexiven und metaphorologischen Sinn. Um mit einem prominenten Beispiel aus anderer Zeit zu sprechen: Die Feststellung, dass ein Dichter zu Zeiten der sog. kopernikanischen Wende Sonne oder Erde ins Zentrum eines beschriebenen Kosmos setzt, wäre aus Sicht der hier skizzierten Methodik weniger relevant als die topische31 Aufarbeitung der Theorie oder die (vielleicht gebrochene) Kohärenz ← 16 | 17 → der Darstellung. Ist diese Darstellung dominant mystisch, mythologisch, astronomisch, alchemistisch? Lässt sich überhaupt ausmachen, ob sie – im Verhältnis zur Lebenszeit des Autors – aktuelle wissenschaftliche Dispute verarbeitet oder zeitverzögert alte Theorien konserviert? Ist ein wissenschaftliches Modell in den poetischen Raum übertragbar oder verfällt es – bedingt durch Verkürzung und zweideutige Terminologie – zur unverständlichen Abstraktion im Wirrwarr der Begriffe?32
Ebenso darf in einem Kontext, der durch den didaktischen Gestus der Dichtung geprägt ist, das soziohistorische Phänomen der Singschulen und Meistersänger nicht vernachlässigt werden,33 das den hier behandelten Dichtern und deren Begriff der meisterschaft nachgeschaltet und strikt von diesen zu trennen ist, begrifflich und in ihrem Dichtungsverständnis jedoch zahlreiche Parallelen ← 17 | 18 → aufweist, die bei falscher theoretischer Konnotation zu Missinterpretationen führen. Schon das Beispiel Jakob Lochers, der die kaiserliche Wertschätzung seiner Dichtung durch Auszeichnung zum poeta laureatus jedem universitären Grad vorzieht, zeigt, dass bei einem vergleichbaren Einfluss der Wissenschaft auf das literarische Tun, teils sogar bei gleichbleibender Metaphorik, ein vollkommen anderes Kunstverständnis vorausgesetzt werden muss.34 Dies legitimiert die hier gewählte komparatistische Perspektive auf Konrad von Würzburg, mit dem die Analyse im ersten Viertel des 13. Jhs. einsetzt. Da er hauptsächlich als Referenzpunkt für die nachfolgenden Analysen genutzt wird, beschränkt sich in seinem Fall die Betrachtung auf die Goldene Schmiede und einige Auszüge aus seiner Lyrik. Erstere sichert ein besseres Verständnis der nachfolgenden mariologischen Texte ab, letztere zeigt Konrads vergleichsweise geringes Interesse an der fachsprachlich beeinflussten Textgestaltung, die Frauenlob und Mügeln ausarbeiten werden. Da auch in Konrads epischen Texten wissenschaftlich geprägte Metaphorik selten vorkommt, werden diese von der Analyse ausgeschlossen, um die Vergleichsmöglichkeiten nicht zu verwässern. Es folgen Frauenlob und Heinrich von Mügeln, die bis zum Ende des nächsten Jhs. führen und jeweils ausführlicher analysiert werden. Die Auswahl der Texte Frauenlobs folgt der ausformulierten Programmatik sowie der gegebenen Metaphorik. Damit rückt für programmatische Aussagen des Autor-Ichs Frauenlobs Langer Ton in den Fokus, wohingegen die mimetische Umsetzung dieser Regeln im Marienleich sowie in Minne und Welt betrachtet wird. Den Schwerpunkt der Analyse Heinrichs von Mügeln bietet die erste Hälfte von Der Meide Kranz, die auf thematischer Grundlage von ausgewählten Passagen aus dem Spruchwerk kontrapunktiert wird.
Die enge Nische dichterischen Tuns, deren Ausübende hier vereinfachend als ‚Wissenschaftsdichter‘ tituliert werden sollen, wird verstanden als die Vereinnahmung wissenschaftlicher Terminologie oder auch dessen, was man gemeinhin als wissenschaftliche Methodik auffassen würde, in nicht explizit lehrhafte oder wissenschaftliche Texte oder aber solche, die aus dem Gestus eines wissenschaftlichen Diskurses mit poetischen Mitteln ausbrechen. Dass die wissenschaftliche Methodik und deren Textgattungen vom heutigen Empirismus abweichen, versteht sich zwar von selbst; allerdings sei es an dieser Stelle erwähnt, um auf später auftretende Grauzonen hinzuweisen, deren Bezeichnung als ‚wissenschaftlich‘ uns trotz historischer Perspektive schwerfallen mag. ← 18 | 19 →
Diese noch kurz gefasste Definition weist bereits auf mehrere Schwierigkeiten hin: Woher sollte man beispielsweise die Kenntnis nehmen, dass ein Autor tatsächlich ‚Dichter‘ ist oder dichterische und zugleich wissenschaftliche Absichten hatte? Reicht die Kenntnis des Œuvres aus oder benötigt man Querverweise und Benennungen in anderen Werken, um einen Autor den jeweiligen Diskursen zuordnen zu können?
Da die Grenze zum wissenschaftlichen Diskurs für das Mittelalter noch fließend zu denken ist und man nicht immer mit derart hochspezialisierten Diskursen konfrontiert wird wie in den heutigen Wissenschaften, erweist sich auch diese Einteilung als problematisch. Assunto weist darauf hin, dass ästhetische Schönheit der Kunst, ihre technische Herkunft und das damit einhergehende wissenschaftliche Verständnis mit den philosophischen Bedeutungen des Werkes eine Einheit bilden.35 Ähnlich hält Stackmann für die hier behandelten Dichter fest:
Die kunst des Dichters ist […] – sei es, daß sie mit der Rhetorik zusammenfällt, sei es, daß sie sich als die Quintessenz aller künste darstellt – eine wissenschaftliche Disziplin. Der Dichter unterscheidet sich daher seinem Wesen nach nicht vom Wissenschaftler.36
Eine Koexistenz wissenschaftlicher und poetischer Kenntnis, die unseren heutigen Begriffen nicht mehr innewohnt, muss mitgedacht werden; jedoch bleibt zu differenzieren, ob und wie die Dichter das ihnen zur Verfügung stehende Wissen ausschöpfen. Das Wissen selbst ist noch nicht das Besondere und es trägt auch nicht immer schlicht zur Legitimation der Erzählerautorität oder zur Belehrung bei. Vielmehr muss man die Frage stellen, warum und wie Wissen poetisch umgearbeitet wird.37 Denn die Einheit impliziert ja noch nicht, ← 19 | 20 → dass alle Anteile in sämtlichen Werken gleichermaßen ausgeprägt sein müssen (Man denke an Lukrez und Vergil), sie gehören lediglich zum Selbstverständnis der Autoren. Die isolierte Betrachtung muss folglich auf oben benanntem Textverständnis fußen, sie reklamiert keine Absplitterung, keine neuen Textfunktionen, sondern zeigt eine weitere Perspektive auf Texte, die sonst als schwer verständlich gelten mussten, was ebendiesem Einheitsverständnis geschuldet ist. Die Grenze, welche die hier gegebene Textauswahl einkreist, folgt einem Gestus, der sich durch mehrere Gattungen zieht, sodass man trotz einer feststellbaren Traditionslinie, die die Autoren miteinander verbindet, im Urteil keinen zu großen Fokus auf gattungskonstituierende Attribute legen sollte. Vielmehr gilt es, eine schwer klassifizierbare Gruppierung von Einzelerscheinungen samt Korrelationen zu erkennen, mag sie auch keinem separaten Korpus und keiner Strömung zuzuschreiben sein wie gewisse Topoi der meisterlichen Dichtung, mit denen sie sich überschneidet.
Zudem wird die äußere Form anschaulich zeigen, inwiefern diese Texte zwischen wissenschaftlichem und poetischem Diskurs stehen und damit eine bislang vernachlässigte Grauzone repräsentieren.
Setzt man zur Definition dieser Grauzone Arntzens Literaturbegriff voraus, der Literatur – bzw. genauer episches Dichten – definiert als „Sprechen, das seine eigene Sprachlichkeit begriffen hat“,38 so bleibt in unserem spezifischeren Einzelfall mit Matuschek zu konstatieren: „[Literatur] arbeitet mit und an der Sprache der Lebenswelt, um diese als ein eigenes Erkenntnis- und Orientierungsmittel neben der Wissenschaftssprache lebendig zu halten.“39 Damit steht ein noch nicht objektivierbarer, wenig greifbarer Raum der Literaturwelt neben dem konkretisierbaren Korpus der Wissenschaft. Die verbleibende Lücke wird von Gottfried Gabriel weiter geschlossen: ← 20 | 21 →
Was Dichtung wesentlich meint, wird nicht in ihr gesagt oder als in ihr enthalten mitgeteilt, sondern gezeigt, und zwar in der Weise, dass ein fiktional berichtetes Geschehen aufgrund seiner Fiktionalität den Charakter des Historisch-Einzelnen verliert und auf diese Weise – zu einem Besonderen geworden – einen allgemeineren Sinn aufweist.40
Weiter stellt Gabriel fest:
Wir bestehen nämlich nicht auf der Einlösung des Wahrheitsanspruchs. Wir erwarten vielmehr, dass die poetische Darstellung die Faktenwahrheiten überbietet, indem sie – auf Referenzialisierbarkeit verzichtend – den Inhalten durch eine Richtungsänderung des Bedeutens eine symbolische Bedeutung verleiht.41
Ausgehend von der Prämisse, dass der Literaturdiskurs die „Lebenswelt“ vertritt und somit neben dem Wissenschaftsdiskurs steht, dass die Literatur sich zudem als bewusste Reflexion über die eigene Sprachlichkeit und Existenz definieren lässt, die nicht im Sinne einer linguistischen Analyse zu verstehen ist, bleibt nach Gabriels Analyse mit Blick auf das hier behandelte Korpus eine Lücke; nämlich, dass die Texte zwar ähnlich funktionieren wie hier beschrieben – oder wir das bislang zumindest annehmen mussten –, dass sie jedoch mit Methoden aus dem Diskurs arbeiten, dem sie in obigen Definitionen gegenübergestellt sind. Vereinfacht formuliert versuchen die Texte, das „Besondere“, welches der Konkretheit der Wissenschaft eigentlich widerspräche, durch genau diese darzustellen. Freilich ist diese Grenze im Mittelalter bei weitem nicht so klar gezogen wie heute, sodass man weitere Begriffe hinzuziehen muss als nur Wissenschaft und Lebenswelt oder Modell und Idee:
Als Pflicht ist ihm [dem mittelalterlichen Dichter] auferlegt, nichts von dem abzustreichen, was ihm über die unveränderlichen, Weltlauf und Menschenleben regierenden Gesetze zu erkennen verliehen ist, nichts daran zu verändern und nichts hinzuzutun; daher denn auch Kunst und Wissenschaft im Mittelalter so eng miteinander verbunden sind.42
Mag man Stackmann insofern Recht geben müssen, als die Individualleistung des Dichters meist in der „Wahl des Ausschnitts aus dem Weltganzen“43 liegt, so blendet seine These die Folgen des Überschreitens einer doch wahrgenommenen Gattungsgrenze aus. Es wird zu zeigen sein, dass wissenschaftliche Inhalte – poetisch verarbeitet – nicht immer einen didaktischen Anspruch erheben, aber deshalb nicht gleich als bloße Umarbeitung der Textform ohne weitere Ansprüche ← 21 | 22 → klassifiziert werden können und dass somit noch ein Feld des Gebrauchs von Wissenschaft außerhalb des bisher Gedachten existiert.
Auch wenn Texte und Autoren bislang mit anderen Kriterien beschrieben worden sind, darf eine Überschneidung mit dem Feld, das bis heute als „geblümter Stil“44 zusammengefasst wird, nicht vernachlässigt werden. Die bloße Tatsache, dass das Objekt der Betrachtung teils identisch ist, reichte jedoch nicht aus, um einen Beitrag zu einem nach wie vor unabgeschlossenen Forschungsfeld zu leisten. Denn abweichend von vielen in dieser Forschungstradition stehenden Meinungen möchte ich den Sprachstil, die Sprachreflexion und das oben beschriebene Verhältnis zwischen den Diskurswelten nur ungern unter einem Stil zusammenfassen. Vielmehr muss es das Ziel sein, Stilgesten und Diskurse durch eine weitgestreute Vergleichsanalyse zu erfassen. Dabei soll der fachsprachliche Gestus der Quellen mehr Orientierung bieten als ein Forschungsbegriff, der trotz der Tatsache, dass er Komposita und Neologismen im Verlauf seiner Diskussion vereinnahmt hat, seinen Konnotationen nach zu stark auf die bloße Feststellung von Manierismen fokussiert.45 Vielleicht ist der „ordnende und organisierende Geist“,46 den die ältere Forschung aufgrund der ungeklärten Quellenlage nicht sehen wollte, nicht durch gleichbleibende Analysen gewährleistet. Vielmehr muss sich die Analyse durch Schwerpunktverlagerung dem Korpus angleichen, sodass hier die Räumlichkeit, dort die Mystik, dort die Wissenschaft zur Geltung kommen kann. Schon Nagel betont, dass Stackmann durch seine Einschränkung der Meistersänger auf eine soziologische Sphäre den pragmatischen Vorteil einer ordnenden Übersicht über eine heterogene Autorenreihe mit dem Verlust der ← 22 | 23 → geschichtlichen Diversität bezahlen muss.47 Akzeptiert man die Vielseitigkeit der Texte, löst sich gleich das Problem der Einschätzung, ob es sich im Einzelfall um Zentralthemen handle oder um beiläufige Benennungen ohne Wert,48 da solcherlei einer quantitativ verlagerten Analyse eher auffallen muss als einer Betrachtung des gesamten Korpus.
Das Bild der Blümer wird umso komplexer, wenn man bedenkt, dass ihre Texte im Spannungsfeld des aufkommenden Aristotelismus und sich neu definierender Wissenschaftsdisziplinen entstehen. Die kategoriale Scheidung der Disziplinen wird also nicht immer als Hilfsmittel zum Verständnis herangezogen werden können, soll jedoch als Abstraktum im Hintergrund bleiben, auch wenn dieses teils unbekannten Wandlungen und Einflüssen unterworfen ist. Ziel dieser Arbeit ist daher auch, ein erneutes Bewusstsein für die gewählten Kategorien zu fördern bzw. leichtfertige Interpretationen, die auf modernen Modellen fußen, zu umgehen.
Im Zeitalter der Bindestrich-Disziplinen, die jede erdenkliche Abweichung in einer neuen Kategorie zu verorten ersuchen, fällt es uns aus rein konzeptionellen Gründen schwer, fließende Übergänge und Überschneidungen der Wissenschaften in dem Ausmaß nachzuvollziehen, das dem Mittelalter als selbstverständlich galt. Folglich muss sich der Leser der Literatur, die sich mit den Künsten auseinandersetzt, mit einem System beschäftigen, das sich in interdisziplinärer, diachronischer und inhaltlicher Sicht im Fluss befindet. Die Vereinfachung der Bezeichnung einer Disziplin ist teils notwendig, darf jedoch nicht von der Problematik ablenken, dass auch an diesem Begriff eine Vielzahl von Deutungen hängt und dass schon der hier gewählte Ausschnitt zeitlich wie begrifflich prädestiniert ist, sodass die Ergebnisse der Analyse begrifflich – trotz eventueller Homophonie oder gleichbleibender Metaphorik – nur bedingt auf weitere Autoren übertragbar sind.49 ← 23 | 24 →
Inhaltlich bietet sich dem Wissenschaftshistoriker ein ambivalentes Feld: Die ‚Wissenschaft‘ römischer und frühmittelalterlicher Epochen übernimmt hauptsächlich theoretische Kenntnisse der Griechen, jedoch lässt sich in der Auswahl der rezipierten Disziplinen eine Art Pragmatismus feststellen: Wissenschaftliche Inhalte, die über Grundlagen hinausgingen und keinen praktischen Nutzen für Medizin, Jurisprudenz und Politik oder zumindest für die Schulung des Geistes hatten, wurden kaum wahrgenommen.50 Dem steht hin zum Spätmittelalter eine aufblühende Aristoteles-Rezeption gegenüber, deren Bezeichnung unter Floskeln wie der ‚mittelalterlichen Renaissance‘ schon fast zum Gemeinplatz geworden ist. Weniger offensichtliche rezeptionsgeschichtliche Konsequenzen – wie etwa die spätmittelalterliche neoplatonische Mimesis-Diskussion des Widerspruchs zwischen nicht-schöpferischem platonischem Demiurgen und dessen Präfiguration des christlichen deus creator – können nur als Hintergrund angedeutet werden, dessen Ausläufer sich in der hier betrachteten Dichtung manifestieren.51 Man muss auch eine Tendenz der allegorischen Verfahren hin zur Absicherung durch weltliche Bezüge mitdenken, wenngleich diese Entwicklung bis in die Neuzeit hinein keinen Abschluss finden wird.52 Ein epochaler Umbruch sollte folglich ← 24 | 25 → einbezogen werden, wenn etwa der Einfluss frühmittelalterlicher Kirchenväter besprochen wird, sodass der vereinheitlichende Begriff des Mittelalters nicht zur perspektivischen Verzerrung führt.53 Genauso wenig sollte man wissenschaftsgeschichtlich vereinfachen, indem man davon ausgeht, dass die Lehre mittelalterlicher Universitäten ausschließlich auf die Theologie ausgerichtet war:
Details
- Pages
- 304
- Publication Year
- 2019
- ISBN (Hardcover)
- 9783631778418
- ISBN (PDF)
- 9783631793138
- ISBN (ePUB)
- 9783631793145
- ISBN (MOBI)
- 9783631793152
- DOI
- 10.3726/b15768
- Language
- German
- Publication date
- 2019 (July)
- Keywords
- Metaphorik Fachsprache Wissenschaftsgeschichte Alchemie Spätmittelalter Lyrik
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019. 1 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG