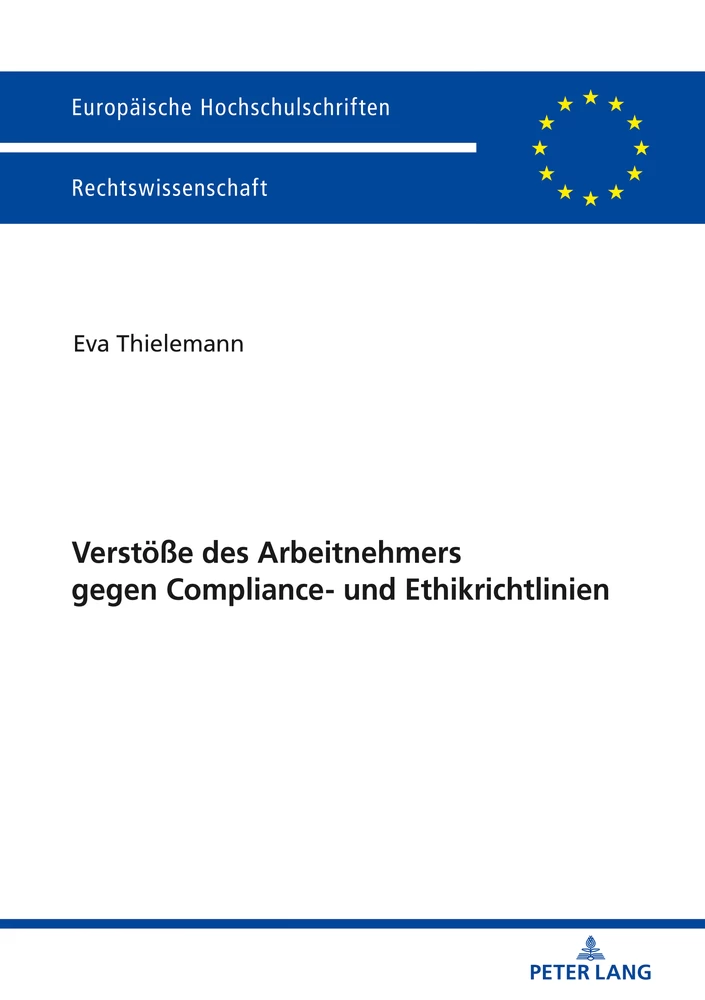Verstöße des Arbeitnehmers gegen Compliance- und Ethikrichtlinien
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Teil: Einleitung und Einführung in Bedeutung, Funktion und Entwicklung von „Compliance- und Ethikrichtlinien“
- A. Einleitung
- B. Untersuchungsgang
- C. Begriffsbestimmungen
- I. „Compliance“
- II. Die Ethikrichtlinie
- III. Das Compliance-System
- D. Die Entwicklung von Compliance-Systemen
- 2. Teil: Rechtlicher Hintergrund von Compliance- und Ethikrichtlinien, Funktion und Implementierung
- A. Rechtsgrundlage für die Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien
- I. Rechtlicher Hintergrund
- 1. Allgemeine Rechtspflicht zur Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien?
- 2. Spezielle gesetzliche Vorschriften zur Einführung eines Compliance-Systems
- a) Anforderungen und Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act (SOX), der Regeln der New York Stock Exchange und des US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) auf deutsche Unternehmen
- b) Rechtsgrundlage aus dem Gesellschaftsrecht
- aa) Allgemeine Vorschrift zur Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien
- bb) Haftungsnormen des Kapitalgesellschaftsrechts als Rechtsgrundlage zur Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien
- (1) „Compliance“ als Ausfluss der allgemeine Organisations- und Leitungspflicht nach dem Aktiengesetzt (AktG)
- (a) Herleitung einer Rechtspflicht zu Compliance aus § 91 II AktG
- (b) Herleitung einer Rechtspflicht zu Compliance aus §§ 76 I, 93 I AktG
- aaa) allgemeine Leitungs- und Organisationspflicht des Vorstandes
- bbb) Bestehen einer Rechtspflicht zu „Compliance“?
- ccc) Zwischenergebnis
- (2) Herleitung einer Rechtspflicht zu Compliance aus § 43 I GmbH-Gesetz
- (3) Zwischenergebnis
- cc) Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)
- dd) § 130 I OWiG
- c) Spezialgesetzliche Compliance im Bank-, Kapitalmarkt- und Aufsichtsrecht
- aa) Bestehen einer Rechtspflicht gemäß § 33 I S. 2 Nr. 1 WpHG
- bb) Organisationspflicht gemäß § 25a KWG
- cc) Anwendbarkeit der § 33 WpHG und § 25a KWG außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche?
- dd) Zwischenergebnis
- d) Die Verortung des „Compliance-Gedankens“ in weiteren Gesetzen
- aa) Versicherungsrecht § 64a VAG (a.F.) und § 29 VAG (n.F.)
- bb) Pharma- und Medizinrecht
- cc) Compliance- und Ethikrichtlinien als geeignete Maßnahmen nach § 12 I, II AGG?
- dd) Arbeitnehmerschutzvorschriften
- 3. Zwischenergebnis
- II. Funktionselemente eines Compliance-Systems
- 1. Schutz- und Risikobegrenzungsfunktion
- 2. Beratung und Information
- 3. Qualitätssicherung
- 4. Kontrolle und Überwachung
- 5. Marketingfunktion
- III. Motivationsanreize zur „freiwilligen“ Einführung von Ethikrichtlinien
- 1. Darstellung der Unternehmenskultur nach Außen
- 2. Spezifische Unternehmensorganisation und Verhalten der Arbeitnehmer
- 3. Prävention von Wirtschaftskriminalität und Schutz des Unternehmens
- 4. Ökonomischer Nutzen
- 5. Erleichterte Sanktionierung rechtswidrigen Verhaltens
- IV. Fazit
- B. Inhalt eines umfassenden Compliance- und Ethikkodex
- I. Allgemeiner Aufbau eines Compliance- und Ethikkodex
- II. Typische Klauseln in einem Compliance- und Ethikkodex
- 1. Beispiele für die Inhalte typischer Klauseln
- 2. Primäre Regelungsbereiche der Verhaltensvorschriften
- a) Regelungen mit ausschließlichem Tätigkeitsbezug
- b) Regelungen mit Bezug auf die Tätigkeit und das sonstige Verhalten
- c) Regelungen zum außerdienstlichen und privaten Verhalten
- C. Implementierung von Compliance- und Ethikrichtlinien
- I. Individualrechtliche Einbeziehung
- 1. Einseitige Einbeziehung: Weisungsrecht des Arbeitgebers nach § 106 GewO
- a) Inhalt und Grenzen des Weisungsrechts
- b) Kenntnisnahme und Überprüfung von arbeitgeberseitig festgelegten Compliance- und Ethikrichtlinien
- c) Entgegenstehende Betriebliche Übung?
- d) Eignung des Weisungsrechts als Implementierungsinstrument von Compliance- und Ethikrichtlinien
- 2. Einvernehmliche Einbeziehung: Gestaltung von Standardarbeitsverträgen
- a) Compliance- und Ethikrichtlinien als formularvertragliche Vereinbarungen
- b) Inhaltskontrolle von Ethikrichtlinien nach § 307 BGB
- c) Verweisungsklauseln auf einen Compliance- und Ethikkodex
- aa) Statische Verweisung eines Arbeitsvertrags auf einen Ethikkodex
- bb) Dynamische Verweisung in einem Arbeitsvertrag auf einen Ethikkodex
- (1) Transparenzgebot nach § 307 I S. 2 BGB im Rahmen der Inhaltskontrolle der dynamischen Verweisungsklausel
- (a) Übertragbarkeit der Rechtsprechung zu dynamischen Verweisungsklauseln im Tarifvertragsrecht?
- (b) Beurteilung der Transparenz einer dynamischen Verweisung
- (2) Inhaltskontrolle der dynamischen Verweisungsklausel
- (a) Anwendbarkeit spezieller Klauselverbote?
- (b) Grundsätzliche unangemessene Benachteiligung durch ein einseitiges Änderungsrecht?
- (c) Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Interessenabwägung
- (d) Zwischenergebnis
- (e) Inhaltliche Anforderungen an die Verweisungsklausel
- (f) Inhaltliche Anforderungen an das Verweisungsobjekt bei dynamischer Verweisung
- (3) Zwischenergebnis
- d) Änderungsvereinbarung
- e) Eignung der vertraglichen Einbeziehung als Implementierungsinstrument von Compliance- und Ethikrichtlinien
- 3. Modifizierung der Vertragspflichten über die Änderungskündigung
- a) Allgemeine Voraussetzungen einer Änderungskündigung
- b) Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien als betriebliches Erfordernis?
- c) Dringlichkeit des betrieblichen Erfordernisses und Ultima-Ratio-Grundsatz
- d) Zwischenergebnis
- e) Eignung der Änderungskündigung als Implementierungsinstrument von Compliance- und Ethikrichtlinien
- II. Beteiligungsrechte des Betriebsrates
- 1. Mitbestimmung bei Ethikrichtlinien
- a) § 87 I Nr. 1 BetrVG: Fragen der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer
- b) § 87 I Nr. 6 BetrVG: Verwendung technischer Einrichtungen
- 2. Rechtsfolgen der Nichtbeachtung
- III. Kollektivrechtliche Einbeziehung
- 1. Betriebsvereinbarung
- a) Umfang der Regelungsbefugnis
- b) Abänderung und Kündigung einer Betriebsvereinbarung
- c) Eignung der Betriebsvereinbarung als Implementierungsinstrument von Compliance- und Ethikrichtlinien
- 2. Tarifverträge
- IV. Zusammenfassung
- 3. Teil: Reaktions- und Sanktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers bei Verstößen des Arbeitnehmers gegen Compliance- und Ethikrichtlinien
- A. Einleitung
- B. Einführung von „Sanktionsklauseln“ in den Compliance- und Ethikkodex
- I. Sanktionsklauseln mit den für den Arbeitnehmer vorhersehbaren „klassischen“ Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers
- II. Sanktionsklauseln mit den für den Arbeitnehmer nicht vorhersehbaren weiteren Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers
- III. Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Sanktionsklauseln
- IV. Pflicht zur Sanktionierung von Verstößen gegen Compliance- oder Ethikrichtlinien?
- 1. Pflicht zum Tätigwerden aufgrund von Schutzpflichten gegenüber anderen Arbeitnehmern
- 2. Pflicht zum Tätigwerden aufgrund des Schutzes von Unternehmensinteressen
- V. Fazit
- C. Whistleblowing
- I. Bedeutung des Whistleblowing
- 1. Erscheinungsformen des Whistleblowing
- 2. Whistleblowing im Spannungsfeld zwischen Anzeige- und Verschwiegenheitspflicht
- a) Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
- aa) Gesetzliche Unterrichtungspflichten
- bb) Vertragliche Nebenpflicht zur Auskunft
- cc) Auskunftspflicht bei auch bei Selbstbelastung?
- b) Arbeitsvertragliche Verschwiegenheitspflichten und Durchbrechung durch Anzeigerechte des Arbeitnehmers
- 3. Typen von Whistleblowingklauseln in Compliance- und Ethikkodizes
- II. Whistleblowing als Sanktionsgrund
- 1. Externes Whistleblowing in der Rechtsprechung
- 2. Internes Whistleblowing als Sanktionsgrund
- III. Fazit
- D. Unternehmensinterne Untersuchungen gegenüber den Arbeitnehmern
- I. Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung und Recht zur Kontrolle
- II. Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung und deren Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 1. Maßnahmenübergreifende Grundsätze und Grenzen einer unternehmensinternen Untersuchung
- a) Grundrechtsbezug der Ermittlungsmaßnahmen
- b) Anwendbarkeit strafprozessualer Grundsätze bei unternehmensinternen Untersuchungen
- aa) Problemaufriss
- bb) Anwendbarkeit des strafprozessualen Grundsatzes „nemo tenetur“ als Schweigerecht im Privatrechtsverhältnis?
- cc) Fazit
- c) Datenschutzrecht im Beschäftigungsverhältnis
- aa) Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im Beschäftigungsverhältnis
- bb) Sonderdatenschutzrecht des Telekommunikationsgesetzes
- cc) Datenschutz im internationalen Datenverkehr
- dd) Fazit
- 2. Ausgewählte Maßnahmen unternehmensinterner Untersuchungen
- a) Aufsuchen am Arbeitsplatz und Einsehen der Personalakte
- b) Zugriff auf Unterlagen in Papierform
- c) Zugriff auf Unterlagen in elektronischer Form (Dateien)
- d) Auswertung von elektronischer Kommunikation (E-Mails) und Internetnutzung
- e) Telefonüberwachung
- f) Mitarbeiterinterviews
- g) Videoüberwachung
- h) Detektiveinsatz
- III. Mitbestimmungsrechte
- IV. Sanktion bei fehlender Mitwirkung
- V. Kronzeugen- oder Amnestieregelungen als Reaktion auf nicht aufgeklärte Verstöße gegen Compliance- und Ethikrichtlinien
- E. „Klassische“ auf Beendigung gerichtete individualvertragliche Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers
- I. Compliance-indizierte Besonderheiten bei einer Kündigung wegen Verstoßes gegen Compliance- und Ethikrichtlinien
- 1. Vertragsverletzung: Keine Vereinbarung absoluter Kündigungsgründe in einer Sanktionsklausel
- 2. Einordung der Kündigung: Sanktion oder Reaktion?
- 3. Abmahnung des Fehlverhaltens als Voraussetzung der verhaltensbedingten Kündigung
- a) Funktion der Abmahnung
- aa) Abmahnung als Voraussetzung der Kündigung
- bb) Abmahnung mit eigenem Sanktionscharakter?
- b) Entbehrlichkeit der Abmahnung
- c) Möglichkeit einer „vorweggenommenen Abmahnung“ in der Sanktionsklausel einer Compliance- und Ethikrichtlinie?
- aa) 1. Konstellation: Entbehrliche Abmahnung
- bb) 2. Konstellation: Notwendige Abmahnung
- (1) Erfüllen der Hinweis- und Warnfunktion?
- (2) Notwendige Individualität der Abmahnung?
- (3) Verhältnismäßigkeit der „vorweggenommenen Abmahnung“
- cc) Fazit
- 4. Rückgriff auf kollektivrechtliche Sanktionsmaßnahmen als „milderes Mittel“ zur Beendigung?
- 5. Relevanz der Compliance- und Ethikrichtlinien für die Interessenabwägung
- 6. Verstoß gegen Compliance- und Ethikrichtlinien als wichtiger Grund im Sinne des § 626 I BGB?
- 7. Bestimmung des Beginns der Kündigungserklärungsfrist des § 626 II BGB im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen
- II. Verdachtskündigung als Beendigungsinstrument bei nicht aufklärbaren Verstößen
- 1. Verdacht
- 2. Anhörung
- III. Der Aufhebungsvertrag als Alternative zur Kündigung
- IV. Fazit
- F. Weitere individualrechtliche Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers mit Auswirkung auf den Inhalt des Arbeitsverhältnisses
- I. Zulässigkeit weiterer Reaktionsmaßnahmen auf Compliance- und Ethikrichtlinienverstöße
- 1. Verstoß gegen das allgemeine Maßregelungsverbot des § 612 a BGB
- 2. Verbot der „Anprangerung“
- II. Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer
- III. Die Ermahnung
- IV. Vermögenswirksame Nachteile
- 1. Verlust von freiwilligen oder variablen Entgeltbestandteilen
- 2. Entzug von Vorteilen
- 3. Fazit
- V. Versetzung des Arbeitnehmers
- 1. Zulässigkeit einer Versetzung
- a) Versetzung im Rahmen des Weisungsrechts
- b) Erhaltung und Erweiterung des Rechts zur Versetzung
- 2. Die Versetzung als milderes Mittel vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung?
- 3. Rück- oder Umgruppierung verbunden mit einer Versetzung
- VI. Suspendierung von der Arbeit
- VII. Verpflichtende Teilnahme an Schulungen und Auswirkungen auf die Karriere
- VIII. Fazit
- G. „Besondere“ individualvertraglich und kollektivrechtlich vorbehaltene disziplinarische Reaktions- und Sanktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers
- I. Die Vertragsstrafe nach §§ 339 ff. BGB als individualrechtliche „besondere“ Sanktionsmöglichkeit
- 1. Funktion und Inhalt der Vertragsstrafe im Allgemeinen
- a) Bifunktionalität der Vertragsstrafe
- b) Rechtsnatur und Inhalt der Vertragsstrafabrede
- aa) Die Vertragsstrafe als unselbstständiges Leistungsversprechen
- bb) Zu erbringende Leistung
- cc) Auslöser der Vertragsstrafe
- dd) Verhältnis der Vertragsstrafe zu Regelungen in Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung
- 2. Zulässigkeit von formularvertraglichen Vertragsstrafen im Arbeitsrecht
- a) Eröffnung der Inhaltskontrolle nach § 307 III BGB
- b) Grundsätzliche Zulässigkeit von formularvertraglichen Vertragsstrafen im Arbeitsrecht nach der Wertung des § 310 IV S. 2 BGB
- c) Berechtigtes Interesse des Arbeitgebers nach § 307 I S. 1 BGB
- d) Zwischenergebnis
- 3. Einzelne Wirksamkeitsanforderungen an die formularvertragliche Vertragsstrafe
- a) Inhaltskontrolle nach § 307 I BGB
- aa) Anforderungen an die Formulierung – Transparenzgebot und Bestimmtheitsgrundsatz nach § 307 I S. 2 BGB
- bb) Bestimmung der angemessenen Strafhöhe bei Compliance- und Ethikrichtlinienverstößen
- cc) Möglichkeit der Herabsetzung der formularvertraglichen Strafe nach § 343 BGB?
- b) Verschuldensabhängigkeit der formularvertraglichen Vertragsstrafe?
- c) Zwischenergebnis
- 4. Entstehen des Strafanspruchs durch Verwirkung
- 5. Verhältnis der Vertragsstrafe zu anderen Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers
- a) Verhältnis des Vertragsstrafversprechens zu Primär- und Sekundäransprüchen bei Leistungsstörung
- b) Verhältnis der Vertragsstrafe zur Abmahnung
- c) Verhältnis der Vertragsstrafe zu weiteren individualrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten
- 6. Ergebnis
- II. Die Betriebsbuße als kollektivrechtliche Sanktionsmöglichkeit
- 1. Entwicklung unter dem Stichwort der „Betriebsjustiz“
- 2. Die Rechtsnatur und Rechtsgrundlage der Betriebsbuße
- a) Rechtsnatur: Privatstrafe in Abgrenzung zur Kriminalstrafe
- b) Rechtsgrundlage der Betriebsbuße
- aa) Abzulehnende Rechtsgrundlagen
- bb) Die Vertragsstrafe als Rechtsgrundlage?
- cc) Die kollektivrechtliche Rechtsgrundlage aus §§ 87, 88 BetrVG
- c) Fazit
- 3. Zulässigkeitsanforderungen an eine Betriebsbuße und ihre Grenzen
- a) Sperrregelung des § 87 I Hs. 1 BetrVG
- b) Regelungskompetenz der Betriebspartner aus § 87 I BetrVG
- c) Rechtsstaatliche Grundsätze
- 4. Der Inhalt einer Betriebsbußordnung und die möglichen Bußen
- a) Rüge des Verstoßes gegen die kollektive Ordnung
- aa) formelle Missbilligung und Verwarnung
- bb) Abgrenzung zur individualrechtlichen Abmahnung
- b) Verweis und strenger Verweis
- c) Ausschluss von betrieblichen Vergünstigungen
- d) Ausschluss von Beförderungen oder Gehaltserhöhungen
- e) Geldbuße
- 5. Verhängung von Betriebsbußen
- a) Zuständigkeit
- b) Verfahren
- c) Durchsetzung der Betriebsbuße
- 6. Verhältnis der Betriebsbuße zu anderen Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers auf Compliance- und Ethikrichtlinienverstöße
- a) Verhältnis der Betriebsbuße zur Kriminalstrafe
- b) Verhältnis der Betriebsbuße zu individualrechtlichen Reaktionsmaßnahmen, insbesondere der Abmahnung
- c) Verhältnis der Betriebsbuße zu Schadensersatzforderungen
- d) Verhältnis der Betriebsbuße zur Vertragsstrafe
- 7. Zusammentreffen mehrerer Maßnahmen bei einem Compliance- und Ethikrichtlinienverstoß mit Bezug zur kollektiven Ordnung
- 8. Ergebnis
- 4. Teil: Thesen der Untersuchung
- Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
D. Die Entwicklung von Compliance-Systemen
2. Teil: Rechtlicher Hintergrund von Compliance- und Ethikrichtlinien, Funktion und Implementierung
A. Rechtsgrundlage für die Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien
1. Allgemeine Rechtspflicht zur Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien?
2. Spezielle gesetzliche Vorschriften zur Einführung eines Compliance-Systems
b) Rechtsgrundlage aus dem Gesellschaftsrecht
aa) Allgemeine Vorschrift zur Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien
(a) Herleitung einer Rechtspflicht zu Compliance aus § 91 II AktG
(b) Herleitung einer Rechtspflicht zu Compliance aus §§ 76 I, 93 I AktG
aaa) allgemeine Leitungs- und Organisationspflicht des Vorstandes
bbb) Bestehen einer Rechtspflicht zu „Compliance“?
(2) Herleitung einer Rechtspflicht zu Compliance aus § 43 I GmbH-Gesetz
cc) Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)
c) Spezialgesetzliche Compliance im Bank-, Kapitalmarkt- und Aufsichtsrecht
aa) Bestehen einer Rechtspflicht gemäß § 33 I S. 2 Nr. 1 WpHG
bb) Organisationspflicht gemäß § 25a KWG
cc) Anwendbarkeit der § 33 WpHG und § 25a KWG außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche?
d) Die Verortung des „Compliance-Gedankens“ in weiteren Gesetzen
aa) Versicherungsrecht § 64a VAG (a.F.) und § 29 VAG (n.F.)
cc) Compliance- und Ethikrichtlinien als geeignete Maßnahmen nach § 12 I, II AGG?
dd) Arbeitnehmerschutzvorschriften
II. Funktionselemente eines Compliance-Systems
1. Schutz- und Risikobegrenzungsfunktion
III. Motivationsanreize zur „freiwilligen“ Einführung von Ethikrichtlinien
1. Darstellung der Unternehmenskultur nach Außen
2. Spezifische Unternehmensorganisation und Verhalten der Arbeitnehmer
3. Prävention von Wirtschaftskriminalität und Schutz des Unternehmens
5. Erleichterte Sanktionierung rechtswidrigen Verhaltens
B. Inhalt eines umfassenden Compliance- und Ethikkodex
I. Allgemeiner Aufbau eines Compliance- und Ethikkodex
II. Typische Klauseln in einem Compliance- und Ethikkodex
1. Beispiele für die Inhalte typischer Klauseln
2. Primäre Regelungsbereiche der Verhaltensvorschriften
a) Regelungen mit ausschließlichem Tätigkeitsbezug
b) Regelungen mit Bezug auf die Tätigkeit und das sonstige Verhalten
c) Regelungen zum außerdienstlichen und privaten Verhalten
C. Implementierung von Compliance- und Ethikrichtlinien
I. Individualrechtliche Einbeziehung
1. Einseitige Einbeziehung: Weisungsrecht des Arbeitgebers nach § 106 GewO
a) Inhalt und Grenzen des Weisungsrechts
b) Kenntnisnahme und Überprüfung von arbeitgeberseitig festgelegten Compliance- und Ethikrichtlinien
c) Entgegenstehende Betriebliche Übung?
d) Eignung des Weisungsrechts als Implementierungsinstrument von Compliance- und Ethikrichtlinien
2. Einvernehmliche Einbeziehung: Gestaltung von Standardarbeitsverträgen
a) Compliance- und Ethikrichtlinien als formularvertragliche Vereinbarungen
b) Inhaltskontrolle von Ethikrichtlinien nach § 307 BGB
c) Verweisungsklauseln auf einen Compliance- und Ethikkodex
aa) Statische Verweisung eines Arbeitsvertrags auf einen Ethikkodex
bb) Dynamische Verweisung in einem Arbeitsvertrag auf einen Ethikkodex
(a) Übertragbarkeit der Rechtsprechung zu dynamischen Verweisungsklauseln im Tarifvertragsrecht?
(b) Beurteilung der Transparenz einer dynamischen Verweisung
(2) Inhaltskontrolle der dynamischen Verweisungsklausel
(a) Anwendbarkeit spezieller Klauselverbote?
(b) Grundsätzliche unangemessene Benachteiligung durch ein einseitiges Änderungsrecht?
(c) Arbeitsrechtliche Besonderheiten der Interessenabwägung
(e) Inhaltliche Anforderungen an die Verweisungsklausel
(f) Inhaltliche Anforderungen an das Verweisungsobjekt bei dynamischer Verweisung
3. Modifizierung der Vertragspflichten über die Änderungskündigung
a) Allgemeine Voraussetzungen einer Änderungskündigung
b) Einführung von Compliance- und Ethikrichtlinien als betriebliches Erfordernis?
c) Dringlichkeit des betrieblichen Erfordernisses und Ultima-Ratio-Grundsatz
II. Beteiligungsrechte des Betriebsrates
1. Mitbestimmung bei Ethikrichtlinien
a) § 87 I Nr. 1 BetrVG: Fragen der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer
b) § 87 I Nr. 6 BetrVG: Verwendung technischer Einrichtungen
2. Rechtsfolgen der Nichtbeachtung
III. Kollektivrechtliche Einbeziehung
a) Umfang der Regelungsbefugnis
b) Abänderung und Kündigung einer Betriebsvereinbarung
B. Einführung von „Sanktionsklauseln“ in den Compliance- und Ethikkodex
III. Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Sanktionsklauseln
IV. Pflicht zur Sanktionierung von Verstößen gegen Compliance- oder Ethikrichtlinien?
1. Pflicht zum Tätigwerden aufgrund von Schutzpflichten gegenüber anderen Arbeitnehmern
2. Pflicht zum Tätigwerden aufgrund des Schutzes von Unternehmensinteressen
I. Bedeutung des Whistleblowing
1. Erscheinungsformen des Whistleblowing
2. Whistleblowing im Spannungsfeld zwischen Anzeige- und Verschwiegenheitspflicht
a) Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
aa) Gesetzliche Unterrichtungspflichten
bb) Vertragliche Nebenpflicht zur Auskunft
cc) Auskunftspflicht bei auch bei Selbstbelastung?
3. Typen von Whistleblowingklauseln in Compliance- und Ethikkodizes
II. Whistleblowing als Sanktionsgrund
1. Externes Whistleblowing in der Rechtsprechung
2. Internes Whistleblowing als Sanktionsgrund
D. Unternehmensinterne Untersuchungen gegenüber den Arbeitnehmern
I. Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung und Recht zur Kontrolle
II. Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung und deren Zulässigkeitsvoraussetzungen
1. Maßnahmenübergreifende Grundsätze und Grenzen einer unternehmensinternen Untersuchung
a) Grundrechtsbezug der Ermittlungsmaßnahmen
b) Anwendbarkeit strafprozessualer Grundsätze bei unternehmensinternen Untersuchungen
c) Datenschutzrecht im Beschäftigungsverhältnis
aa) Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im Beschäftigungsverhältnis
bb) Sonderdatenschutzrecht des Telekommunikationsgesetzes
cc) Datenschutz im internationalen Datenverkehr
2. Ausgewählte Maßnahmen unternehmensinterner Untersuchungen
Details
- Seiten
- 304
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (Paperback)
- 9783631739433
- ISBN (PDF)
- 9783631739792
- ISBN (ePUB)
- 9783631739808
- ISBN (MOBI)
- 9783631739815
- DOI
- 10.3726/b12776
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (September)
- Schlagworte
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen Sanktionsklauseln Betriebsbuße Vertragsstrafe nemo tenetur Internal Investigation
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. 303 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG