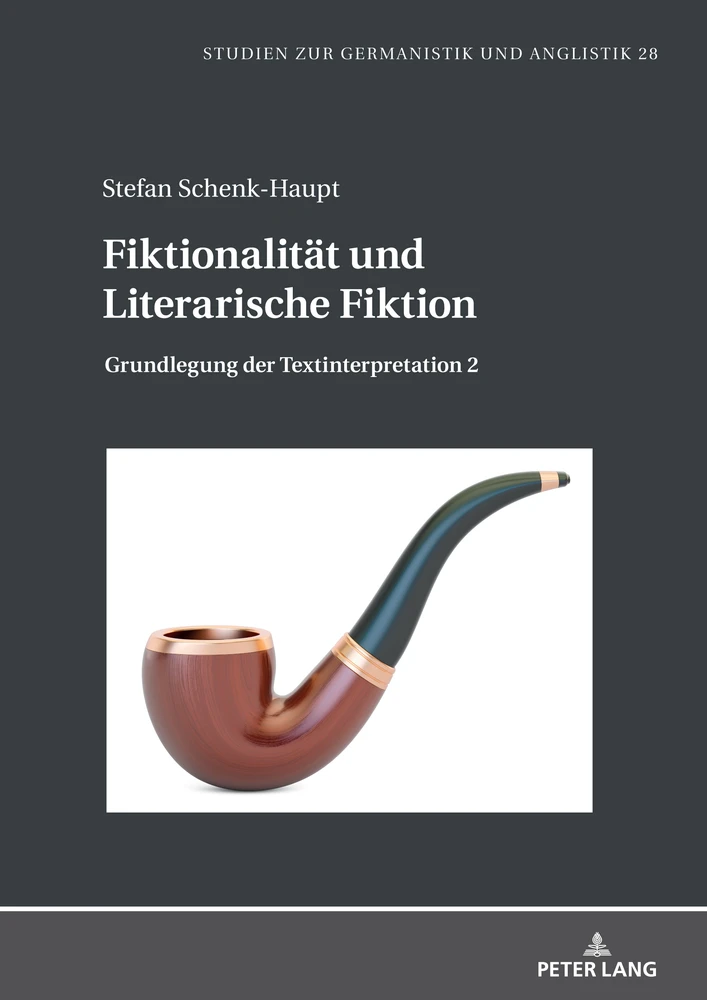Fiktionalität und Literarische Fiktion
Grundlegung der Textinterpretation 2
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Siglen und Diakritika
- Teil I Einleitung. Das Fiktionalitätsproblem: Darstellung und Modalität
- 1. Vorbetrachtungen
- 2. Modalisierung: Überlegungen zur Struktur des Fiktionalen
- 3. Der Status der fiktionalen ‚Welt‘
- 4. Das Begriffsfeld des Fiktionalen
- 4.1. Die Gebrauchsweisen des Fiktionsbegriffs
- 4.2. Die Gebrauchsweisen des Fiktionalitätsbegriffs
- 5. Fiktionalität: Was ist Literatur? Was ist ein literarischer Text?
- 6. Zum Stand der Forschung: Ansätze zur Fiktionalitätstheorie
- 6.1. Ontologische Ansätze: Erfundenheit und ihre Differenz zum Realen
- 6.2. Pragmatische Ansätze: Quasi-Aussagen und Performanz
- 6.3. Referenztheoretische Ansätze: Wirklichkeitsbezug und Wirklichkeitsbereiche
- 6.4. Persuasive Ansätze: Make-believe, Rollenspiel, Illusionsbildung
- 6.5. Modallogische Ansätze: So tun als ob
- 6.5.1 Die Theorie möglicher Welten (possible worlds)
- 6.5.2 Mental Spaces
- 6.6. Fiktionalismus: Alles ist Fiktion
- 6.7. Spieltheoretische Ansätze
- 6.8. Relevanz
- 7. Schlußfolgerungen für eine Mechanik des Fiktionalen
- Teil II Theoretische Untersuchung des Fiktionalen
- 1. Die Phänomenalität des Fiktionalen
- 2. Was heißt Darstellen? Was heißt ‚bildhafte‘ Darstellung?
- 2.1. Mimesis – Neukonzeptualisierung eines belasteten Begriffs
- 2.2. Kritik der Repräsentation
- 3. Zeichentheoretische Grundlagen
- 3.1. Exkurs zur ‚Wirklichkeit‘
- 3.2. Schlußfolgerungen für die Theorie des Fiktionalen
- 4. Phänomenologische Grundlegung
- 4.1. Der Begriff des Phänomens und die Akte des Bewußtseins
- 4.2. Bewußtsein
- 4.3. Die phänomenologische Methode der Reduktion
- 4.3.1 Die Einklammerung der natürlichen Einstellung
- 4.3.2 Eidetische und transzendentale Reduktion
- 4.3.3 Die sprachliche Destrukturation der Begriffe
- 4.4. Welt in Erkenntnis übersetzen: Kategoriale Anschauung
- 4.5. Sprache und Erkenntnis: Kategoriale Indizes
- 4.5.1 Der hermeneutische Operator (OpH)
- 4.5.2 Der fiktionale Operator (OpF)
- 4.6. Zusammenfassung des Bisherigen und Schlußfolgerungen
- 5. Theoretisierung des Fiktionalen nach phänomenologischen Gesichtspunkten
- 5.1. Das Phänomen der Fiktion
- 5.2. Der weiße Raum – Poietik der fiktionalen Welt
- 5.2.1 Die Origo
- 5.2.2 Exkurs: Zur Widerlegung der Theorie möglicher Welten (PWT)
- 5.2.3 Die fiktionalen Gegenstände im abstrakten Diskursraum
- 5.3. Fiktionale Aussagen: Die Sprechaktklasse der Konstitutiva
- 5.4. Rahmung
- 5.5. Projektion
- 5.5.1 Literarische Fiktionalität als Diskursmodus
- 5.5.2 Die ästhetische Erfahrung
- Teil III Interpretationsteil
- 1. Fiktionale und faktuale Interferenz: Alexander Popes Epistle to Miss Blount
- 2. Authentifikation in der Lyrik: Milton, Wordsworth, Mandelstam
- 3. Formelle, informelle, fiktionale und fiktive Biographie und Autobiographie
- 4. Historiographie versus Literarizität in Shakespeares Macbeth
- 5. Die Aufhebung des Wirklichen in Daniel Defoes Journal of the Plague Year
- 6. Realismus und Anti-Realismus in Charles Dickens’ Bleak House
- 7. Fiktionale Zerstörungswut: Samuel Becketts Comment c’est/How It Is
- Teil IV Schlußteil
- 1. Zusammenfassung
- 2. Exkurs zur Vereinheitlichung der begriffstheoretischen Grundlagen
- 3. Ausblick
- Literaturverzeichnis
Teil I – Einleitung. Das Fiktionalitätsproblem: Darstellung und Modalität
1. Vorbetrachtungen
Mitte der 1990er Jahre wurde an der Universität Kiel eine mündliche Prüfung im Fach Britische Literaturwissenschaft abgehalten. Eines der Themen war Shakespeares Hamlet, und die Prüfung verlief ausgezeichnet. Zum Abschluß stellte der Erstprüfer eine launige Frage: „Wenn Hamlet jetzt durch die Tür dieses Seminarraums kommen würde, was würden Sie ihn dann fragen?“ Der Student war verunsichert ob dieser unerwarteten Frage und antwortete dann: „Ich würde ihn nach seinem Seminarausweis fragen.“ Daraufhin empörte sich der Prüfer über alle Maßen und wies den Prüfling rüde solange zurecht, bis der Zweitprüfer einwandte: „Herr Kollege, ich fand die Antwort gar nicht so schlecht.“1
Was war hier passiert? Statt weiter über die Text- und Interpretationsprobleme bezüglich des Dramas von Shakespeare zu handeln, wechselte der Prüfer die Kategorie und befragte den zu Prüfenden hinsichtlich eines ‚nicht existierenden‘ Gegenstands, in diesem Fall zur Figur Hamlet. Da sich der Prüfling nun beim besten Willen nicht vorstellen konnte, was er einen zur Person gewordenen Hamlet sinnvoll fragen konnte, vollzog er den Kategorienwechsel und stellte auf der ontologischen Ebene die Frage nach einer Identifikation Hamlets: Könnte dieser sich ausweisen und damit als existierende Person zu erkennen geben? Damit machte der Student die offenkundige Absurdität der Konstellation deutlich, und dies verärgerte den Prüfenden. Warum aber fühlte sich dieser nun derart vorgeführt? Er war sich des Kategorienwechsels zum ontologischen Status der Figur Hamlet offenbar nicht so richtig bewußt gewesen. Er nahm Shakespeares Drama Hamlet und alle darin dargestellten Gegenstände und Geschehnisse als eine fiktionale Erfahrungstatsache hin – über die er sich nun mit seinem Studenten austauschen wollte, gewissermaßen zur Lösung der Anspannung und als Trittbrett zum Abschluß der gelungenen Prüfung mit einem kleinen Bonmot.
Mit Abstand kann man die Haltung des Professors als naiv, die des Studenten als wesenhaft rational und aufgeklärt bewerten. Dabei wäre eine Antwort im Sinn des Prüfers sicherlich nicht schwergefallen, so beispielsweise: „Warum hast du [also Hamlet] Claudius nicht in der dritten Szene des dritten Akts getötet?“ Hamlet hat im Stück zu diesem Zeitpunkt alles erreicht, was er sich nur wünschen könnte: Er hat den König mit Hilfe des Spiels im Spiel derart verunsichert, daß er, Hamlet, im Anschluß sogar Zeuge von Claudius’ Geständnis beim Gebet wird. Der Tatbestand ist nun eindeutig, der Geist hat nicht gelogen und die Gelegenheit ist günstig. Die im Text gegebene Motivation – Claudius könnte durch den Akt des Gestehens im Gebet nicht die gerechte Strafe in der Hölle ereilen, sondern ungerechterweise zum Himmel aufsteigen – ist eine offensichtlich vorgeschobene.2
Aus literaturpsychologischer Sicht wäre es sogar interessant, Aufschluß über Hamlets Denken zu erhalten. Dieser Ansatz übersieht jedoch zwei Dinge: Erstens gibt es keinerlei Informationen über die Darstellungsgegenstände eines Textes hinaus, die der Text nicht selber anböte – insbesondere hinsichtlich eines nur imaginierten Bewußtseins. Zum zweiten geht die Frage am Text vorbei: Selbst wenn wir eine bessere Motivation erführen, würde uns das nicht mehr über das Stück verraten. Hamlet bringt Claudius zunächst einmal deshalb nicht um, weil das Stück dann vorbei wäre, und zwei Akte braucht es nun einmal noch. Man könnte viel sinnvoller Shakespeare fragen, warum er die Bekenntnisszene überhaupt in das Stück eingebaut hat, weil sie doch offensichtlich das erzeugt, was wir heute ein plot hole nennen.
Der Prüfer hat aus einer Bewußtseinssituation des noch andauernden Rezeptionsakts gesprochen: Er war gewissermaßen ‚im Stück drin‘. Der Prüfling, für den es in der Prüfungssituation strukturell um wesentlich mehr und wesentlich andere Dinge ging, hat dies nicht mitvollzogen. Er gab eine ‚technische‘ Antwort. Der resultierende Zusammenstoß der fiktionalen Erfahrungstatsache mit der Haltung der ontologischen Analyse ist für die folgende Untersuchung überaus aufschlußreich. Man faßt das Phänomen des Fiktionalen unterschiedlich auf, je nach der gerade zuhandenen ‚Einstellung‘ des Bewußtseins.
Ich möchte an dieser Stelle ein weiteres, anders gelagertes Beispiel geben. Am 14. Januar 1997 gab der englische Lyriker David Constantine eine Lesung seiner Gedichte an der Universität Hamburg. Er las unter anderem sein Sonett Christ to Lazarus sowie längere Passagen aus seinem langen Gedicht Caspar Hauser.3 Diese und viele andere Texte warten mit Figuren und Darstellungsgegenständen auf, die bezüglich des 1944 in Lancashire geborenen Autors zeitlich und kulturell meist weit entlegen sind. Als die Anwesenden die Gelegenheit zu Fragen erhielten, wollte ich von Constantine wissen, warum er sich für derart entlegene Figuren interessiere und warum sie ihm offenkundig so am Herzen lagen, denn er hatte sich in den kurzen Einleitungen zu seinen eigenen Texten mit auffälligem emotionalen Affekt geäußert. Constantine antwortete, daß ihm diese Figuren viel näherstünden als Personen aus seinem Umkreis, man könne sogar sagen, sie seien für ihn „more real than actual people“.
Ich deute dies so, daß die fiktionale Erfahrungssituation, die über den literarischen Text hergestellt wird, einem Lyriker wie Constantine die Möglichkeit gibt, viel tiefer in den ‚Geist‘ eines Gegenübers einzutauchen und in eine Art Kommunikation einzutreten, obwohl die historischen Personen schon lange entschwunden sind und uns nur noch imaginär gegenüberstehen. Offenbar erlaubt der literarische Text eine gänzlich anders geartete Reflexion der Dinge dieser Welt, eine ästhetische Reflexion, die einen gänzlich eigenen Mehrwert mit sich bringt im Vergleich zur philosophischen oder historiologischen Reflexion und auch im Vergleich zum alltäglichen Gespräch mit einem lebendigen Gegenüber. Dieser ‚Mehrwert‘, den das Fiktionale mit sich bringt, ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
2. Modalisierung: Überlegungen zur Struktur des Fiktionalen
Fiktionalität ist ein Bewußtseinsphänomen. Als solches produziert es Bewußtseinstatsachen, die strukturell den empirischen Bewußtseinstatsachen gleichkommen. Das Fiktionale und das Faktische – bzw. die Darstellung des Faktischen – bilden zwei Klassen von Erfahrungen, die im reflektierenden Bewußtsein zu verorten sind. Empirische Bewußtseinstatsachen sind anhand der Interaktion mit unserer Umwelt nachprüfbar und verifizierbar. Für fiktionale Bewußtseinstatsachen gilt dies nicht bzw. allenfalls nur unter veränderten Bedingungen. Gleichwohl wird schon an diesem Punkt offenkundig, daß fiktionale Bewußtseinstatsachen nur eine bestimmte Erscheinungsform dessen sind, was wir als „Fiktion“ bezeichnen. Nicht jede Art von Fiktion führt auch zu einer fiktionalen Bewußtseinstatsache.
Das Fiktionale ist umgekehrt angewiesen auf die konstituierenden Akte des Bewußtseins. Diese Angewiesenheit wird, so weit ich sehe, in den gegenwärtigen Debatten um Fiktionalität nicht zureichend bedacht oder gar unzulässig verkürzt. Denn dann kann nicht mehr einsichtig gemacht werden, wie wir uns über ‚nicht-existierende‘ Gegenstände überhaupt verständigen können – so etwa Hamlet oder Elsinore oder auch Hamlets präsupponierbare Lehrer in Wittenberg, die im Stück gar nicht genannt werden.
Daher greifen die Bemühungen um eine Reaktivierung des Rhetorischen, um die literarische Fiktionalität schärfer zu fassen (Phelan, 1989a und 1989b; Walsh, 2003, 2005, 2007; Nielsen, 2012), zu kurz. Ihre Vorschläge bleiben angewiesen auf Fiktionssignale, was die Reaktivierung der Autorinstanz in personam nach sich zieht: Wir müssen wissen, wer wann welchen Text mit welcher Intention geschrieben hat; und diese konkrete Intentionalität entscheidet dann über die Fiktionalität des Textes. Das entspricht nicht der gängigen Praxis der Literaturrezeption; und solche Postulate sind in dieser scharfen Form gar nicht notwendig.
Das Fiktionale kann einfacher und eleganter gefaßt werden als eine spezifische Projektionsleistung durch das Bewußtsein – des Textproduzenten wie auch des Textrezipienten. Die erfolgreiche Verständigung über den fiktionalen oder nicht-fiktionalen Charakter eines Textes kann dann weiterhin untersucht werden als Übereinstimmung oder Abweichung zwischen dem Akt des Verfassens und dem Akt der Kenntnisnahme eines Textes. Beide sind aber nicht entscheidend für die Fiktionalität des Textes. Entscheidend bleibt der Text selbst in seinem Vermögen zur fiktionalen wie nicht-fiktionalen Auffaßbarkeit. Damit ist Folgendes gemeint: Das Wesentliche in einer Aufarbeitung des Phänomens des Fiktionalen besteht darin, ein Untersuchungsinstrumentarium bereitzustellen, mit Hilfe dessen man die fiktionalen und nicht-fiktionalen Gehalte eines jeweiligen Textes herausarbeiten kann.
Die fiktionalen Bewußtseinstatsachen haben ihren – originären – Ort jeweils in einer modalen, nicht empirisch existierenden Version unserer Welt. Mit ‚Welt‘ meine ich an dieser Stelle unsere empirische Erfahrungswirklichkeit, das, was wir ‚Realität‘ nennen. Die Modalisierung unserer Welt hat ihren Grund in der Textualität des literarischen Artefakts: Stets bildet der Text die Auslösungsstruktur für fiktionale Bewußtseinstatsachen.
Der Unterschied zu faktualen Texten, zu ‚Sachtexten‘, läßt sich folgendermaßen beschreiben: Statt in den Referenzbereich des Empirisch-Faktischen werden fiktionale Darstellungsgegenstände in einen ästhetisch verfaßten mentalen Raum projiziert. Für ihn gelten zwei Referenzrahmen gleichzeitig. Der erste ist der Bereich, in welchem faktische Erfahrungswirklichkeit (‚Realität‘) und fiktionale Erfahrungswirklichkeit überlappen – das ist also alles jenes, was nicht ‚erfunden‘ oder qua poetische Lizenz modalisiert worden ist, z.B. die Gesetze der Physik, historische Begebenheiten und Personen (Christus, Jeanne d’Arc, Napoleon, Kaspar Hauser) und auch die grundsätzliche Funktion der sprachlichen Prädikation. Letzteres bedeutet, daß beispielsweise alle Signifikationen der Farbgebung und der Himmelsrichtungen dieselben sind – ohne daß an dieser Stelle etwas über einen etwaigen symbolischen Gehalt im literarischen Text gesagt wäre. ‚Norden‘ ist eben Norden, und ‚Rot‘ ist eben Rot im literarischen Text wie in der realen Erfahrungswirklichkeit.
Der zweite Referenzrahmen ist der des literarischen Artefakts. Er ist nicht-empirischer Art, wohl aber intersubjektiv nachvollziehbar und damit auf kollektive Art strukturiert – siehe unser Hamlet-Beispiel. Es handelt sich um einen virtuellen Referenz- und Erfahrungsraum, wobei ‚Raum‘ hier als Abkürzung für Vorstellungsraum steht. Bezogen auf die Materialität von Texten handelt es sich um einen Diskursraum. Die beiden Pole der Produktion und der Rezeption des Artefakts bedingen, daß es einen kreativen Vorstellungsraum des Produzenten gibt und den – nicht unkreativen, aber in dieser Hinsicht anders gearteten – Vorstellungsraum des Rezipienten. Man kann hier vielleicht von ‚Auffassung‘ sprechen. Die beiden Vorstellungsräume stehen im Rahmen der literarischen Kommunikation in Beziehung zueinander.
Die Untersuchung dessen, was sich im Diskursraum zwischen einem Textproduzenten und seinen jeweiligen Rezipienten abspielt, muß einer eigenen Ausarbeitung der Pragmatik des literarischen Textes vorbehalten bleiben. Das Zusammenspiel von Vorstellung und Darstellung hingegen bildet den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie. Dies gilt für die autorseitige wie die leserseitige Vorstellung sowie für die materiale Diskursivität des Textes. Es handelt sich beim Manifestieren von Darstellung durch einen Text im Vorstellungsraum einer lebenden Person auch um ein Zusammenspiel von Wirklichkeitsbezug und freier Setzung durch das Bewußtsein. Dies ist es, was den Term ‚Erfindung‘ als eine der Hauptbedeutungen von Fiktion ausmacht. Dieses Erfinden bzw. Fingieren geschieht immer auf der Grundlage der Imagination. Zwei Fragen ergeben sich an dieser Stelle.
Zum ersten ist das Fiktionale weitgehend angewiesen auf das Einbeziehen des Wirklichen. In einem literarischen Text sind die meisten Gehalte stets der Empirie entlehnt. Ausnahmen sind sehr selten. Finnegans Wake (Joyce, 1992) oder Riddley Walker (Hoban, 2002) wären hier als besonders radikale Beispiele anzuführen, die eine nahezu völlig eigene Ästhetik kreieren, indem sie bis in das Wortmaterial eingreifen. Im Wake findet sich eine Agglomerationstechnik durch Montage mehrerer Sprachen in die Worte sowie durch Polysemierung. Der post-nukleare Roman Riddley Walker hingegen kreiert eine Schwundstufe der englischen Sprache, ein nur in diesem Roman vorhandenes Pidginenglisch, das vom Leser mühsam entziffert werden muß. In aller Regel wird jedoch nur das Wenigste in einem Text originär erfunden. Dies gilt auch für phantastische Schreibweisen und experimentelle Texte. Die entsprechende Frage lautet: Wie viel oder wie wenig muß eine Textproduktion leisten, um das entsprechende Artefakt als einen schon fiktionalen oder aber als einen noch gerade nicht- fiktionalen Text erkennen zu können? Wie steht es mithin mit der Modalisierungsarbeit, die uns die Fiktionalität eines literarischen Textes erkennen läßt, noch bevor wir auf Fiktionssignale angewiesen sind?
Zum zweiten ist der Umstand anzusprechen, daß empirische Elemente versetzt werden von einem Erfahrungsbereich in den anderen. Diese Versetzung funktioniert wie ein Tropus, vergleichbar der Metapher (Übertragung) und der Metonymie (Ersetzung). Ist diese Versetzung der Bestandteile unserer Realität in einen virtuellen, aber gleichwohl kollektiven Erfahrungsbereich nicht zu beschreiben als ein Mechanismus der Projektion durch das Bewußtsein?
Um diese Versetzungsarbeit auf semiotischer Ebene minutiös beschreiben zu können, möchte ich den durch Peirce eingeführten Begriff der Transuasion für die Untersuchung des Fiktionalen fruchtbar machen.4 Die Peircesche Transuasion hat folgende Form: Element A (empirisch) wird transuiert in Element A’ (fiktional bzw. fiktionalisiert). Mit Hilfe dieser Formel können einzelne Aspekte der Übertragung, Ersetzung und Modalisierung im fiktionalen Text analysiert werden. Nehmen wir als Beispiel die dystopische Darstellung eines historisch-alternativen Szenarios à la ‚Was wäre, wenn Nazi-Deutschland den Krieg gewonnen hätte?‘. Ein solcher Text würde Ereignisse und Personen bis 1942/43 faktual darstellen, um dann nach und nach von der historiographischen Überlieferung abzuweichen und auf diese Weise das fiktive Szenario zu entfalten. Realexistierende Personen wie Himmler und Hitler, die den Mai 1945 nicht überlebt haben, werden so zu fiktionalisierten, kontrafaktischen Gegenständen des Textes. Die Aussagestruktur des Textes nimmt metaphorischen und allegorischen Charakter an, um zu zeigen, wie unsere Welt in so einem Fall hätte aussehen können.
3. Der Status der fiktionalen ‚Welt‘
Eines der Hauptprobleme, welches sich bei der Untersuchung des Fiktionalen ergibt, besteht darin, daß unsere menschliche Wirklichkeit bereits eine Art Projektion des Bewußtseins ist. Wir nehmen qua unserer Subjektivität die Realität nicht als Realität wahr, sondern als erlebte und erfahrene Realität. Das ist es, was wir ‚unsere‘ Wirklichkeit nennen. Die Erfahrungswirklichkeit ist eine privilegierte Projektion, da sie sich ständig an der empirischen Realität orientiert, zurückversichert und ‚korrigiert‘, wenn es zu unzulässigen Abweichungen kommt. Ein Beispiel wäre, daß wir etwas als Illusion erkennen, etwas, an das wir uns zu erinnern meinen, das so aber gar nicht stattgefunden hat, sondern sich der kognitiven Verarbeitung verdankt.
Fiktionale Abwandlungen der Welt hingegen sind Modalisierungen. Sie werden stets konstruiert nach dem Modus des „was wäre wenn“ und des „als ob“. Damit hat die vorliegende Arbeit auch eine Aufarbeitung der Modi und Modaloperatoren zu leisten.5 Der fertige literarische Text bildet jedoch keine homogene ‚mögliche‘ Welt, denn es handelt sich um eine jeweils ausgedachte Welt. Das ist eine bewußt hergestellte Variante unserer einen gegebenen Lebenswelt. Das Konzept der möglichen Welten entstammt der Logik, und die sogenannten possible worlds meinen dort die subjektiven Realitätskonstruktionen durch alle jeweils zugreifenden Einzelsubjekte. Wie zu zeigen sein wird, verursacht die Entlehnung dieses Modells in die Ästhetik mehr Probleme, als es Fragen zufriedenstellend beantwortet.
Fiktionen im allgemeinen Gebrauch rekurrieren allererst auf heuristische Gebrauchsfiktionen, zum Beispiel in der Logik und in der Mathematik. Ästhetische Fiktionen bilden hingegen einen Spezialfall, sie sind auf Wiedergebrauch abgestellt. Für solche Wiedergebrauchsfiktionen soll der Term Fiktionalität einstehen. Als Wirklichkeit für sich, wenn man dieses Gedankenexperiment zulassen möchte, handelt es sich um nichts anderes als um eine Auslassungsstruktur. Die ‚mögliche‘ Welt ist ein weitestgehend völlig leerer, unbesetzter Raum. In ihr ‚existiert‘ nur das, was der Text uns an Informationsmaterial zur Verfügung stellt. Hinter jeder Tür, die nicht geöffnet wird, hinter jedem Fenster, in das nicht hineingeguckt wird, befindet sich nichts im buchstäblichen Sinn dieses Worts.
Das literarische Artefakt nimmt sich demnach aus als eine Vorgabestruktur, die ein Produzent bereitstellt. Es steuert alle Leistungen des Rezipienten. Nur aufgrund der Ablösung des Artefakts von seinem Produzenten entsteht jener semantische ‚Mehrwert‘ oder auch Sinnüberschuß, der nicht mehr vom Autor kontrolliert werden kann, und im Zeitenabstand zum Abfassungszeitpunkt eine eigene Dynamik entfaltet und schließlich ein davon relativ abgelöstes Eigenleben zu führen beginnt. Die Kategorie der Fiktionalität – mithin die Fähigkeit, sachpragmatische und literarische Texte voneinander zu unterscheiden – ist ein wesentlicher Bestandteil der Medienkompetenz.
In diesem Sinn ist als letzter großer Punkt die Modalisierung durch den Rezipienten anzusprechen. Diese kann reichen von einer Interpretation, die die Verfaßtheit des Sprachsystems und den Personalstil des Verfassers sowie auch den Zeitstil der Entstehungsepoche rekonstruierend bedenkt, bis zur völlig freien Rahmung des Artefakts durch den Rezipienten (ein sogenanntes reframing), welche auf eine wie auch immer geartete Übereinstimmung zwischen Produktionsakt und Rezeptionsakt, auf eine Kommunikation zwischen Produzent und Rezipient qua Textartefakt überhaupt keine Rücksicht nimmt.
Aus der Sicht der Autoren ist die Problematik hingegen eine andere. Die Darstellungsfunktion des Literarischen, die einem Textproduzenten zur Verfügung steht, erlaubt nur drei Modi: das Faktuale, das Kontrafaktische und das Fiktionale. Das Kontrafaktische umfaßt hypothetische, prophetische sowie alle anderen Darstellungen nach Maßgabe von Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Es bewegt sich zwischen ‚Wahrheit‘ (positive Verifizierung nach Maßgabe von Quelle und Dokument) und Fiktion (mehr oder weniger freie Setzung).
In der vorliegenden Untersuchung sind im Zuge der bisherigen Betrachtungen vier Aspekte des Fiktionalen aufzuarbeiten. Das ist zum ersten die kreative Leistung des Bewußtseins, die Imagination. Zum zweiten ist das der Wirklichkeitsbezug des Fingierten und Imaginierten. Zum dritten ist das die Modalisierungsleistung in der künstlerischen Kommunikation zwischen Textproduzent und Textrezipient. Und zum vierten ist das die intersubjektive Verhandelbarkeit der ‚nicht existierenden‘ Gegenstände: Wie können wir uns kollektiv über Dinge austauschen, die in der Realität kein Korrelat haben? Der letzte Punkt ist sehr wichtig. Man kann in der Frage nach dem ontologischen Status der Figmenta (Baumgarten, 2007, orig. 1750/58) ohne Abrede ein philosophisches Scheinproblem sehen. Gleichwohl muß beantwortet werden, wie wir uns über imaginäre Gehalte verständigen können. Die gesamte Praxis der Interpretationsarbeit an Literatur und Kunst könnte nicht mehr sinnhaft betrieben werden, wenn es keine Handhabe gäbe, auch das Mißverstehen eines literarischen Textes zu begründen. Hierbei spielt es zunächst keine Rolle, wie man zur Hermeneutik und zu antihermeneutischen Positionen steht. Wir können über Hamlet nur handeln, indem wir uns auf ‚Hamlet‘ als feststehenden Begriff beziehen. Der Zeichenträger ‚Hamlet‘ kann sinnvoll oder auch unsinnig in Prädikationen eingebunden werden. Und wir können über Hamlet nicht wie über Prospero handeln. All dies zeigt an, daß der fiktionale Bedeutungsträger keinen leeren Begriff bildet, sondern gerade im Gegenteil einen relativ stabilen, intersubjektiv verhandelbaren.
4. Das Begriffsfeld des Fiktionalen
In der Fiktionalitätsdiskussion sind wir mit einer Unzahl an Begriffen konfrontiert, die sich zwar allesamt überschneiden, jedoch nicht ohne weiteres konsistent nebeneinander verwendet werden können: Fiktion, fiktiv, Fiktivität, Nicht-Existenz, Fiktionalität, fiktional, Fiktionalisierung, Erfundenheit, Unwahrheit, Lüge, Imagination, das Imaginäre, Imaginieren, Ausspinnen, Ausdenken, Halluzination, Traum. Allein diese siebzehn Einträge, die das Begriffsfeld keinesfalls erschöpfen, deuten die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes an.
Die oben genannten Begriffe finden im Deutschen regelmäßige Verwendung, in der Wissenschafts- wie in der Alltagssprache. Bezüglich anderer Sprachen ist hingegen unklar, inwieweit es sich bei jeweiligen – scheinbaren – Begriffsentsprechungen überhaupt um übliche Gebrauchsweisen handelt. So ist im Englischen fictivity äußerst unüblich und bei fictive ist zu fragen, ob es nicht bloß einen Germanismus bzw. Romanismus zu fictif bildet. Das Wort fictitious wiederum begegnet uns zwar mit schöner Regelmäßigkeit am Ende fast eines jeden Filmabspanns, ist darüber hinaus aber ebenfalls ungebräuchlich. Es gehört in dieser Hinsicht eher dem juristischen und nicht so sehr dem ästhetischen Diskurs an.
Darüber hinausgehend besteht eine unglückliche Überschneidung im Bereich der Beugungen: Während das engl. fictional das Adjektiv zu fiction bildet und damit „erfunden, erdichtet“ meint, denotiert fictitious vornehmlich „frei erfunden, unecht, unwirklich“. Das englische fictional wäre also Gegenstück zu unserem fiktiv. Und fictitious bildet die Entsprechung zu imaginär und fingiert. Streng genommen steht damit kein englischer Ausdruck zum deutschen fiktional zur Verfügung. Selbstredend versteht man im jeweiligen Kontext, was ein Beiträger meint, doch die Gebrauchsweisen sind in den jeweiligen Sprachräumen deutlich andersartig konnotiert. Entsprechend beschränken sich die Literaturwissenschaften des anglo-amerikanischen Kulturraums in großen Teilen auf den Begriff fiction. Dieses Wort aber verweist verengend auf die Erzählliteratur und damit die narrativen Prosaformen der Neuzeit: Das englische fiction ist nichts anderes als eine Kurzform für narrative fiction. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, daß der starke Unterschied zwischen dem deutschen fiktional und dem englischen fictional im Sinn von „erzählend“ ein erhebliches Problem im Forschungsdiskurs darstellt. Im englischen Sprachgebrauch steht auch der abstraktere Ausdruck fictionality zur Verfügung, doch auch dieser ist aufs Ganze gesehen ungebräuchlich. Er kommt tendenziell nur dann zum Einsatz, wenn der internationale Forschungsstand in den Rahmen der Diskussion von Textkategorien einbezogen wird.
Schon aus der unterschiedlichen Begriffsentwicklung darf man ablesen, daß die anglo-amerikanische Forschungstradition im Vergleich zur deutschen eine andere Richtung einschlägt, indem sie stark von sprachanalytischen Ansätzen her denkt. Die Konzepte der Wahrheitsbedingungen (truth-conditionals), Aussagefehler (misfires) und Modifikations-Anzeiger (modals, modifiers, shifters) beherrschen nicht nur die alltagslinguistische Forschung, sondern auch literaturwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit erzählender Darstellung (fiction) sowie Fiktionalität (literary discourse). In Deutschland hingegen hat man sich besonders die Frage nach den Charakteristika und Statuseigenschaften von Fiktionalität zu eigen gemacht. Dies hängt nicht zuletzt mit der Bandbreite des zur Verfügung stehenden Wortfeldes zusammen. Auch zeigt die Diskussion im Deutschen des öfteren die Tendenz zur Bildung von Fantasieworten wie Fiktivierung.6 Angesichts dieses Zustands nimmt es nicht wunder, daß der Vorwurf, es herrsche eine heillose Begriffsanarchie, zu einem beharrlich wiederkehrenden Topos geworden ist.7
Diesem Topos soll hier widersprochen werden. Tatsächlich zeigt sich im Lauf der vorliegenden Untersuchung, daß wir es insgesamt weniger mit einer frei wuchernden Begriffsbildung zu tun haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen, sondern daß vielmehr die Konstitution des Fiktionalen ein derart komplexer Prozeß ist, daß wir zu seiner adäquaten Beschreibung gerade nicht über genügend Begriffe verfügen, um alle relevanten Aspekte hinreichend jeweils für sich benennen zu können. Statt einer Anarchie überflüssiger Begriffe herrscht vielmehr eine Unterbesetztheit an Begriffen; und diese Unterbesetztheit führt zu Kategoriensprüngen, weil die Begriffe mal das eine und mal das andere bedeuten müssen.
Zum mindesten ist an dieser Stelle festzuhalten, daß möglichst präzise Begriffsbildungen eine unabdingbare Voraussetzung sind, um die Diskussion überhaupt nachvollziehbar zu gestalten. Dementsprechend folgt als nächstes eine ausführliche Klärung der Begriffe Fiktion und Fiktionalität je für sich. Ausgehend von den in einschlägigen Wörterbüchern zur Verfügung stehenden Definitionen sollen die Begriffe der Fiktion und des Fiktionalen mit ihren jeweiligen spezifischen Gebrauchsweisen aufgerissen werden.
Details
- Seiten
- 444
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631921784
- ISBN (ePUB)
- 9783631921791
- ISBN (Hardcover)
- 9783631921777
- DOI
- 10.3726/b22011
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (Februar)
- Schlagworte
- Phänomenologie Mimesis Kategorienlehre Aristoteles Charles Sanders Peirce Edmund Husserl Semiotik Texttheorie Verstehen Interpretation Fiktion Fiktionalität
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 444 S., 15 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG