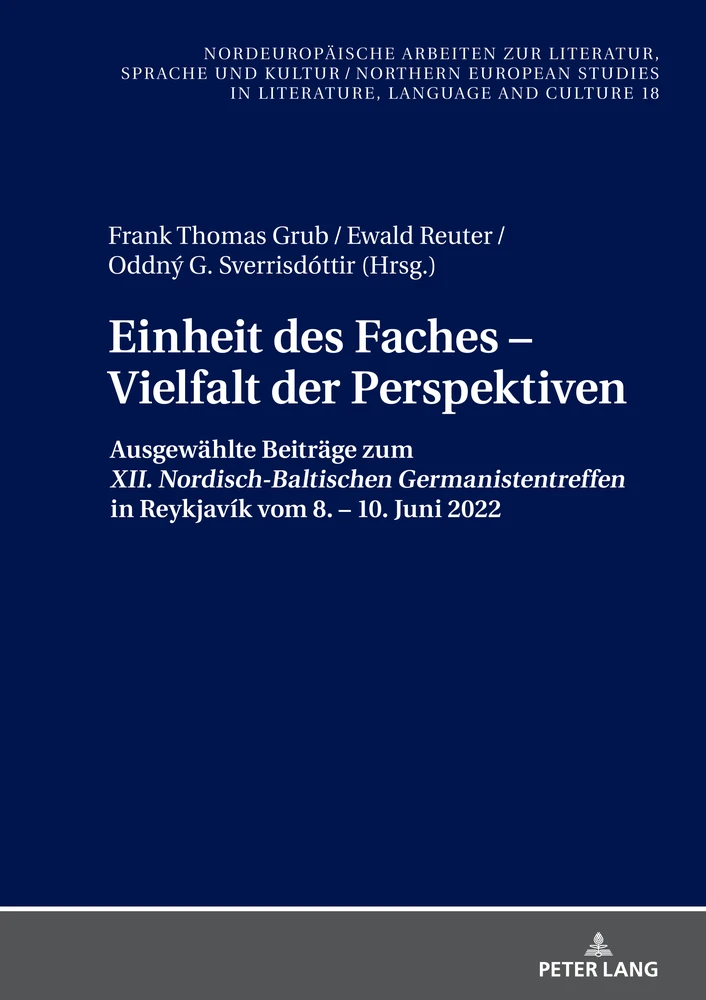Einheit des Faches – Vielfalt der Perspektiven
Ausgewählte Beiträge zum "XII. Nordisch-Baltischen Germanistentreffen" in Reykjavík vom 8. – 10. Juni 2022
Summary
Der Band versammelt ausgewählte Beiträge des XII. Nordisch-Baltischen Germanistentreffens 2022 in Reykjavík und bietet einen Überblick über die aktuelle sprachwissenschaftliche, literaturwissenschaftliche und didaktische Forschung in der Region.
Angesichts der zahlreichen internationalen Vernetzungen sind die vorgestellten Ergebnisse auch über die nordischen und baltischen Länder hinaus von Bedeutung.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort (Frank Thomas Grub, Ewald Reuter & Oddný G. Sverrisdóttir)
- Nachruf auf Peter Colliander (1953 – 2022) (Klaus Geyer, Frank Thomas Grub, Eva Neuland & Ewald Reuter)
- Sprachwissenschaftliche Beiträge
- Zu deutschen Männernamen auf -eke und -ike im mittelalterlichen Schweden (Daniel Solling)
- Nationale Stereotype in der internationalen Unternehmenskommunikation. Probleme der Erstellung und Auswertung unternehmerischer Gesprächsdaten (Ewald Reuter)
- Fokussierung auf Klang und Mühelosigkeit. Zur Pragmatik und Semantik von Verbmetonymien (Dessislava Stoeva-Holm)
- Humor als Strategie von Gegenrede (Sabine Ylönen)
- Eine korpusgestützte Untersuchung zu deutschen nachdem-Sätzen: Tempusformen, Funktionen und formelhafte Muster (Vaiva Žeimantienė)
- Jón og séra Jón. Zur Struktur, Bedeutung und Klassifizierung deutscher und isländischer Zwillingsformeln (Oddný G. Sverrisdóttir)
- „Wir tanzten nach Wioli, alle anderen tanzten nach Torropil.“ Die historische Mehrsprachigkeit in deutschsprachigen Anekdoten des Baltikums (Marin Jänes)
- Wenn Endonyme zu Exonymen werden: Zum heutigen Gebrauch deutscher Ortsnamen im Baltikum (Heiko F. Marten)
- Warum ist der Döner in Helsinki so unverschämt teuer? Diskurse über Essen und Esskultur in einer deutsch-finnischen Facebook-Gruppe (Sabine Grasz & Florence Oloff)
- Literaturwissenschaftliche Beiträge
- Weibliche Selbstermächtigung im Spiegel von Caroline Pichlers Über die Bildung des weiblichen Geschlechtes (Helga Müllneritsch)
- Prostitution in Ernst Moritz Arndts Reise durch Schweden im Jahr 1804 und E.T.A. Hoffmanns Die Bergwerke zu Falun (Thorsten Päplow)
- Zum Verhältnis von Mensch und Pferd am Beispiel der 1928 bei den Olympischen Spielen ausgezeichneten Erzählung Reitvorschrift für eine Geliebte von Rudolf G. Binding (Ivars Orehovs)
- Ernst Tollers Autobiographie Eine Jugend in Deutschland in entstehungs- und textgeschichtlicher Perspektive. Zu den letzten Ergänzungen im Schlusskapitel Fünf Jahre (Peter Langemeyer)
- Ein Schwede an der Saar: Fredrik Bööks Reise ins Saargebiet und nach Paris über das Elsass und die Saar-Abstimmung 1935 (Frank Thomas Grub)
- „Nachbarschaft im Geviert“: Lars Gustafsson und Walter Höllerer im Westberlin der 1960er Jahre (Lukas Nils Regeler)
- Überlegungen zum christlichen Humanismus der Deutschbalten in Elisabeth Josephis Roman Arzt im Osten (Juris Kastiņš)
- „Ich hatte den Eindruck, noch niemals so einsam gewesen zu sein.“ Deutschsprachige Literatur im Schatten von Corona (Maren Eckart)
- Lesedrama – ein problematischer Begriff in der Forschungsliteratur (Esbjörn Nyström)
- Hochschuldidaktische Beiträge
- Zur sprachlichen Heterogenität im digitalen DaF-Hochschulstudium aus studentischer Sicht (Anneli Fjordevik)
- Gode Freunde – falsche venner? Deutsch (lernen) aus dänischer Perspektive (Klaus Geyer)
- Interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Verständnis im Lernkontext von Deutsch als Fremdsprache in Dänemark (Anke Heier & Erla Hallsteinsdóttir)
- Absolvent*innen-Befragung: Berufsfelder von Germanistik-Studierenden der LU, Riga (Angelika Böhrer, Ieva Blumberga & Dmitrijs Golonovs)
- Fehleranalyse einer Nacherzählung des Märchens Rumpelstilzchen im Grundstudium der Germanistik in Finnland (Michael Möbius)
- Diskursorientierte Kulturvermittlung im DaF-Unterricht am Beispiel des Erinnerungsortes ‚Sprache‘ (Maris Saagpakk)
- Eine mehrsprachige Phrasenbank: nützliches Hilfsmittel beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten? (Skaistė Volungevičienė)
- Autorinnen und Autoren
Frank Thomas Grub, Ewald Reuter & Oddný G. Sverrisdóttir
Vorwort
Vom 8. bis 10. Juni 2022 fand an der Háskóli Íslands (Islands Universität) das XII. Nordisch-Baltische Germanistentreffen statt. Zielgruppe dieser alle drei Jahre an wechselnden Orten stattfindenden Konferenz sind in erster Linie Germanistinnen und Germanisten sowie interessierte Lehrende des Deutschen als Fremdsprache in den sogenannten ‚nordischen Ländern‘ und dem Baltikum.
Das Treffen unter dem Motto Zauber und Vielfalt der nordisch-baltischen Germanistik sollte ursprünglich 2021 stattfinden, musste aber wegen der Pandemie und ihren Folgen auf 2022 verschoben werden. Die Tage in Reykjavík wurden daher getragen von der Erleichterung darüber, nach einer längeren Periode der Immobilität und erzwungenen Isolation endlich wieder reisen und sich im persönlichen Gespräch auch wieder von Angesicht zu Angesicht austauschen zu können. In den durchweg positiv gestimmten akademischen Diskurs über den Stand der Dinge und die neuen Entwicklungen in der regionalen germanistischen Forschung und Lehre mischten sich allerdings auch besorgte Stimmen über die allseits spürbare Marginalisierung nicht nur der germanistischen, sondern der fremdsprachenphilologischen Studiengänge generell.
Erfreulicherweise belegen mehrere der in diesen Band versammelten Beiträge, dass unser Fach in der Lage ist, Herausforderungen dieser Art konstruktiv zu begegnen, beispielsweise durch die Neuprofilierung von Studiengängen. Zugleich wird deutlich, dass sich die nordisch-baltischen Germanistiken wechselseitig aufmerksam wahrnehmen. Dabei werden lokale Forschungs- und Lehrinteressen mit regionalen und globalen Strömungen vernetzt. Die hohe Zahl von 66 Teilnehmerinnen und Teilnehmern belegt, wie sehr das Tagungskonzept der Verbindung von Lokalem, Regionalem und Globalem in der nordisch-baltischen Germanistik geschätzt wird.
Die vorliegende Publikation enthält vor allem Beiträge, die als Vorträge in Reykjavík präsentiert wurden. Dennoch versteht sie sich nicht als Tagungs- oder Konferenzband im Sinne einer mehr oder weniger geschlossenen Dokumentation, sondern als Auswahl wissenschaftlicher Aufsätze, die zur weiteren, auch stärker internationalen Diskussion anregen wollen. Der Band bietet somit einen Überblick über die aktuelle germanistische Forschung in der nordisch-baltischen Region und zeigt deren Vernetzungen auch jenseits der deutschsprachigen Länder auf.
Der erste Teil des Bandes versammelt sprachwissenschaftliche Beiträge. Daniel Solling setzt sich in seinem Beitrag mit niederdeutschen Männernamen mit den Diminutivendungen -eke bzw. -ike im mittelalterlichen Schweden auseinander. Da diese Art von Namen im Altschwedischen sowohl nach der schwachen femininen als auch nach der schwachen maskulinen Deklination flektiert werden können, analysiert Solling insbesondere Gebrauch und Deklination von vier Namen dieser Art und leistet somit einen Beitrag zur historischen Kontaktonomastik.
Im Rückgriff auf das sozialkognitive Konzept des Stereotyps diskutiert Ewald Reuter zentrale Herausforderungen der empirischen Gesprächsforschung. Dargelegt wird, dass die Unterscheidung zwischen Gesprächen über Stereotype in der internationalen Unternehmenskommunikation und Stereotype in unternehmerischen Gesprächen sowohl für die Erstellung, Analyse und Interpretation von Gesprächsdaten als auch für die praktische Anwendung in Gesprächsberatung und -schulung entscheidend ist.
Aus einer pragmatisch-semantischen und konzeptuell-kognitiven Perspektive heraus untersucht Dessislava Stoeva-Holm Verbmetonymien als besondere Form der Nomination. In ihrem Beitrag betrachtet sie die Struktur der Handlung dabei einerseits als ontologische Entität. Andererseits analysiert sie, wie Handlung durch metonymische Benennungsprozesse sprachlich segmentiert wird.
Sabine Ylönen berichtet über Ergebnisse einer Korpusanalyse von Postings einer finnischen und einer deutschen Gegenredeninitiative auf Facebook und weist nach, dass beide Initiativen Hassrede und rechtsextreme Diskurse mit Satire konterten. Dabei fiel die finnische Satire eher parodistisch aus, während die deutsche Satire stärker erzieherisch ausgerichtet war.
Vaiva Žeimantienė widmet sich in ihrem Beitrag einer korpusgestützten Analyse von Tempusformen, Funktionen und formelhaften Mustern deutscher nachdem-Sätze. Ziel des Beitrags ist es, charakteristische Merkmale von nachdem-Sätzen darzustellen und die korpusgestütze Untersuchung als Methode für das forschende Lernen vorzustellen.
Oddný G. Sverrisdóttir gibt einen Überblick über Zwillingsformeln im Deutschen und im Isländischen. Sie präsentiert Beispiele für äquivalente Zwillingsformeln in beiden Sprachen und geht daran anschließend näher auf isländische Zwillingsformeln ein, die auf die isländische Kultur und Geschichte zurückgehen.
Marin Jänes analysiert auf der Grundlage von Hans von Schroeders Anekdotensammlung Fanfaronaden. Edeldreiste Geschichten aus Baltischen Landen (1928) Aspekte der historischen Mehrsprachigkeit im Baltikum. Ihr besonderes Interesse gilt der mündlichen Sprache, wobei sie kontaktlinguistische Verfahren auf literarische Texte appliziert.
Heiko F. Marten fasst unter dem Titel Wenn Endonyme zu Exonymen werden: Zum heutigen Gebrauch deutscher Ortsnamen im Baltikum das zentrale Ergebnis einer Korpusanalyse zusammen. Er kann nachweisen, dass seit dem Ende des Sozialismus mit Endonymen wie Tallinn oder Klaipėda und Exonymen wie Reval oder Memel unsystematisch umgegangen wird.
In einer sprachlich-multimodalen Analyse untersuchen Sabine Grasz und Florence Oloff, wie die Mitglieder einer deutsch-finnischen Facebook-Gruppe anhand der Thematisierung von „Essen“ und „Esskultur“ Dimensionen von kultureller Zugehorigkeit als Expats gestalten.Helga Müllneritschs Beitrag über Caroline Pichler eröffnet die Reihe der literaturwissenschaftlichen Aufsätze des Bandes. Müllneritsch präsentiert Pichlers Text Über die Bildung des weiblichen Geschlechtes (1820), den sie als Versuch der österreichischen Schriftstellerin versteht, „eine Grundlage für die öffentliche Akzeptanz arbeitender Frauen zu schaffen“.
Thorsten Päplow widmet sich der Reiseliteratur und stellt mit Ernst Moritz Arndts Reise durch Schweden im Jahr 1804 einen wichtigen Prätext von E. T. A. Hoffmanns Die Bergwerke zu Falun vor. In seiner Analyse kann er anhand des Themenkomplexes der Prostitution einen intertextuellen Dialog zwischen beiden Texten belegen.
Ivars Orehovs betrachtet das Verhältnis von Mensch und Pferd am Beispiel der im Rahmen der Olympischen Spiele 1928 ausgezeichneten Reitvorschrift für eine Geliebte von Rudolf G. Binding. Dabei plädiert er für die Übersetzung des Textes in die nordischen und baltischen Sprachen.
Peter Langemeyer zeigt auf der Grundlage neuer Textfunde, dass Ernst Toller in seiner Autobiographie Eine Jugend in Deutschland bereits früher als bisher von der Forschung angenommen gegen den Nationalsozialismus Stellung bezog. Dies geschieht mittels einer Analyse von Veränderungen im Text des Schlusskapitels der 1933 in Amsterdam erschienenen Erstausgabe.
Frank Thomas Grub stellt mit der „Saar-Ouvertüre“ das Eröffnungskapitel von Fredrik Bööks Resa till Saar och Paris över Elsass (1935) vor, dessen Gegenstand die erste Saar-Abstimmung von 1935 ist. Dabei geht er auch auf die ambivalente Rolle des schwedischen Literaturwissenschaftlers und Kritikers ein, dessen Texte nach wie vor auch von Historikern rezipiert werden.
Lukas Nils Regeler setzt sich mit den poetischen Konsequenzen der Freundschaft des schwedischen Dichters Lars Gustafsson und des Westberliner Autors und Kulturpolitikers Walter Höllerer auseinander. Besonderes Augenmerk legt er auf die Modernisierung und Internationalisierung des literarischen Lebens in Europa und die „Netzwerkpoetiken und -politiken beider Autoren“.
Juris Kastiņš stellt mit Elisabeth Josephis Der Arzt im Osten (1976) den Roman einer von der germanistischen Literaturwissenschaft kaum beachteten Schriftstellerin vor. Im Fokus der Analyse stehen die Ideen des christlichen Humanismus und deren Verwirklichung, die anhand der Lebensdarstellung eines deutschen Arztes in einer litauischen Stadt veranschaulicht werden.
Maren Eckart gibt unter dem Titel „Ich hatte den Eindruck, noch niemals so einsam gewesen zu sein“ einen Überblick über deutschsprachige Prosatexte und Essays, in denen die Coronapandemie thematisiert wird. Angesichts der von ihr identifizierten Konstanten sieht sie die Literatur über Corona als Teil der Pandemieliteratur im Allgemeinen.
Esbjörn Nyström thematisiert den Begriff des „Lesedramas“ und geht in diesem Zusammenhang die einschlägige Forschungsliteratur durch. Dabei kann er zeigen, dass die Begriffsverwendung problematisch ist, zumal die Bezeichnung „impliziert, es gäbe Dramentexte, die nicht zum Lesen bestimmt wären“.
Anneli Fjordeviks Aufsatz bildet den Auftakt der didaktischen Beiträge. Unter dem Titel Zur sprachlichen Heterogenität im digitalen DaF-Hochschulstudium aus studentischer Sicht berichtet sie über Erfahrungen, die schwedische und deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler im gemeinsamen digitalen Deutschstudium in Schweden machen und plädiert für eine stärkere sprachliche Binnendifferenzierung des Studiums.
Auf der Grundlage sprachtypologischer Betrachtungen stellt Klaus Geyer fest, dass „die Grammatik“ nicht der wahre bzw. der einzige Grund sein kann, weshalb Deutsch in Dänemark als schwierig zu erlernende Sprache gilt. Künftige Forschungen müssen zeigen, weshalb Deutsch in dänischen Lernkontexten ein negatives Image besitzt.
Anke Heier und Erla Hallsteinsdóttir kritisieren, dass die dänischen Schulcurricula die beiden Schlüsselbegriffe interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Verständnis nur unzureichend definieren, weshalb sie als Lernziele kaum jemals erreicht werden (können). Unter Verweis auf einschlägige Projekte argumentieren die Autorinnen dafür, dass sich beiden Lernzielen nur durch authentische dänisch-deutsche Begegnungen angenähert werden kann.
Angelika Böhrer, Ieva Blumberga und Dmitrijs Golonovs diskutieren in ihrem Beitrag die Ergebnisse der Absolvent*innen-Befragung: Berufsfelder von Germanistik-Studierenden der LU Riga und stellen fest, dass Deutschkenntnisse am lettischen Arbeitsmarkt zwar nachgefragt werden, dass das lettische Germanistikstudium jedoch kaum auf diesen Arbeitsmarkt vorbereitet, weshalb differenzierte Curriculumreformen vonnöten seien.
Michael Möbius befasst sich in seinem Beitrag mit den Ergebnissen einer quantitativen Fehleranalyse schriftlicher Arbeiten finnischer Studierender in deren Nacherzählungen des Märchens Rumpelstilzchen. Dabei werden die Verteilung von Fehlern anhand einer festgelegten Fehlertaxonomie analysiert sowie mögliche Fehlerursachen diskutiert.
Maris Saagpakk präsentiert die Ergebnisse einer Studie mit Deutschlernenden aus Estland und Sri Lanka. Dabei geht es um ein virtuelles interkulturelles Projekt über Erinnerungsorte, wobei die Studierenden, ausgehend von deutschen Erinnerungsorten, Entsprechungen aus dem eigenen Kulturraum identifizieren und untersuchen sollten. Zugleich thematisiert Saagpakk Möglichkeiten und Grenzen transformativen Lernens.
Skaistė Volungevičienė betrachtet die Erstellung und studentische Nutzung einer litauisch-deutsch-schwedischen Phrasenbank, die hochfrequente wissenschaftliche Phraseologismen zwecks studentischer Schreibhilfe verzeichnet. Erste Erfahrungen besagen, dass Studierende deutlich mehr über die Kulturspezifik wissenschaftlicher Textsorten als über Phraseologismen erfahren möchten; zugleich schätzen Lernende des Litauischen die Informationen dieser Phrasenbank.
An der Konferenz und der Entstehung der vorliegenden Publikation sind zahlreiche Personen, Organisationen und Institutionen beteiligt: die Háskóli Íslands, die die Tagung ausrichtete und finanziell unterstützte; genannt seien hier insbesondere Hugvísindasvið (das Zentrum für Geisteswissenschaften) und Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum (das Vigdís-Finnbogdóttur-Institut für Fremdsprachen). Die Háskóli Íslands übernahm auch die Druckkosten des vorliegenden Bandes. Als Partner im Zuge der Organisation und Durchführung der Tagung fungierten der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und die Deutsche Botschaft in Reykjavík sowie das Goethe-Institut in Kopenhagen.
Ein besonderes Dankeschön für die ausgezeichnete und stets professionelle Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Tagung gebührt Dr. Vanessa Isenmann. Loretta Krause, Lehrassistentin des DAAD an der Háskóli Íslands 2023/2024, formatierte die Texte und fügte sie zu einem Ganzen zusammen; Dr. Petra Schirrmann, Lektorin an der Háskóli Íslands, überhahm das Korrekturlesen. Allen Beteiligten, nicht zuletzt auch den Autorinnen und Autoren der Beiträge, den anonymen Gutachterinnen und Gutachtern sowie dem Peter Lang Verlag, insbesondere Esra Bahşi, sei herzlich für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit gedankt!
Wir widmen diesen Band unserem guten Freund und geschätzten Kollegen Peter Colliander, der am 20. November 2022 starb; ein Nachruf auf Peter findet sich im Anschluss an dieses Vorwort. Für sein großes Engagement auch für das Nordisch-Baltische Germanistentreffen sind wir ihm dankbar. Als wir uns in Reykjavík trafen, ahnten wir nicht, dass es für viele von uns die letzte Begegnung mit Peter sein würde. Wir trauern mit Peters langjährigem Gefährten Jørn.
Reykjavík, Tampere und Uppsala, im Mai 2024
Frank Thomas Grub, Ewald Reuter, Oddný G. Sverrisdóttir
Klaus Geyer, Frank Thomas Grub, Eva Neuland & Ewald Reuter
Nachruf auf Peter Colliander (1953 – 2022)
Es ist schwer zu fassen und kam zu diesem Zeitpunkt auch für seine engeren Freunde, seine Kolleginnen und Kollegen unerwartet – und doch müssen wir es akzeptieren: Peter ist am 20. November 2022 seinem Krebsleiden erlegen. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen geachteten Kollegen, sondern einen lieben Freund, der immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und Sorgen hatte. Mit Peter Colliander hat die Germanistik bzw. das Fach Deutsch als Fremdsprache in ganz Europa, vor allem in den nordischen Ländern und insbesondere in Dänemark, einen prominenten und leidenschaftlichen Vertreter und Fürsprecher verloren.
Peter Colliander studierte an der Universität Kopenhagen, wo ihm 1977 für seine Abhandlung zum Korrelatbegriff die Goldmedaille verliehen wurde. Promoviert wurde er 1987 zum lic. ling. merc. an der Wirtschaftsuniversität Kopenhagen (heute: Copenhagen Business School) mit einer Arbeit über Das Korrelat und die obligatorische Extraposition. Seit 1983 wurde er mehrmals vom DAAD und der Alexander von Humboldt-Stiftung gefördert.
Von 2006 bis 2010 war er Inhaber des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Kultur an der Universität Jyväskylä in Finnland; darüber hinaus nahm er mehrere Vertretungs- und Gastprofessuren am Institut für Deutsche Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München wahr. 2015 wechselte er von der Copenhagen Business School auf eine Lehrprofessur an der Universität Kopenhagen; seit 2018 war er im Ruhestand.
Peter Collianders Arbeitsgebiete lagen in der theoretischen Linguistik, besonders in der kontrastiven Grammatik und Phonetik/Phonologie, sowie in der angewandten Linguistik, vor allem im Bereich Deutsch als Fremdsprache und Übersetzen. Besondere Anliegen waren ihm eine linguistisch fundierte Sprachdidaktik und der kontrastiv basierte Vergleich Dänisch – Deutsch.
Immer wieder hat Peter mit Begeisterung sowohl wissenschaftlich als auch organisatorisch neue Wege beschritten: Ein gutes Beispiel hierfür ist die 2007 für die Gesellschaft für interkulturelle Germanistik in Finnland ausgerichtete Wandertagung von Tampere und Jyväskylä. Die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten nicht nur die Möglichkeit, während einer Tagung gleich zwei Universitäten und deren Umgebungen kennen zu lernen – auch das Thema, wie man postakademisch von einem Germanistikstudium würde leben können, war damals so aktuell wie heute. Innerhalb der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik hat das Modell der Wandertagungen Schule gemacht, und das damalige Tagungsthema ist inzwischen etabliert.
Die Vielzahl von Monographien, Beiträgen und Herausgeberschaften dokumentiert Peter Collianders wissenschaftliche Produktivität. Um nur einige Titel zu nennen: Et Teoretisk Grundlag for Beskrivelse af Tysk. En valensteoretisk fremstilling (‚Eine theoretische Grundlage für die Beschreibung des Deutschen. Eine valenztheoretische Darstellung‘, 1995), Stemt S – med mere. Kort kontrastiv indføring i tysk udtale (‚Stimmhaftes S – und mehr. Kurze kontrastive Einführung in die Aussprache des Deutschen‘, 2003), Sproghandlinger i Tysk (‚Sprachhandlungen im Deutschen‘, zusammen mit Doris Hansen, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2004) und Tysk BasisLingvistik (‚Basislinguistik Deutsch‘, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2014). Von 2011 bis 2020 war Peter Colliander Mitherausgeber der Zeitschrift German as a Foreign Language. Er war aktiver Teilnehmer wissenschaftlicher Kooperationen und stellte seine Forschung und die damit verbundenen Thesen auf zahlreichen Tagungen in Europa und weltweit vor.
Details
- Pages
- 346
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631923511
- ISBN (ePUB)
- 9783631923528
- ISBN (Hardcover)
- 9783631905203
- DOI
- 10.3726/b22111
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Deutsch als Fremdsprache Germanistik Deutsch Didaktik Sprachwissenschaft Literaturwissenschaft
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024., 346 S., 26 s/w Abb., 7 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG