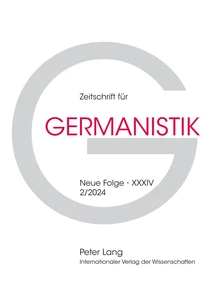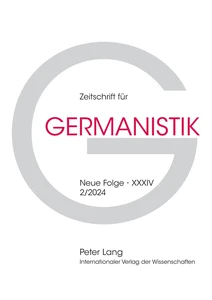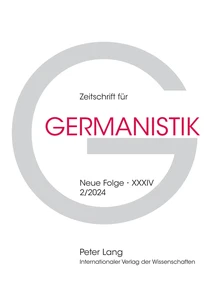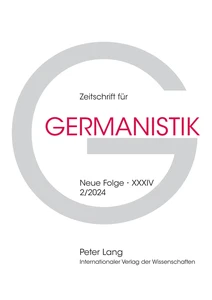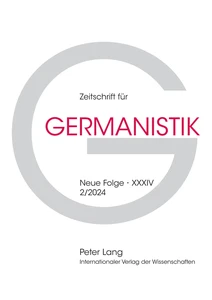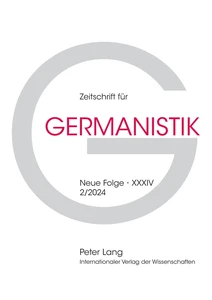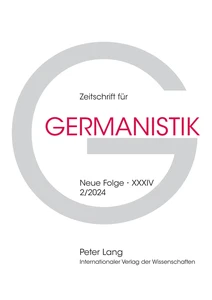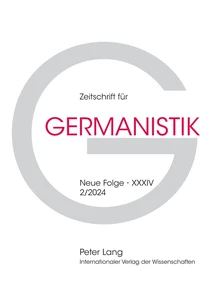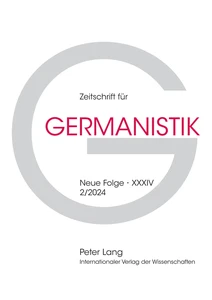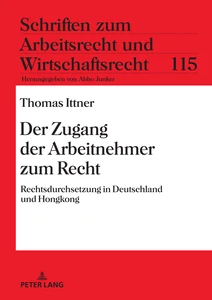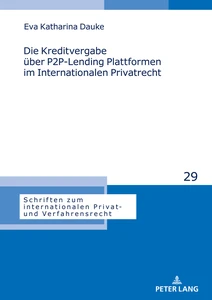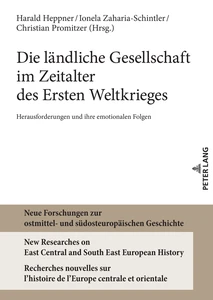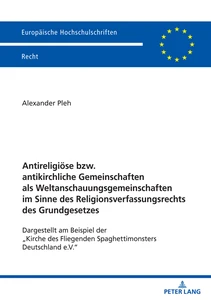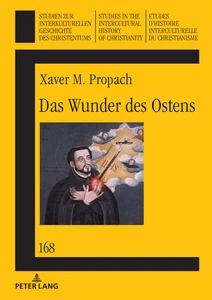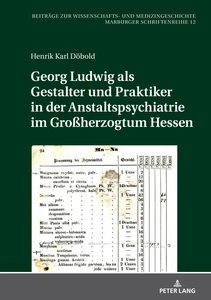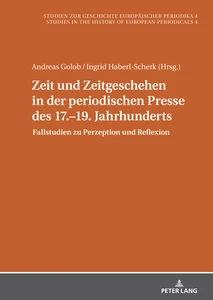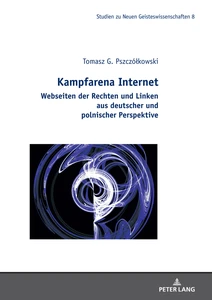Search
Search area
Subject
Category
Language
Publication Schedule
Open Access
Year
-
- Law, Economics & Management (11604)
- Science, Society & Culture (5021)
- History & Political Science (4706)
- Theology & Philosophy (3750)
- Education (3356)
- Linguistics (3187)
- German Studies (3062)
- Romance Studies (2554)
- English Studies (1985)
- The Arts (1551)
- Media and Communication (1270)
- Slavic Studies (309)
-
Lass das Büchlein deinen Freund sein.
„Ichzeit“ in Goethes „Werther“ (1774) und Willers Trauerspiel „Werther“ (1778) -
Ein ‚weiblicher Werther‘?
Neue Perspektiven auf Sophie von La Roches „Rosalie“ und die Entstehungsgeschichte des „Werther“ -
„Werther“ in Wien.
Joseph Ferdinand Kringsteiners kritische Lokalposse „Werthers Leiden“ auf dem Wiener Vorstadttheater -
„Durch Stoff und Stimmung […] gerechtfertigt“.
Goethes „Werther“ in der Homosexuellenbewegung um 1900 -
Die ländliche Gesellschaft im Zeitalter des Ersten Weltkrieges
Herausforderungen und ihre emotionalen Folgen©2024 Edited Collection -
Antireligiöse bzw. antikirchliche Gemeinschaften als Weltanschauungsgemeinschaften im Sinne des Religionsverfassungsrechts des Grundgesetzes
Dargestellt am Beispiel der „Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland e.V.“©2024 Thesis -
Das Wunder des Ostens
Die jesuitischen Missionsstrategien im Licht der Übersetzung religiöser Literatur im frühneuzeitlichen Japan©2024 Thesis -
Zeit und Zeitgeschehen in der periodischen Presse des 17.–19. Jahrhunderts
Fallstudien zu Perzeption und Reflexion©2024 Edited Collection -
Kampfarena Internet
Webseiten der Rechten und Linken aus deutscher und polnischer Perspektive.©2024 Monographs
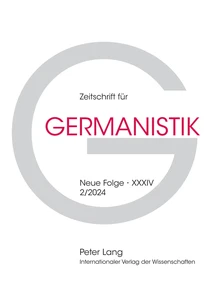
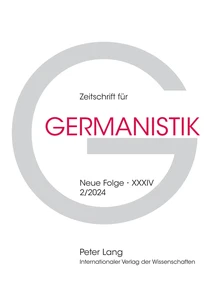
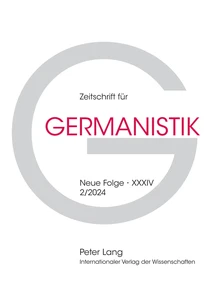
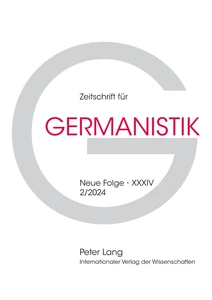
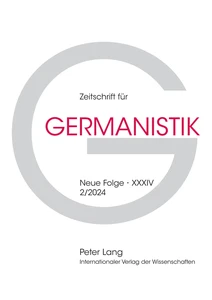
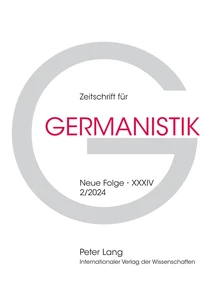
![Title: „Durch Stoff und Stimmung […] gerechtfertigt“.](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/1471628/medium.webp)